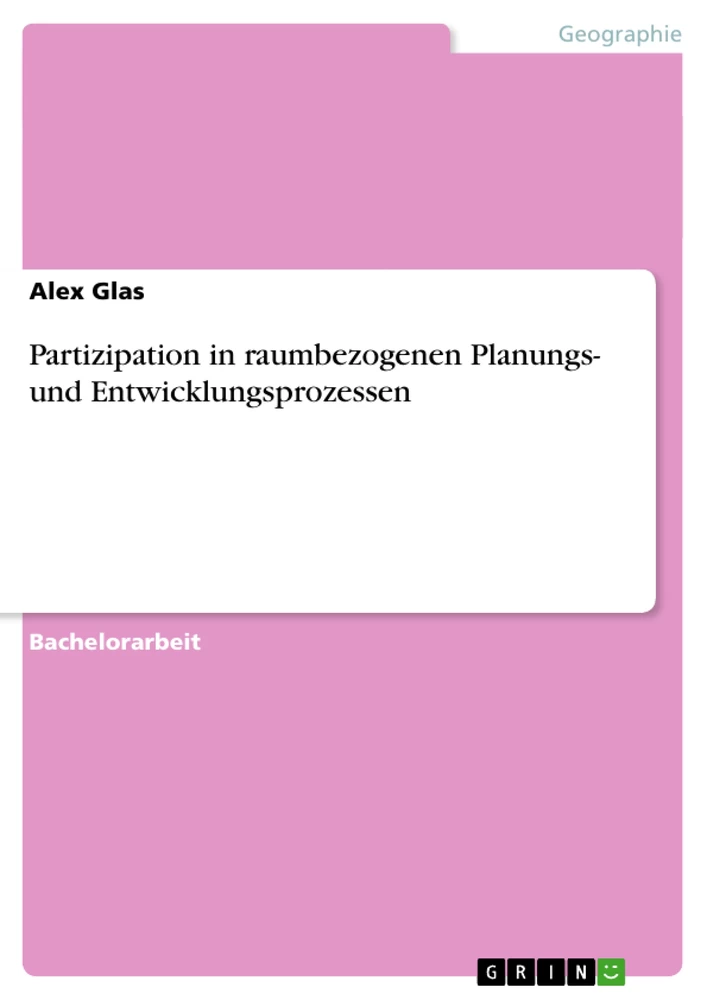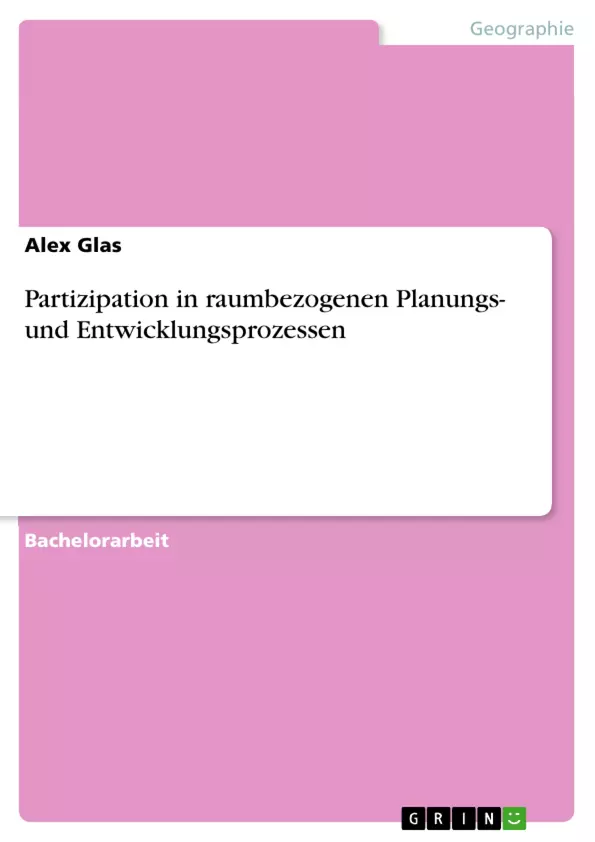Partizipation im Sinne gleichberechtigter Teilhabe/Teilnahme an einem Vorhaben, Mitbestimmung, Beteiligung und Anrecht auf Ertrag ist ein demokratiepolitisches Grundprinzip. In seinen Ausprägungen hat es unterschiedlichste Gestalten. Es reicht von plebiszitären Methoden (z.B. Volksbefragung) bis hin zu konkretem, planerischen Mitgestalten auf lokaler Ebene. In der Arbeit wird Partizipation als Grundprinzip vorgestellt, notwendige Bedingungen zur Implementierung diskutiert und Arten von Partizipation unterschieden. Beispielhaft werden Methoden vorgestellt, die in raumbezogenen Planungs- und Entwicklungsprozessen zum Einsatz kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie der Partizipation
- 2.1. Begriffsbestimmung
- 2.2. Wozu Partizipation?
- 2.3. Partizipationsformen
- 2.4. Rahmenbedingungen eines Partizipationsprozesses
- 2.5. Nutzen der Partizipation
- 2.6. Grenzen der Bürgerbeteiligung
- 3. Beteiligung der bolivianischen Zivilgesellschaft an der Armutsbekämpfung
- 3.1 Partizipation der „Armen“
- 3.2 Weshalb Bolivien?
- 3.3 Lebenssituation in einem Barrio am Beispiel El Alto
- 3.4 Partizipative Maßnahmen zur Armutsreduzierung
- 3.5 Die beteiligten Akteure
- 3.6 Zwischenergebnisse
- 3.7 Resümee des partizipatorischen Armutsbekämpfungsprogramms
- 4. BürgerInnenbeteiligung in Wien Alsergrund
- 4.1 Organisation, Struktur und Akteure des LA-21 Prozesses
- 4.2 Welche BürgerInnen beteiligen sich in Alsergrund?
- 4.2.1 Wo bleiben die benachteiligten Menschen?
- 4.2.2 Weshalb beteiligen sich Menschen am LA-21 Prozess?
- 4.3 Die Partizipation beeinflussende Faktoren in Alsergrund
- 4.3.1 Finanzierung
- 4.3.2 Organisation und Struktur
- 4.3.3 Politik und Verwaltung
- 4.3.4 BürgerInnen
- 4.4 Resümee des LA-21 Prozesses Wien Alsergrund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Partizipation in raumbezogenen Planungs- und Entwicklungsprozessen. Sie beleuchtet die Theorie der Partizipation, differenziert Partizipationsformen und analysiert Rahmenbedingungen für erfolgreiche Implementierung. Die Arbeit untersucht beispielhaft Partizipationsprozesse in Bolivien im Kontext der Armutsbekämpfung und in Wien-Alsergrund im Rahmen des LA-21 Prozesses.
- Theorie und Begriffsbestimmung von Partizipation
- Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren von Partizipationsprozessen
- Analyse von Partizipation in der Armutsbekämpfung (Bolivien)
- Untersuchung von Bürgerbeteiligung in einem lokalen Kontext (Wien Alsergrund)
- Vergleich und Gegenüberstellung verschiedener Partizipationsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Partizipation ein und skizziert die Forschungsfragen. Kapitel 2 befasst sich mit der Theorie der Partizipation, inklusive Begriffsbestimmung, verschiedenen Formen und Rahmenbedingungen. Kapitel 3 analysiert die Partizipation der bolivianischen Zivilgesellschaft an der Armutsbekämpfung, Kapitel 4 untersucht die Bürgerbeteiligung im LA-21 Prozess in Wien Alsergrund.
Schlüsselwörter
Partizipation, Bürgerbeteiligung, Raumbezogene Planung, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfung, Bolivien, Wien Alsergrund, LA-21 Prozess, Demokratie, Machtasymmetrien, Bürgermitwirkung.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter Partizipation in raumbezogenen Planungsprozessen verstanden?
Partizipation wird als gleichberechtigte Teilhabe, Mitbestimmung und Beteiligung an Vorhaben verstanden. Sie gilt als demokratiepolitisches Grundprinzip und reicht von plebiszitären Methoden wie Volksbefragungen bis hin zur konkreten planerischen Mitgestaltung auf lokaler Ebene.
Welche theoretischen Aspekte der Partizipation werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Begriffsbestimmung, den verschiedenen Formen der Partizipation, den notwendigen Rahmenbedingungen für Partizipationsprozesse sowie deren Nutzen und Grenzen.
Wie wird Partizipation im Kontext der Armutsbekämpfung in Bolivien analysiert?
Die Arbeit untersucht die Beteiligung der bolivianischen Zivilgesellschaft, insbesondere der „Armen“, an Programmen zur Armutsreduzierung. Dabei werden Akteure, Maßnahmen und die Lebenssituation in Barrios wie El Alto betrachtet.
Was ist der LA-21 Prozess in Wien Alsergrund?
Der LA-21 Prozess (Lokale Agenda 21) ist ein Beispiel für BürgerInnenbeteiligung auf lokaler Ebene. Die Arbeit analysiert hierbei die Organisationsstrukturen, die beteiligten Akteure und die Faktoren, die den Prozess beeinflussen, wie Politik, Verwaltung und Finanzierung.
Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg von Bürgerbeteiligung?
Wichtige Einflussfaktoren sind die Finanzierung, die organisatorische Struktur, das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung sowie die Motivation und Zusammensetzung der beteiligten BürgerInnen.
- Arbeit zitieren
- MSc Alex Glas (Autor:in), 2007, Partizipation in raumbezogenen Planungs- und Entwicklungsprozessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123270