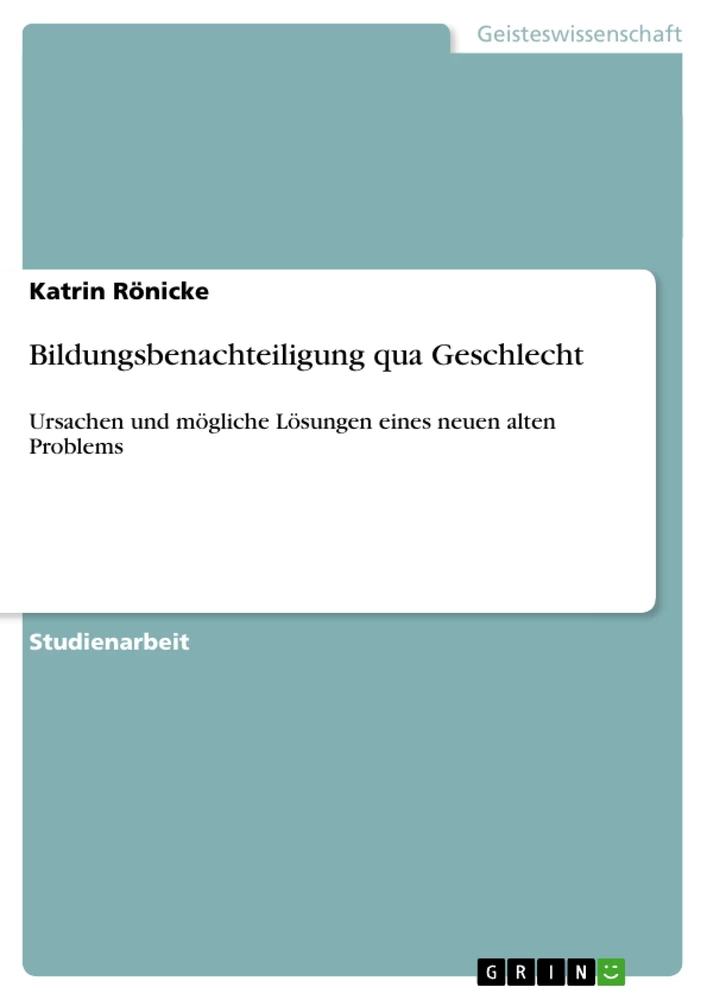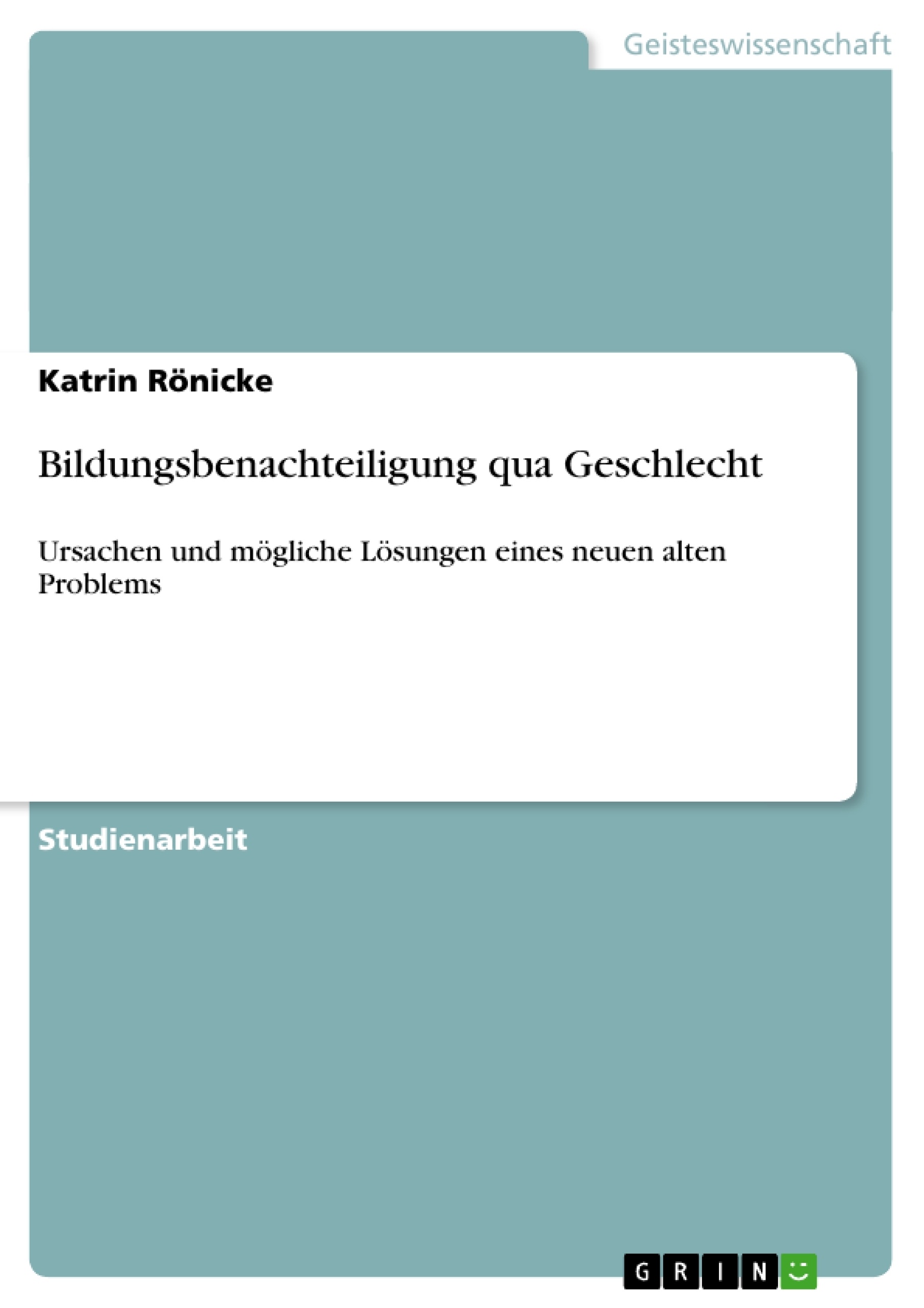Bekommen Jungen immer noch mehr Aufmerksamkeit von Lehrerinnen, oder weniger? Brauchen sie vielleicht sogar mehr davon, aufgrund ihrer anders strukturierten Gehirne? Würden Jungen mehr Leistung erbringen können, wenn sie sich weniger an ihren Mitschülern orientierten? Wie verstärkt das Schulsystem die missliche Lage der Geschlechter in der Schule? Wie verändern negative Verhaltens- und Leistungserwartungen das Selbstkonzept von Jungen und Mädchen? Wie kann ein Unterricht aussehen, der sich an den Interessen der Jungen orientiert, ohne aber die der Mädchen zu vernachlässigen und umgekehrt? Was könnte eine Reform des Schulsystems zur Veränderung der Lage von Jungen und Mädchen in den Schulen beitragen? Wie sollen Lehrerinnen in der Schule Geschlecht thematisieren, ohne es zu dramatisieren?
All diese Fragen sind weitgehend offen und unbeantwortet. Trotz jahrzehntelanger Arbeit auf diesem Feld wurde vor allem die Frage der Jungen meist vernachlässigt.
Doch aus der Fachrichtung der Gender Studies, aber zunehmend auch von den Erziehungswissenschaften, kommen mehr und mehr Anregungen und Beiträge, wie jüngst von Faulstich-Wieland und Hollstein, die ein neues Zusammenleben von Jungen und Mädchen, von Männern und Frauen „erfinden“. Oder zumindest durch eine Analyse der Probleme, durch kritische Reflexion erste Schritte hin zu dieser „Erfindung“ unternehmen.
Dieses neue Zusammenleben muss ganz klar bereits in den Familien beginnen. Wenn Jungen nach wie vor hellblaue und Mädchen rosane Strampler angezogen bekommen (bzw. diese Aufteilung ein Revival erlebt und wieder in Mode kommt), damit auch wirklich jeder sieht, was sonst noch nicht zu sehen wäre: nämlich das Geschlecht, dann bleibt fragwürdig, wie eine Dekonstruktion von Geschlechterzuschreibungen zugunsten eines beobachtenden Blickes auf den Menschen an sich funktionieren kann. Die Mehrheit der Eltern erwartet nach wie vor von Mädchen, dass sie mit Puppen spielen, sie lesen ihnen mehr vor, wohingegen Jungen mit Puppen nicht in Berührung kommen dürfen und komisch angesehen werden, wenn sie rosa Hosen tragen und lange Haare haben. Statt ihnen mehr Zuwendung im Kleinkindalter zukommen zu lassen, erwarten immer noch viele Eltern von Jungen robuster zu sein und weniger weinerlich, sie anerkennen sie nicht in ihrem Kleinsein. Wie können diese Vorurteile reflektiert und dekonstruiert werden?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung: Zum Hintergrund dieser Arbeit
- II. Zur Entwicklung männlicher und weiblicher Gehirne
- III. Mögliche Ursachen von Bildungsbenachteiligung qua Geschlecht: Geschlecht in pädagogischen Feldern
- III.1. Jungen und Mädchen in der Familie
- III.2. Jungen und Mädchen in Kindertageseinrichtungen
- III.3. Schulleben: Lehrer_innen
- III.5. Interaktionen und soziales Verhalten in der Schule
- IV. Lösungsansätze: Von der Familie bis zum Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Bildungsbenachteiligung bei Jungen und Mädchen und beleuchtet mögliche Lösungsansätze. Der Fokus liegt auf der Analyse von Geschlechterrollen und deren Einfluss auf die Bildungswege. Dabei werden unterschiedliche Entwicklungsphasen – von der Familie über die Kindertagesstätte bis zur Schule – betrachtet.
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnentwicklung
- Einfluss von Familie und Kindertagesstätten auf die Bildung
- Rolle von Lehrkräften im Bildungsprozess
- Soziales Verhalten und Interaktionen in der Schule
- Mögliche Lösungsansätze zur Reduzierung von Bildungsungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Zum Hintergrund dieser Arbeit: Die Einleitung beleuchtet die öffentliche Debatte um die vermeintliche Benachteiligung von Jungen im Bildungssystem und die damit verbundenen kontroversen Diskussionen. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit.
II. Zur Entwicklung männlicher und weiblicher Gehirne: Dieses Kapitel gibt einen Einblick in neurowissenschaftliche Erkenntnisse über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnentwicklung. Es werden die Auswirkungen von Hormonen auf die Gehirnentwicklung und deren mögliche Folgen für das Lernen diskutiert.
III. Mögliche Ursachen von Bildungsbenachteiligung qua Geschlecht: Geschlecht in pädagogischen Feldern: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Einflussfaktoren auf die Bildungsbenachteiligung, beginnend mit der Familie und der Kindertagesstätte, und betrachtet die Rolle der Lehrkräfte und das soziale Verhalten in der Schule.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, Geschlecht, Jungen, Mädchen, Gehirnentwicklung, Familie, Kindertagesstätte, Schule, Lehrer_innen, Sozialisation, Geschlechterrollen, Lösungsansätze.
- Quote paper
- Katrin Rönicke (Author), 2008, Bildungsbenachteiligung qua Geschlecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122829