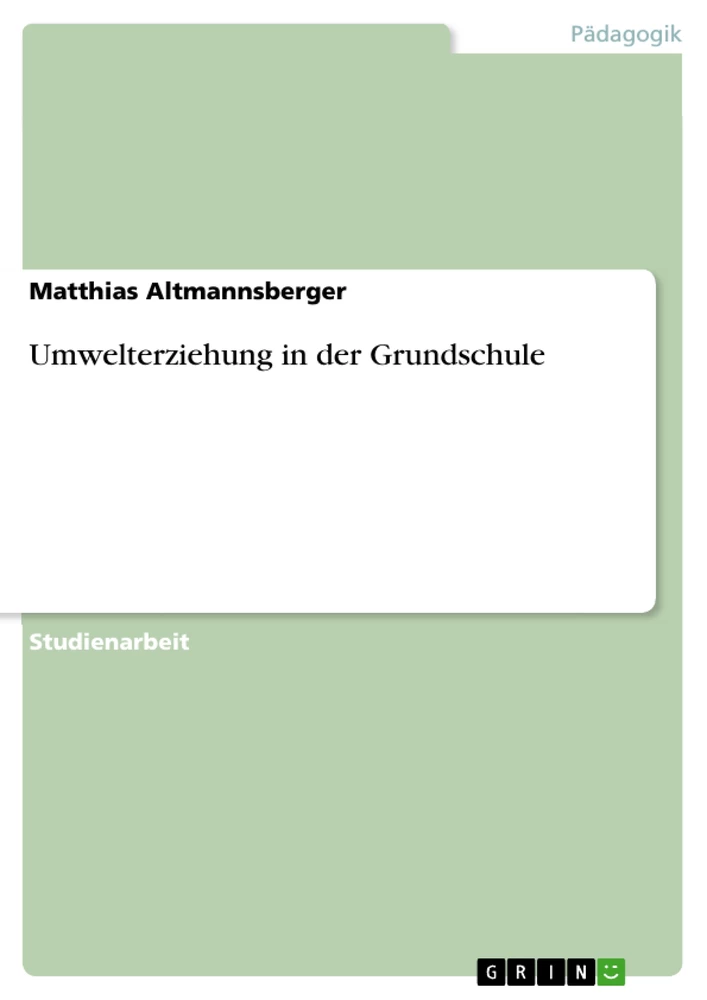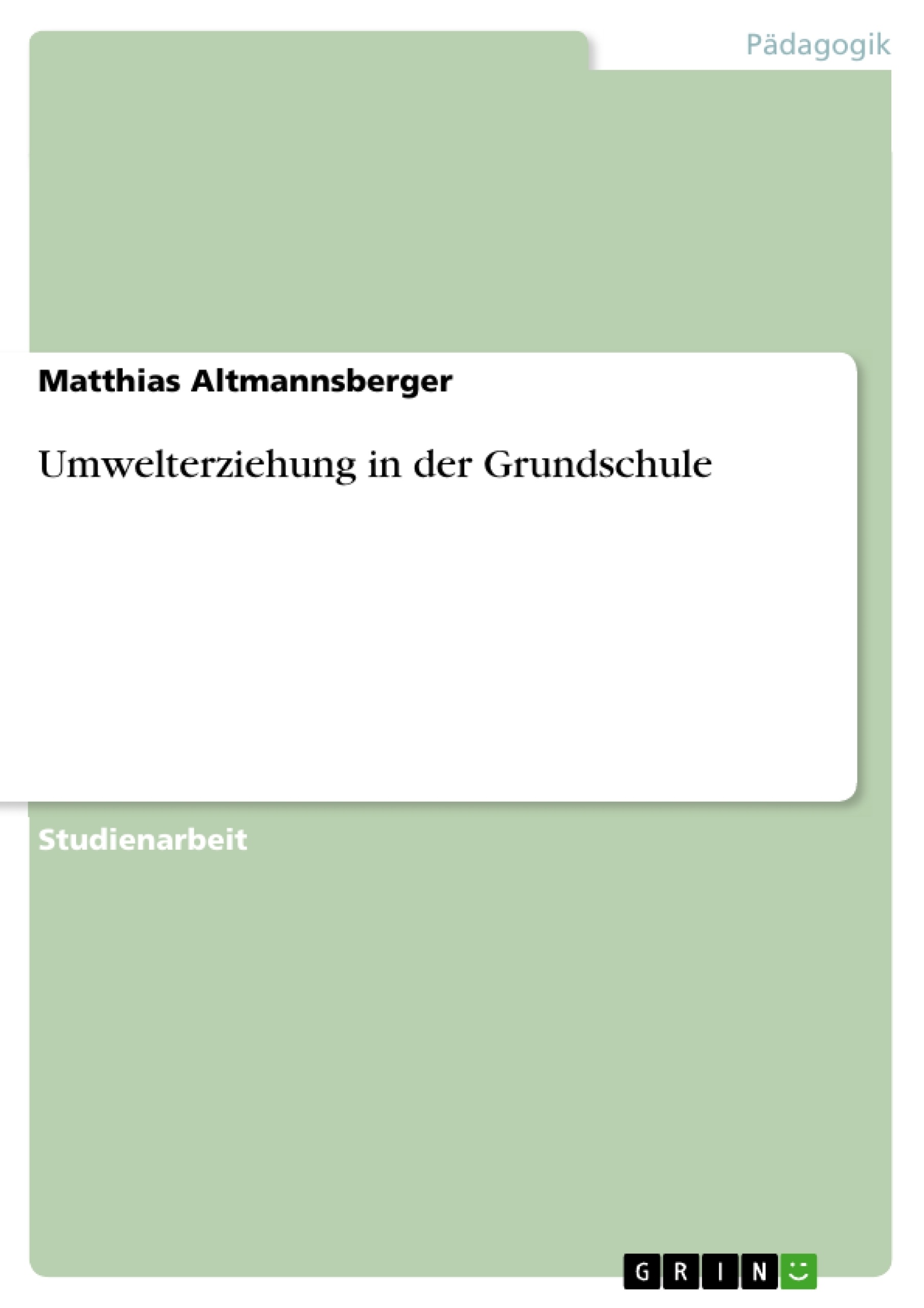Laut der IBM-Jugendstudie des Jahres 1992 stufen 70% der befragten Jugendlichen in den alten und neuen Bundesländern "das Umweltproblem" als großes Problem ein, bei der Wertschätzung sozialer Bewegungen nehmen im Urteil der 14 - 25-jährigen "Umweltschützer, Friedensbewegung und Kernkraftgegner" die ersten Plätze ein (laut SHELL-Jugendstudie 1992). Es zeigt sich also, dass junge Menschen heute sich der Bedrohung der Umwelt bewusst sind und dem Schutz der Umwelt einen hohen Stellenwert einräumen.
Besagte Studien zeigen aber auch die Tendenz, dass zwischen den geäußerten Einstellungen und dem tatsächlichen Verhalten eine Diskrepanz vorliegt: Nur etwa 60% der Befragten würden aus Umweltschutzgründen die Zahl der Autofahrten einschränken. Bei zunehmenden Restriktionsgrad der Maßnahmen, z.B. einem weitgehenden Verzicht auf das Autofahren, stimmt nurmehr eine Minderheit zu. Und das 1992!
Angesichts dieser Tatsache zu Resignieren hieße nach BOLSCHO den Erziehungsauftrag der Schule aufgeben. Umwelterziehung ist - und das belegt eine von EULEFELD, BOLSCHO & SEYBOLD 1991 durchgeführte Erhebung der Praxis schulischer Umwelterziehung in Deutschland - in allen Schularten noch verbesserungswürdig. Wie diese aussehen kann, die über das weitverbreitete Umweltwissen und die umweltverantwortliche Einstellung auch zu einem umweltgerechten Handeln führt, soll im folgenden gezeigt werden.
Dabei wird auf Begriff, Begründung und methodische Grundsätze der Umwelterziehung eingegangen. Hauptlernformen sollen erläutert und Realisierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Probleme und Grenzen der Umwelterziehung runden die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Begriffsbestimmung und Entwicklung der Umwelterziehung
- Rechtliche Verankerung der Umwelterziehung
- Bayerische Verfassung
- Bayerischer GS-Lehrplan von 1981
- Richtlinien für die Umwelterziehung an Bayer. Schulen von 1990
- Begründungen einer Umwelterziehung in der Grundschule
- Gesellschaftpolitische Begründung
- Theologische Begründung
- Grundschulpädagogische / Gesellschaftliche / Sozialisationstheoretische Begründung
- Methodische Grundsätze der Umwelterziehung
- Umwelterziehung folgt den Grundsätzen der Werterziehung
- Situationsbezug und Lebensnähe
- Handlungsorientierung und Handlungsfelder
- Fächerübergreifendes Unterrichten
- Weitere methodische Grundsätze
- Hauptlernformen der Umwelterziehung (nach Schwarz)
- Gemeinsame Gesprächssituationen
- Freie Aktivitäten
- Wahrnehmen von Pflegeaufgaben
- Gemeinsame Arbeitsvorhaben, Projektunterricht
- Begriffsklärung: Projekt
- Projektphasen nach Frey
- Realisierung der Umwelterziehung im Unterricht der Grundschule
- Voraussetzungen der Umwelterziehung
- Beispiele für eine Realisierung im Rahmen des Schullebens
- Schulgarten
- Schullandheim
- Beispiel
- Probleme und Grenzen der Umwelterziehung (nach Dürig)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umwelterziehung in der Grundschule. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die pädagogischen Begründungen und methodische Ansätze. Ein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung im Unterricht.
- Rechtliche Grundlagen der Umwelterziehung
- Pädagogische Begründungen für Umwelterziehung in der Grundschule
- Methodische Ansätze der Umwelterziehung
- Praktische Umsetzung im Grundschulkontext
- Herausforderungen und Grenzen der Umwelterziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Die Vorbemerkung verweist auf Studien, die belegen, dass Jugendliche das Umweltproblem als wichtig erachten, jedoch zwischen Einstellung und Handeln eine Diskrepanz besteht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten Umwelterziehung, die über Wissensvermittlung hinaus zu umweltgerechtem Handeln führt.
Begriffsbestimmung und Entwicklung der Umwelterziehung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Konzepts der Umwelterziehung von einem Fokus auf Naturschutz hin zu einem umfassenderen Ansatz, der ökologische Gesetzmäßigkeiten und die Bewahrung menschlicher Lebensgrundlagen berücksichtigt. Es definiert Umwelterziehung nach Eulefeld und hebt deren fächerübergreifenden Charakter und das Ziel der Verhaltensänderung hervor.
Rechtliche Verankerung der Umwelterziehung: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen der Umwelterziehung in Bayern, beginnend mit der Bayerischen Verfassung und weiterführend zu den Lehrplänen von 1981 und den Richtlinien von 1990. Es zeigt die fortschreitende Einbindung von Umwelterziehung in das Schulsystem auf.
Begründungen einer Umwelterziehung in der Grundschule: Dieses Kapitel liefert verschiedene Begründungen für die Notwendigkeit von Umwelterziehung in der Grundschule. Es werden gesellschaftliche, theologische und pädagogisch-sozialisationstheoretische Perspektiven beleuchtet, die die Bedeutung von Umwelterziehung für die Entwicklung verantwortungsbewusster Bürger betonen.
Methodische Grundsätze der Umwelterziehung: Das Kapitel erläutert die methodischen Grundsätze der Umwelterziehung. Es betont die Einbindung von Werterziehung, Situationsbezug und Lebensnähe, Handlungsorientierung, fächerübergreifenden Unterricht und weitere spezifische methodische Ansätze.
Hauptlernformen der Umwelterziehung (nach Schwarz): Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Hauptlernformen der Umwelterziehung nach Schwarz, darunter gemeinsame Gesprächssituationen, freie Aktivitäten, das Wahrnehmen von Pflegeaufgaben und gemeinsame Arbeitsvorhaben/Projektunterricht. Der Projektunterricht wird detaillierter erklärt, inklusive Begriffsklärung und Projektphasen nach Frey.
Realisierung der Umwelterziehung im Unterricht der Grundschule: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Umwelterziehung im Unterricht. Es beschreibt notwendige Voraussetzungen und nennt Beispiele für eine Realisierung im Rahmen des Schullebens, wie z.B. die Nutzung des Schulgartens und von Schullandheimaufenthalten. Ein konkretes Beispiel für die praktische Umsetzung wird ebenfalls gegeben.
Probleme und Grenzen der Umwelterziehung (nach Dürig): Dieses Kapitel (ohne Zusammenfassung, da es sich wahrscheinlich um den Schlussabschnitt handelt, der Spoiler enthalten könnte) behandelt vermutlich die Herausforderungen und Grenzen der Umwelterziehung.
Schlüsselwörter
Umwelterziehung, Grundschule, Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Methoden, Lehrplan, Bayern, Gesellschaft, Ökologie, Handlungsorientierung, Projektunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umwelterziehung in der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Umwelterziehung in der Grundschule in Bayern. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die pädagogischen Begründungen und methodischen Ansätze sowie die praktische Umsetzung im Unterricht und die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Aspekte der Umwelterziehung werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Aspekten ab, darunter die Begriffsbestimmung und Entwicklung der Umwelterziehung, die rechtliche Verankerung in bayerischen Verfassungsbestimmungen und Lehrplänen, die pädagogischen Begründungen (gesellschaftlich, theologisch, pädagogisch-sozialisationstheoretisch), methodische Grundsätze (Werterziehung, Handlungsorientierung, Fächerübergreifung), Hauptlernformen (nach Schwarz), praktische Umsetzung im Unterricht (Schulgarten, Schullandheim etc.) und schließlich Probleme und Grenzen der Umwelterziehung.
Welche rechtlichen Grundlagen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen der Umwelterziehung in Bayern, ausgehend von der Bayerischen Verfassung und den bayerischen Lehrplänen von 1981 sowie den Richtlinien für die Umwelterziehung an bayerischen Schulen von 1990. Der Fokus liegt auf der fortschreitenden Integration von Umwelterziehung in das Schulsystem.
Welche pädagogischen Begründungen werden angeführt?
Die Arbeit präsentiert gesellschaftliche, theologische und pädagogisch-sozialisationstheoretische Begründungen für die Umwelterziehung in der Grundschule. Der gemeinsame Nenner ist die Bedeutung von Umwelterziehung für die Entwicklung verantwortungsbewusster Bürger.
Welche methodischen Ansätze werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt methodische Grundsätze wie Werterziehung, Situationsbezug, Lebensnähe, Handlungsorientierung, fächerübergreifenden Unterricht und weitere spezifische Ansätze. Es werden auch verschiedene Hauptlernformen nach Schwarz vorgestellt, darunter gemeinsame Gesprächssituationen, freie Aktivitäten, Pflegeaufgaben und Projektunterricht (inkl. Projektphasen nach Frey).
Wie wird die praktische Umsetzung der Umwelterziehung im Unterricht dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Voraussetzungen für die Umsetzung und liefert Beispiele aus dem Schulleben, wie den Schulgarten und Schullandheimaufenthalte. Ein konkretes Beispiel für die praktische Umsetzung wird ebenfalls gegeben.
Welche Probleme und Grenzen der Umwelterziehung werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen und Grenzen der Umwelterziehung (nach Dürig), ohne diese im Detail zusammenzufassen, um Spoiler zu vermeiden. Dieser Abschnitt ist wahrscheinlich der Schlussabschnitt der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Umwelterziehung, Grundschule, Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Methoden, Lehrplan, Bayern, Gesellschaft, Ökologie, Handlungsorientierung, Projektunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Vorbemerkung, Begriffsbestimmung und Entwicklung der Umwelterziehung, Rechtliche Verankerung, Begründungen, Methodische Grundsätze, Hauptlernformen, Realisierung im Unterricht, und Probleme und Grenzen der Umwelterziehung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die detaillierten Inhalte der einzelnen Kapitel sind in der vollständigen Arbeit beschrieben. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über die jeweiligen Schwerpunkte.
- Arbeit zitieren
- Matthias Altmannsberger (Autor:in), 2003, Umwelterziehung in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12278