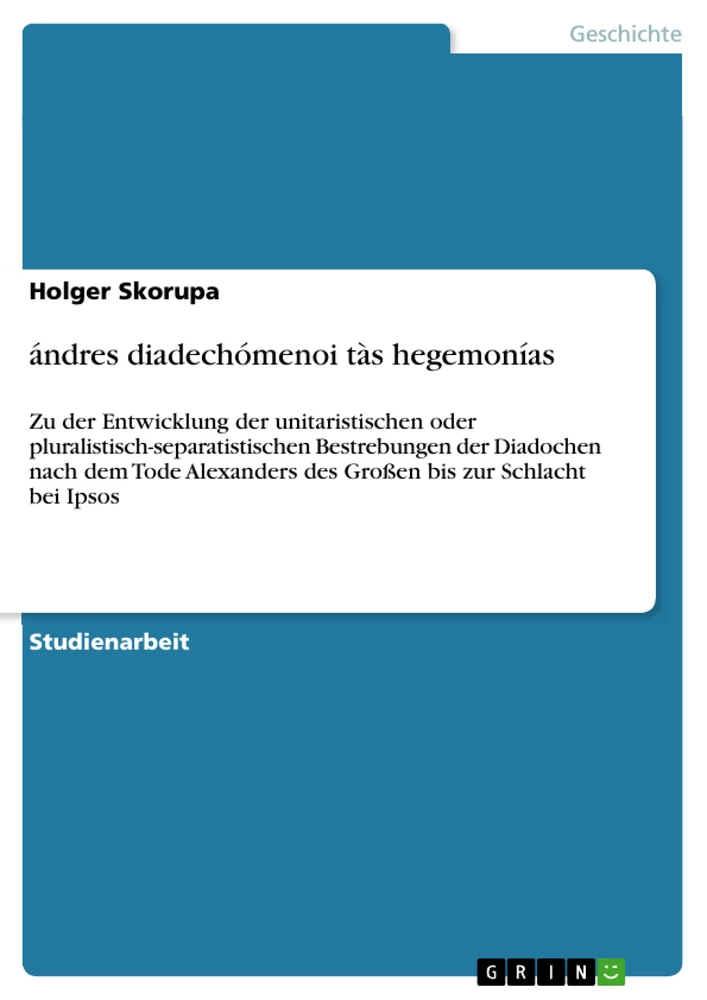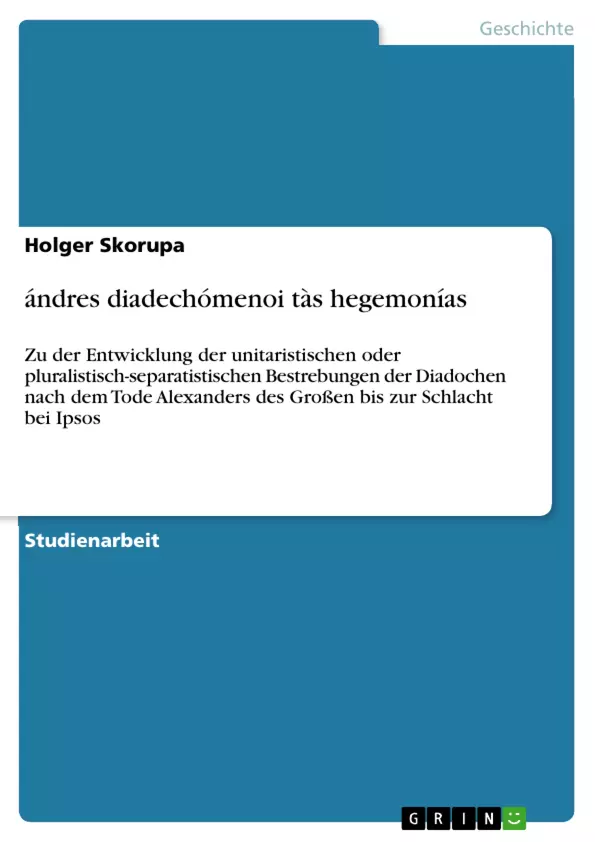Als Alexander der Große 323 v. Chr. in Babylon starb, hinterließ der Sohn Philipps II. ein ausgedehntes, im kulturellen Sinne pluralistisches, nahezu aufgeblähtes Reich unter makedonischer Hegemonie, das aufgrund der Vakanz in der legitimierten Nachfolge nach dem Gesetz der Natur der Makedonenkönige, d.h. nach dem dynastischen Prinzip, rasch in Unruhe geriet. Aber gleichwohl hatte der Großkönig die Gestalt seiner Zeit verändert; ihm gelang die normative Verknüpfung von Politik, Kultur, Wissenschaft und Technik, dem Kriegswesen wie auch eine Symbiose von der Organisation des makedonischen Heeres mit seinen territorialen Zielen. Alexander der Große hatte auf diese Weise mehr als ein unitaristisches Reich geschaffen; er hatte die Geschichte der antiken Welt maßgeblich geprägt. Seit Droysen wird eben jener Einfluss Alexanders auf seine Nachwelt als Hellenismus bezeichnet. Das Wirken des makedonischen Großkönigs zum einen als auch die gesamtgesellschaftliche und -politische Metamorphose während und nach der Regentschaft Alexanders des Großen andererseits war nun nicht mehr mit den bestimmenden Charakteristika der so genannten klassischen Zeit vergleichbar. Territoriale Großreiche, Bundesorganisationen und multilaterale Bündnissysteme, die unmittelbare Orientierung an der Notwendigkeit der Kriegführung und sozialstrukturelle Veränderungen bildeten die neuen Ideale herrschaftlicher Ansprüche ab. Gerade diese Aspekte waren erste Bestimmungsfaktoren in der Implementierung und dauerhaften Manifestierung der frühhellenistischen, monarchisch geprägten Staaten, die kaum 20 Jahre nach Alexanders Tod infolge der Annahme der Königstitel durch die ándres diadechómenoi tàs hegemonías entstanden waren. Was aber begünstigte den raschen Aufstieg der ehemaligen philoi und somatophylax Alexanders? Wie war es ihnen gelungen, die königlich-herrschaftliche Graduierung des makedonischen Königshauses zu falsifizieren? Worin bestand die Legitimitätsgrundlage der frühhellenistischen Königtümer und wie kam es, dass das unitaristische Alexanderreich alsbald nach dem Tode des Großkönigs in separatistisch-pluralistische Einzelbereiche mit autonomen, völkerrechtlichen Charakteristika zerfiel?
Wenn Diodor in seiner Library of History von den Diadochen als basileús berichtet , die ihre Territorien als Preis des Krieges beherrschten, als seien die Ländereien „(…) mit dem Speer erworben (…).“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die politische und gesellschaftliche Statuierung der ándres diadechómenoi tàs hegemonías und die Neuordnung von Babylon
- 2.1 Etymologie der Diadochen und die militär-politischen Positionen der Kommandeure als Bestimmungsfaktoren
- 2.2 Die Verteilung der Satrapien
- 3. Das dynamische Gleichgewichtssystem der Diadochen - Von dem Lamischen Krieg bis zur Regelung von Triparadeisos 320 v. Chr.
- 4. Die Unterwanderung der dynastischen Legitimität
- 4.1 Der Zweite Diadochenkrieg
- 4.2 Die Fehde in der makedonischen Königsfamilie
- 5. Der Dritte Diadochenkrieg – Gegenseitige Anerkennung der Herrscher und Beginn der Freiheitspropaganda
- 6. Die Diadochen als basileús - Charisma und Sieghaftigkeit als herrschaftliche Legitimitätsgrundlage
- 6.1 Der Götterkult des athenischen Volkes
- 6.2 Die Annahme der Königstitel der Diadochen seit 306 v.Chr. als Ausdruck militärischer Errungenschaften, der kultischen Verehrung und Kompensation von Sieglosigkeit
- 7. Von der Erneuerung des Korinthischen Bundes bis zur Schlacht bei Ipsos 301 v.Chr.
- 8. Schlussteil – Ergebnisse der Betrachtungen und Ausblicke auf die künftige Forschungsarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der politischen Strukturen nach dem Tod Alexanders des Großen. Sie analysiert die Bestrebungen der Diadochen, ihre Macht zu legitimieren und ein unitaristisches oder pluralistisch-separatistisches Reich zu etablieren, bis zur Schlacht bei Ipsos. Der Fokus liegt auf den Legitimierungsversuchen der Diadochen und den daraus resultierenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen.
- Die Legitimierung der Macht der Diadochen
- Die Entwicklung unitaristischer und pluralistisch-separatistischer Bestrebungen
- Die Rolle des Militärs und der Kriegführung
- Die Bedeutung von Charisma und Sieghaftigkeit
- Die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen im frühen Hellenismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Situation nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 v. Chr. und stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung der politischen Strukturen und der Legitimierung der Macht der Diadochen bis zur Schlacht bei Ipsos. Sie hebt die Bedeutung der Quellenlage hervor und benennt die wichtigsten Historiographen, deren Werke für die Untersuchung relevant sind, wie Diodor, Plutarch und Appian. Der Autor unterstreicht die komplexen gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen und die Herausforderungen, vor denen die Diadochen standen.
2. Die politische und gesellschaftliche Statuierung der ándres diadechómenoi tàs hegemonías und die Neuordnung von Babylon: Dieses Kapitel analysiert die unmittelbaren Folgen des Todes Alexanders und die darauf folgende Neuordnung des Reiches. Es untersucht die Etymologie des Begriffs "Diadochen" und die militärisch-politischen Positionen der Kommandeure als Einflussfaktoren auf die Machtverteilung. Die Verteilung der Satrapien wird ebenfalls detailliert beleuchtet, wobei die strategischen Überlegungen und Machtkämpfe der Diadochen im Mittelpunkt stehen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die ehemaligen Kommandeure Alexanders ihre Positionen festigten und zu bedeutenden Machthabern wurden. Das Kapitel analysiert, wie aus den Strukturen des Alexanderreiches die neuen Machtbereiche der Diadochen hervorgingen.
3. Das dynamische Gleichgewichtssystem der Diadochen - Von dem Lamischen Krieg bis zur Regelung von Triparadeisos 320 v. Chr.: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung eines dynamischen Gleichgewichtssystems unter den Diadochen nach dem Tod Alexanders. Es analysiert den Lamischen Krieg und die anschließende Regelung von Triparadeisos im Jahr 320 v. Chr. als wichtige Meilensteine in diesem Prozess. Der Fokus liegt auf den sich ständig verändernden Bündnissen und Konflikten zwischen den Diadochen, sowie auf ihren Strategien zur Sicherung ihrer Macht und zur Erweiterung ihrer Territorien. Die Zusammenfassung unterstreicht die Bedeutung dieser Phase für die spätere Entwicklung der hellenistischen Reiche.
4. Die Unterwanderung der dynastischen Legitimität: Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen für die dynastische Legitimität des makedonischen Königshauses nach dem Tod Alexanders. Es analysiert den Zweiten Diadochenkrieg und die Fehde innerhalb der makedonischen Königsfamilie als Ausdruck der Machtstrukturen und deren Fragilität. Es wird untersucht, wie die Diadochen die traditionelle makedonische Thronfolge untergruben und ihre eigenen Ansprüche auf die Macht begründeten. Die Bedeutung innerer Konflikte innerhalb der makedonischen Dynastie und deren Auswirkungen auf die Machtverhältnisse wird herausgestellt.
5. Der Dritte Diadochenkrieg – Gegenseitige Anerkennung der Herrscher und Beginn der Freiheitspropaganda: Dieses Kapitel fokussiert sich auf den Dritten Diadochenkrieg und die sich daraus ergebende gegenseitige Anerkennung der Herrscher. Es beleuchtet das Aufkommen der "Freiheitspropaganda" und deren Einfluss auf die politische Landschaft. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Diadochen ihre Herrschaft trotz fehlender eindeutiger Legitimität zu festigen versuchten und welche Rolle dabei die Propaganda spielte. Die Analyse befasst sich mit der Entwicklung der neuen politischen Ordnung.
6. Die Diadochen als basileús - Charisma und Sieghaftigkeit als herrschaftliche Legitimitätsgrundlage: In diesem Kapitel wird die Annahme des Königstitels durch die Diadochen seit 306 v. Chr. untersucht. Der Autor analysiert die Bedeutung von Charisma und militärischen Erfolgen für die Legitimierung ihrer Herrschaft. Es werden die Strategien der Diadochen beleuchtet, wie sie ihren Herrschaftsanspruch durch den Götterkult und die Inszenierung von Siegen zu festigen suchten. Die religiöse und propagandistische Dimension der Herrschaftslegitimation steht im Mittelpunkt. Der Bezug zum Militär und der militärische Erfolg als entscheidender Faktor für die Legitimation der Herrschaft werden analysiert.
7. Von der Erneuerung des Korinthischen Bundes bis zur Schlacht bei Ipsos 301 v.Chr.: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklungen von der Erneuerung des Korinthischen Bundes bis zur Schlacht bei Ipsos im Jahr 301 v. Chr. Es beschreibt die strategischen Allianzen, militärischen Konflikte und die daraus resultierende Neuordnung der Machtverhältnisse. Der Fokus liegt auf den Ereignissen, die zur Schlacht bei Ipsos führten und deren Folgen für das weitere Schicksal der Diadochenreiche. Die Bedeutung des Korinthischen Bundes als Instrument der Machtausübung und dessen Auswirkungen werden analysiert.
Schlüsselwörter
Diadochen, Alexander der Große, Hellenismus, Legitimität, Macht, Kriegführung, Königstitel, basileús, unitaristisches Reich, pluralistisch-separatistische Bestrebungen, Triparadeisos, Ipsos, Charisma, Götterkult, Historiographie, Diodor, Plutarch, Appian.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Diadochen nach Alexander dem Großen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die politische Entwicklung nach dem Tod Alexanders des Großen (323 v. Chr.) und konzentriert sich auf die Bestrebungen der Diadochen, ihre Macht zu legitimieren und ein einheitliches (unitaristisches) oder ein geteiltes (pluralistisch-separatistisches) Reich zu etablieren, bis zur Schlacht bei Ipsos (301 v. Chr.). Der Schwerpunkt liegt auf den Legitimierungsstrategien der Diadochen und den daraus resultierenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Legitimierung der Macht der Diadochen, die Entwicklung unitaristischer und pluralistisch-separatistischer Bestrebungen, die Rolle des Militärs und der Kriegführung, die Bedeutung von Charisma und militärischen Erfolgen für die Legitimation, sowie die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen im frühen Hellenismus. Die einzelnen Diadochenkriege und wichtige Verträge wie die Regelung von Triparadeisos werden detailliert analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Kapitel 1 ist eine Einleitung, die den Forschungsstand und die Fragestellung definiert. Kapitel 2 behandelt die politische und gesellschaftliche Neuordnung nach Alexanders Tod und die Verteilung der Satrapien. Kapitel 3 beschreibt das dynamische Gleichgewichtssystem der Diadochen bis zur Regelung von Triparadeisos. Kapitel 4 analysiert die Unterwanderung der dynastischen Legitimität und den Zweiten Diadochenkrieg. Kapitel 5 befasst sich mit dem Dritten Diadochenkrieg und dem Beginn der Freiheitspropaganda. Kapitel 6 untersucht die Annahme des Königstitels durch die Diadochen und die Rolle von Charisma und Sieghaftigkeit. Kapitel 7 analysiert die Entwicklungen vom Korinthischen Bund bis zur Schlacht bei Ipsos. Kapitel 8 bietet einen Schluss und einen Ausblick auf die zukünftige Forschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Werke wichtiger Historiographen des Hellenismus, namentlich Diodor, Plutarch und Appian. Die Bedeutung und die Herausforderungen der Quellenlage werden in der Einleitung hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Diadochen, Alexander der Große, Hellenismus, Legitimität, Macht, Kriegführung, Königstitel, basileús, unitaristisches Reich, pluralistisch-separatistische Bestrebungen, Triparadeisos, Ipsos, Charisma, Götterkult, Historiographie, Diodor, Plutarch, Appian.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie entwickelten sich die politischen Strukturen und die Legitimierung der Macht der Diadochen nach dem Tod Alexanders des Großen bis zur Schlacht bei Ipsos?
Wie wird die Legitimation der Diadochen in der Arbeit behandelt?
Die Legitimation der Diadochen wird als zentrales Thema behandelt. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, wie militärische Erfolge, Charisma, den Götterkult und die Aneignung des Königstitels (basileús) als Strategien zur Festigung der Macht und zur Legitimierung der Herrschaft.
Welche Rolle spielt das Militär in der Arbeit?
Das Militär spielt eine entscheidende Rolle. Die Arbeit analysiert die militärischen Konflikte (Diadochenkriege), die strategischen Allianzen und die Bedeutung militärischer Erfolge für die Legitimierung der Herrschaft der Diadochen.
- Citation du texte
- Holger Skorupa (Auteur), 2008, ándres diadechómenoi tàs hegemonías, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122781