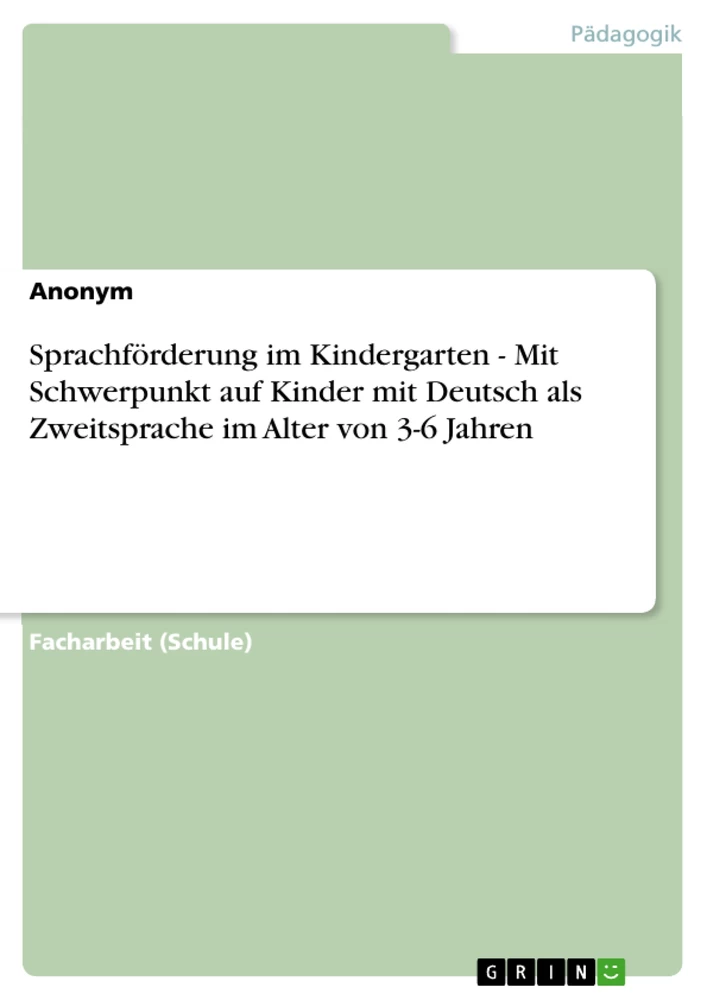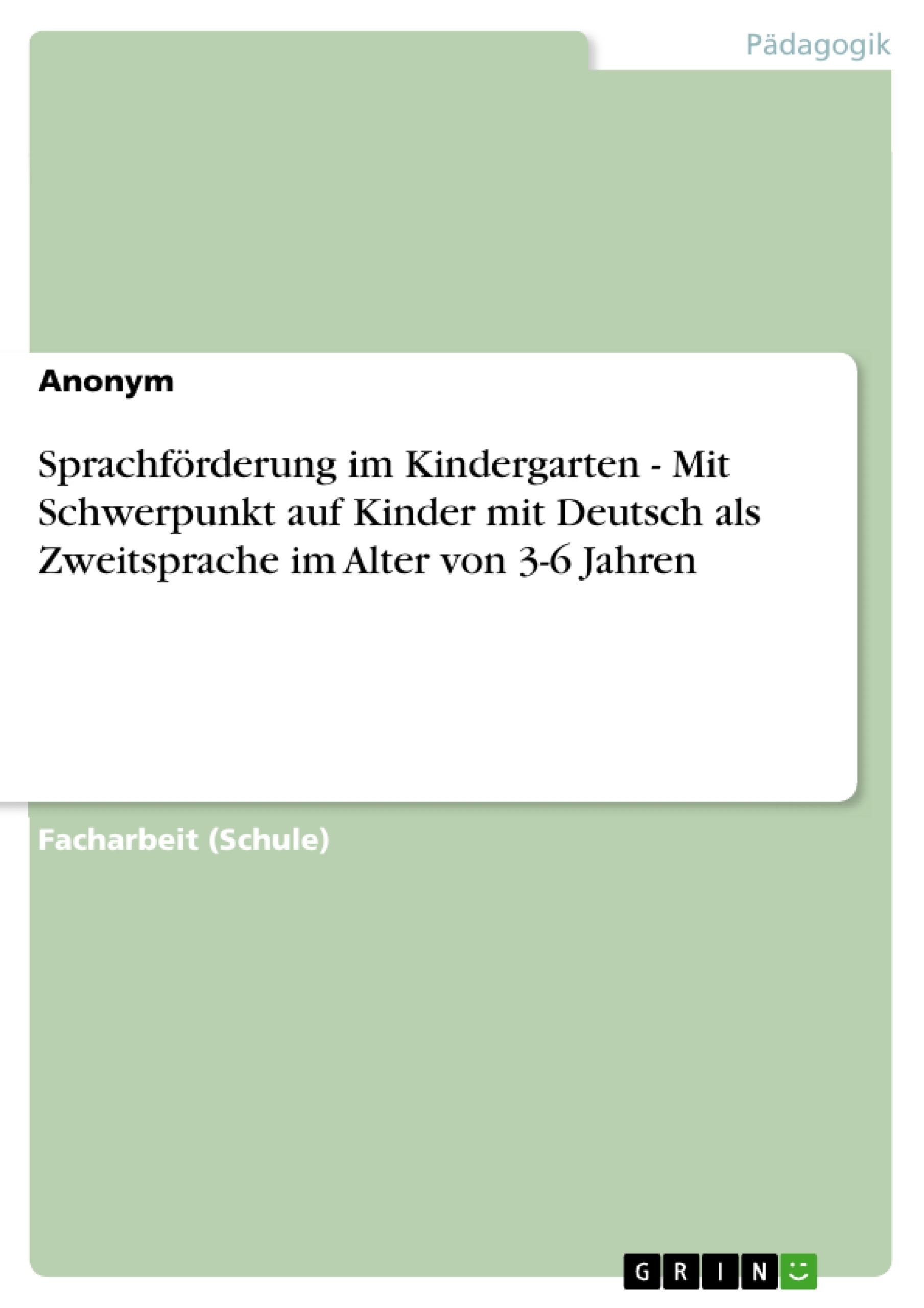Sprachförderung ein Thema welches in unserer heutigen Gesellschaft immer wichtiger wird. Jedes vierte Kind in Deutschland spricht zu Hause eine andere Sprache als Deutsch! Daher muss gerade der Kindergarten/ die Kita diesen Part der Sprachförderung der Umgebungssprache Deutsch übernehmen. Doch wie? Dies und vieles weitere wird in dieser Facharbeit genauer unter die Lupe genommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau der Facharbeit
- 1.2 Begründung der Themenwahl mit Praxiserfahrung
- 2. Die Sprachentwicklung
- 2.1 Begriffserläuterung und Funktion von Sprache
- 2.2 Die Phasen der Sprachentwicklung im Alter von drei bis sechs Jahren
- 3. Der Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit
- 3.1 Die Definition von „Mehrsprachigkeit“
- 3.2 Die zwei typischen Verläufe des Spracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern
- 4. Die Bedeutung der Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache
- 4.1 Der Sprachbaum nach Wendlandt
- 4.2 Der zweisprachige Sprachbaum
- 5. Sprachförderung – „Deutsch Lernen im Kindergarten“
- 5.1 Definition und Zielgruppe für die Sprachförderung im Kindergarten
- 5.2 Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern
- 5.2.1 Additive Sprachförderung
- 5.2.2 Alltagsintegrierte Sprachförderung
- 5.3 Grundsätze der Sprachförderung
- 5.4 Das Programm „Rucksack-Kita“
- 6. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Sprachförderung im Kindergarten, insbesondere für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Alter von 3-6 Jahren. Ziel ist es, die Herausforderungen des Spracherwerbs bei Mehrsprachigkeit zu beleuchten und geeignete Fördermethoden zu evaluieren. Die Arbeit basiert auf der Praxiserfahrung der Autorin in einer Sprach-Kita.
- Sprachentwicklung bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren
- Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit und die Rolle der Erstsprache
- Methoden der Sprachförderung im Kindergarten
- Integration der Muttersprache in die Sprachförderung
- Evaluation verschiedener Förderansätze, u.a. das Programm „Rucksack-Kita“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die immense Bedeutung von Sprache für die Entwicklung und Teilhabe von Kindern. Sie führt in das Thema Sprachförderung im Kindergarten ein, mit besonderem Fokus auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, basierend auf der hohen Anzahl an mehrsprachigen Kindern in Deutschland und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Autorin beschreibt ihren persönlichen Kontext und die Motivation für die Arbeit, geleitet von Erfahrungen in einer Sprach-Kita in einem sozial benachteiligten Umfeld.
2. Die Sprachentwicklung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der Sprachentwicklung bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Es definiert den Begriff „Sprache“ und beschreibt die zentralen Phasen der Sprachentwicklung in diesem Alter. Es liefert wichtige Konzepte, um die späteren Kapitel über den Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit und die Sprachförderung zu verstehen.
3. Der Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel widmet sich dem Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern. Es definiert Mehrsprachigkeit und beleuchtet zwei typische Verläufe des Spracherwerbs in diesem Kontext. Es dient als Brücke zum nächsten Kapitel, indem es die Grundlagen für das Verständnis der Bedeutung der Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache legt.
4. Die Bedeutung der Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache: Dieses Kapitel analysiert die entscheidende Rolle der Erstsprache für den erfolgreichen Erwerb einer Zweitsprache. Es erklärt das Konzept des Sprachbaums nach Wendlandt und erweitert dieses auf den zweisprachigen Kontext. Die Diskussion über den Einfluss der Muttersprache auf den Zweitspracherwerb liefert wertvolle Einblicke für die Entwicklung effektiver Fördermaßnahmen.
5. Sprachförderung – „Deutsch Lernen im Kindergarten“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf verschiedene Ansätze der Sprachförderung im Kindergarten. Es definiert den Begriff „Sprachförderung“ und beschreibt die Zielgruppen. Es analysiert additive und alltagsintegrierte Sprachförderung und präsentiert die Grundsätze erfolgreicher Sprachförderung. Schließlich stellt es das Programm „Rucksack-Kita“ als eine mögliche Methode vor, um die Bedeutung dieser Fördermethode zu erläutern und ihre Anwendbarkeit im Kindergarten zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Erstsprache, Zweitsprache, Sprachentwicklung, additive Sprachförderung, alltagsintegrierte Sprachförderung, Rucksack-Kita, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Sprachförderung im Kindergarten
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Sprachförderung im Kindergarten, insbesondere für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Alter von 3-6 Jahren. Sie beleuchtet die Herausforderungen des Spracherwerbs bei Mehrsprachigkeit und evaluiert geeignete Fördermethoden, basierend auf der Praxiserfahrung der Autorin in einer Sprach-Kita.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Sprachentwicklung bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren, den Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit und die Rolle der Erstsprache dabei, Methoden der Sprachförderung im Kindergarten, die Integration der Muttersprache in die Sprachförderung und die Evaluation verschiedener Förderansätze, darunter das Programm „Rucksack-Kita“.
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Facharbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Sprachentwicklung, Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit, Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb, Sprachförderung im Kindergarten (inkl. „Rucksack-Kita“) und Reflexion. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Sprachförderung und baut aufeinander auf.
Welche Zielsetzung verfolgt die Facharbeit?
Ziel der Facharbeit ist es, die Herausforderungen des Spracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern im Kindergartenalter zu beleuchten und geeignete Fördermethoden zu evaluieren. Die Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis und zur Verbesserung der Sprachförderung leisten.
Welche Methoden der Sprachförderung werden betrachtet?
Die Facharbeit betrachtet verschiedene Methoden der Sprachförderung, darunter additive und alltagsintegrierte Sprachförderung. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Programm „Rucksack-Kita“, dessen Anwendbarkeit und Bedeutung im Kindergarten untersucht wird.
Welche Rolle spielt die Erstsprache im Spracherwerb?
Die Facharbeit betont die entscheidende Rolle der Erstsprache für den erfolgreichen Erwerb einer Zweitsprache. Das Konzept des Sprachbaums nach Wendlandt wird erläutert und auf den zweisprachigen Kontext angewendet, um den Einfluss der Muttersprache auf den Zweitspracherwerb zu verdeutlichen.
Welche Zielgruppe wird in der Facharbeit adressiert?
Die Facharbeit adressiert Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten, Sprachtherapeuten, Pädagogen und alle, die sich mit der Sprachförderung von mehrsprachigen Kindern im Kindergartenalter befassen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Facharbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Sprachförderung, Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Erstsprache, Zweitsprache, Sprachentwicklung, additive Sprachförderung, alltagsintegrierte Sprachförderung, Rucksack-Kita, Migrationshintergrund.
Wo findet man weitere Informationen zum Programm „Rucksack-Kita“?
Die Facharbeit beschreibt das Programm „Rucksack-Kita“ als Beispiel für eine erfolgreiche Fördermethode. Weitere Informationen können über die entsprechenden Stellen, die das Programm anbieten und begleiten, eingeholt werden (genaue Quellenangabe fehlt im vorliegenden Auszug).
Auf welcher Grundlage basiert die Facharbeit?
Die Facharbeit basiert auf theoretischen Grundlagen der Sprachentwicklung und des Spracherwerbs sowie auf der Praxiserfahrung der Autorin in einer Sprach-Kita in einem sozial benachteiligten Umfeld.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Sprachförderung im Kindergarten - Mit Schwerpunkt auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Alter von 3-6 Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1223199