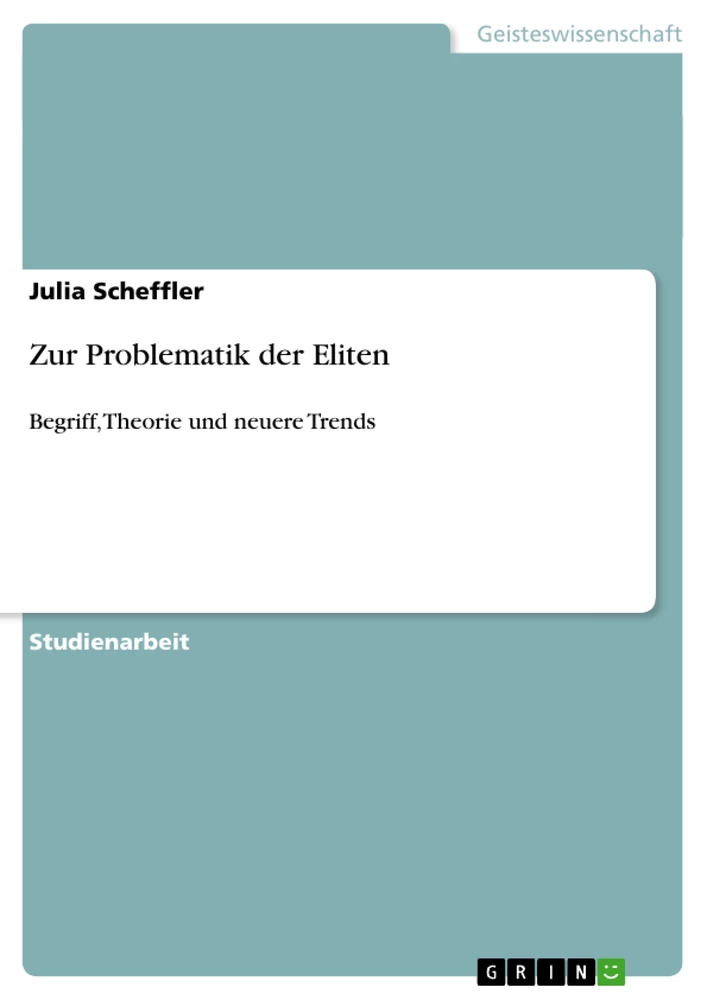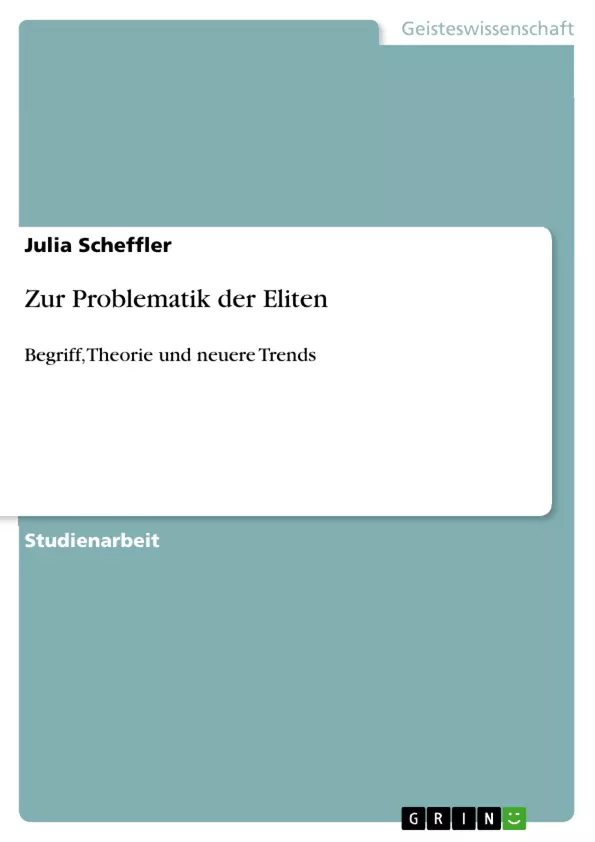In den Medien hat sich der Begriff der Eliten wieder zunehmender Beliebtheit erfreut. Im vorliegenden Text wird auf verschiedene Definitionen von Elite eingegangen und deutlich gemacht, warum sich Teile der Öffentlichkeit mit der Bezeichung Elite schwertun. Wie bei vielen Begriffen, die in öffentlichen Diskursen häufig auftreten, lässt sich eine
einheitliche Definition von Elite kaum finden. Dem Wortursprung nach, es stammt aus dem
Französischen „èlire“ abgeleitet von dem lateinischen Wort „eligere“, kommt Elite von
wählen, auswählen. Bezogen auf das Lateinische kann man auch eine Verbindung zur Bibel
ziehen, in der verkündet ist, dass viele berufen, aber nur wenige erwählt sind. Aus diesem
Bibeltext wurde dann auch geschlossen, dass somit auch eine Eliteposition und die
herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, wie z.B. das Fehlen von Aufstiegschancen, die
über das Mittelalter hinaus Bestand hatten, einfach als gottgegeben hingenommen werden
sollten. In der Bevölkerung kam der Elitebegriff historisch betrachtet im 18. Jahrhundert in
Frankreich auf und wurde vor allem für die Abgrenzung des aufstrebenden Bürgertums gegen
Adel und Klerus verwendet. Denn es sollte statt der Geburt auf persönliche Leistungen
ankommen. Im 19. Jahrhundert erlebte der Begriff eine inhaltliche Verschiebung, indem die
Elite als Gegensatz zur Masse verstanden wurde. Wissenschaftler sprechen in diesen älteren
Elitetheorien von einer Dichotomie zwischen Masse bzw. dem Volk und den Regierenden,
der Elite. Die in dieser Zeit entstandenen klassischen Werke der Elitetheorien wie z.B. Pareto,
Mosca und Michels, werden daher auch als indirekte Wegbereiter des Faschismus betrachtet,
da sie als ideologisches Grundgerüst dienten. Dies führte zur Diskreditierung des
Elitebegriffes bis es nach dem II. Weltkrieg zu einer Neubestimmung kam. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition
- 2. Wer gehört zur Elite?
- 3. Funktionen und Arten von Eliten
- 4. Zur Problematik der Eliten
- 5. Die wichtigsten Theoretiker
- 5.1. Die Klassiker
- 5.2. Die Kritiker
- 5.3. Amerikanische Elitetheoretiker
- 5.4. Deutsche Elitetheoretiker
- 6. Neuere Trends
- 7. Das Beispiel Konrad Adenauer - Zu welcher Elite gehört er?
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Elitebegriff in der Soziologie. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition von "Elite", analysiert verschiedene Kriterien zur Identifizierung von Eliten und untersucht deren Funktionen und Arten. Die Arbeit betrachtet zudem die wichtigsten Elitetheoretiker und aktuelle Entwicklungen im Verständnis von Eliten.
- Definition und historische Entwicklung des Elitebegriffs
- Kriterien zur Identifizierung von Eliten und verschiedene Methoden
- Funktionen und Arten von Eliten (offene vs. geschlossene Eliten)
- Wichtige Elitetheoretiker und deren Ansätze
- Neuere Trends in der Eliteforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Definition: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition von "Elite" zu finden, verfolgt den Begriffseigen historisch und diskutiert die Verbindung zu Macht, Herrschaft und Selektion.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kapitel 2: Wer gehört zur Elite?: Hier werden verschiedene Methoden zur Identifizierung von Eliten vorgestellt (Reputations-, Entscheidungs- und Positionstechnik) sowie weitere Ansätze wie der netzwerkanalytische und der Cleavage-Ansatz.9, 10, 11, 12, 13 Die Schwierigkeiten einer objektiven Bestimmung werden hervorgehoben.
Kapitel 3: Funktionen und Arten von Eliten: Dieses Kapitel diskutiert die verschiedenen Arten von Eliten, unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Eliten und betrachtet historische und moderne Konzepte wie Macht- und Wertelite.14, 15, 16, 17
Schlüsselwörter
Elite, Elitentheorien, Macht, Herrschaft, Selektion, Elitetypen, Eliteforschung, Methoden der Eliteidentifizierung, soziale Schichtung, Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Woher stammt der Begriff „Elite“ ursprünglich?
Der Begriff leitet sich vom französischen „élire“ bzw. lateinischen „eligere“ ab, was „auswählen“ oder „wählen“ bedeutet.
Warum war der Elitebegriff historisch diskreditiert?
Die klassischen Elitetheorien (z.B. von Pareto oder Michels) dienten teilweise als ideologisches Grundgerüst für den Faschismus, was nach dem II. Weltkrieg eine Neudefinition erforderte.
Was ist der Unterschied zwischen einer Machtelite und einer Wertelite?
Machteliten definieren sich über ihre Position und ihren Einfluss auf Entscheidungen, während Werteliten durch besondere moralische oder kulturelle Leistungen hervorstechen.
Welche Techniken werden zur Identifizierung von Eliten genutzt?
Wissenschaftler nutzen die Reputationstechnik (Ansehen), die Entscheidungstechnik (Einfluss auf Prozesse) und die Positionstechnik (formale Ämter).
Was unterscheidet offene von geschlossenen Eliten?
Offene Eliten ermöglichen den Aufstieg durch Leistung, während geschlossene Eliten den Zugang durch Herkunft oder soziale Schichtung beschränken.
- Arbeit zitieren
- B.A. Julia Scheffler (Autor:in), 2005, Zur Problematik der Eliten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122301