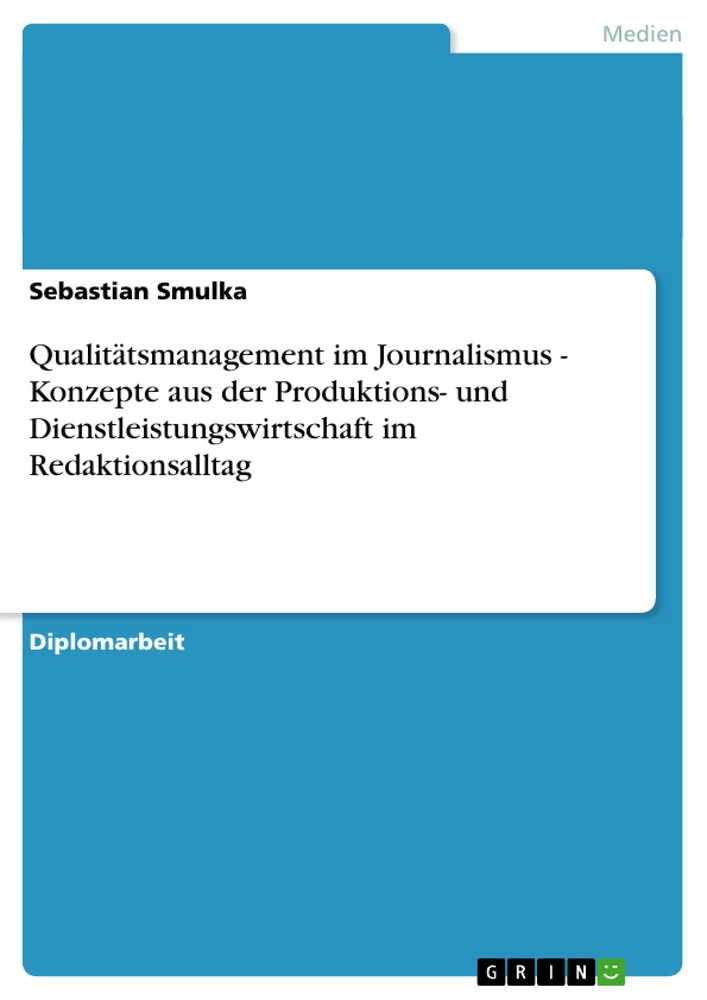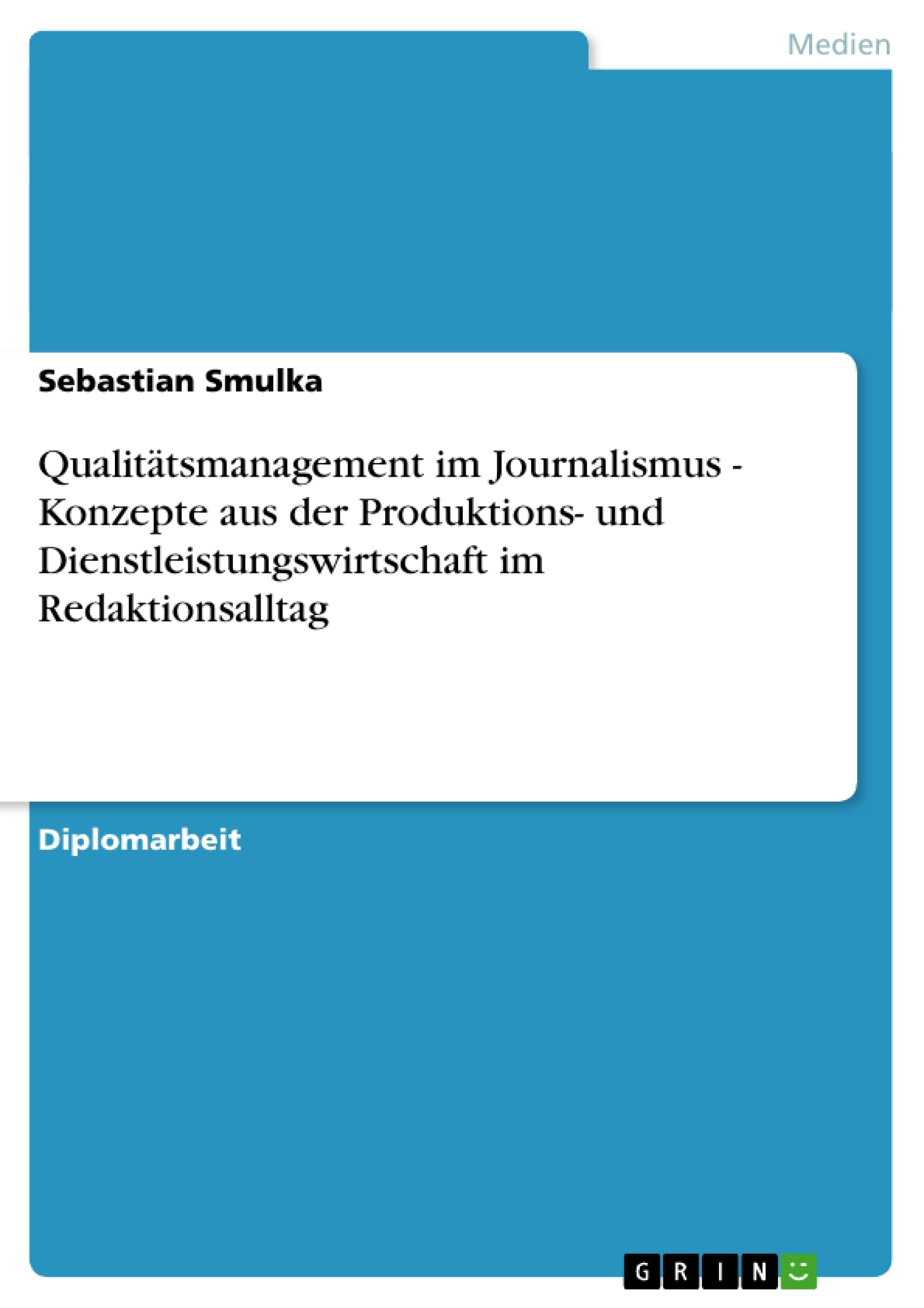Den Versuch, Qualität im Journalismus zu definieren, vergleichen Kritiker mit dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Trotzdem konzentriert sich die Qualitäts-Diskussion in der medienwissenschaftlichen Literatur großteils auf die Suche nach sinnvollen Definitionen. Erst allmählich wird auch die Frage formuliert, wie denn journalistische Qualität - ungeachtet ihrer Definition - in der Praxis gewährleistet werden kann. Verglichen mit der Produktions- und Dienstleistungswirtschaft haben die Medien daher einen enormen Nachholbedarf, geht es um Konzepte für ein systematisches Qualitätsmanagement.
Möglicherweise lässt sich der Vorsprung, den die Betriebswirtschaftslehre in diesem Punkt hat, ausnutzen. Diese Arbeit untersucht daher, ob und wie die Qualitätsmanagement-Systeme aus der Produktions- und Dienstleistungswirtschaft auf den Alltag in einem Medien-Betrieb übertragen werden können. Sie diskutiert, welche Maßnahmen für eine solche Übertragung getroffen werden müssen, welche Konsequenzen sich daraus ableiten und welchen Nutzen diese Übertragung bringen mag.
Dazu gibt sie zunächst den Stand der medien- und den der wirtschaftswissenschaftlichen Qualitätsdiskussion wieder. Danach werden beide Strömungen zusammengeführt: Die oftmals abstrakten Forderungen aus Ansätzen wie etwa dem Total Quality Management werden auf die konkrete Ebene des Redaktionsalltags heruntergebrochen. Dies geschieht schwerpunktmäßig anhand der DIN EN ISO 9001, einer Industrie-Norm für die Einführung von Qualitäts-Management-Systemen.
Dabei zeigt sich, dass die Ansätze aus der "freien Wirtschaft" durchaus im Redaktionsalltag anwendbar sind und bzgl. ihrer Wirksamkeit sehr viel versprechend erscheinen. Es werden beispielsweise die Rahmenbedingungen für ein optimales Arbeiten und somit einer höheren Qualität im Journalismus verbessert. Auch entstehen feste Strukturen, die eine Qualitätssteuerung nicht länger dem Good Will der Redaktionen oder dem Zufall überlassen. Andererseits sind auch Umsetzungsschwierigkeiten möglich - etwa dadurch, dass feste Management-Vorgaben an der aufklärerischen Grundhaltung der Journalisten scheitern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema
- Gang der Arbeit
- Zum Problem journalistischer Qualität
- Allgemeine Näherung zum Begriff der Qualität
- Ansätze zur Definition journalistischer Qualität
- Normative Ansätze
- Funktionale Ansätze
- Maßgaben aus der Praxis
- Qualität und Markterfolg
- Qualität und Rezipienten-Akzeptanz
- Qualität als Einflussgröße im Werbe-Markt
- Zwischenfazit: Unvereinbarkeit funktionaler und normativer Ansätze ist übertrieben
- Probleme der praktischen Umsetzung
- Messbarkeit journalistischer Qualität
- Blattkritik als nachgeordnete Bewertung
- Fehlen praxisbezogener Umsetzungsvorschläge
- Geringer Standardisierungsgrad
- Qualitätskonzepte aus der Wirtschaft
- Übersicht und Entwicklung bestehender Konzepte
- Die Wurzeln der Qualitätssicherungskonzepte: Funktionale Differenzierung und Wunsch nach Erfüllung der Grundbedürfnisse
- Taylorismus als Wiege der QM-Systeme
- Qualitätszirkel - das universelle Problemlösungs-Werkzeug
- Null-Fehler-Strategien
- Integrierte Ansätze: Company Wide Quality Control und die Renaissance der Qualitätszirkel
- Total Quality Management und die TQM-Awards
- Diversifizierung der Management-Lehren
- ISO 9000ff. als handlungsorientierter Normensatz
- Entwicklung zur ISO-9000-Familie
- Aufbau und Gültigkeit der ISO-9000-Familie
- Aufgaben und Ziele der ISO-9000-Familie
- ISO 9000ff. im journalistischen Produktionsmodell
- Struktur journalistischer Produktionsweisen
- Übertragbarkeit der ISO-9001-Forderungen auf den Redaktionsalltag
- Die 20 Elemente der ISO 9001
- Verantwortung der Unternehmensführung
- Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems
- Vertragsprüfung
- Designlenkung
- Lenkung von Dokumenten und Daten
- Beschaffung
- Lenkung der vom Kunden bereit gestellten Unterlagen
- Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten
- Prozesslenkung
- Prüfungen
- Prüfmittelüberwachung
- Prüfstatus
- Lenkung fehlerhafter Produkte
- Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Handhabung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und Versand
- Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen
- Interne Qualitätsaudits
- Schulung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Übertragbarkeit von Qualitätsmanagement-Systemen aus der Produktions- und Dienstleistungswirtschaft auf den Journalismus. Sie analysiert, ob und wie diese Konzepte im Redaktionsalltag implementiert werden können, welche Herausforderungen und Vorteile sich daraus ergeben und welchen Einfluss sie auf die Qualität journalistischer Produkte haben.
- Definition und Messung von journalistischer Qualität
- Analyse von Qualitätsmanagement-Systemen in der Wirtschaft
- Übertragbarkeit von ISO 9001 auf den Journalismus
- Potentiale und Herausforderungen bei der Implementierung von Qualitätsmanagement im Journalismus
- Bewertung der Auswirkungen auf die Qualität journalistischer Produkte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema Qualitätsmanagement im Journalismus ein und skizziert den Gang der Untersuchung.
- Zum Problem journalistischer Qualität: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der journalistischen Qualität und verschiedene Ansätze zu seiner Definition. Es betrachtet die Beziehung zwischen Qualität, Rezipientenakzeptanz und Markterfolg.
- Probleme der praktischen Umsetzung: Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten bei der Messung und Kontrolle journalistischer Qualität, wie etwa die fehlende Standardisierung und die mangelnde Praxisnähe von Umsetzungsvorschlägen.
- Qualitätskonzepte aus der Wirtschaft: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung und Anwendung von Qualitätsmanagement-Systemen in der Wirtschaft, insbesondere die ISO 9000ff. Normfamilie.
- ISO 9000ff. im journalistischen Produktionsmodell: Dieses Kapitel untersucht die Struktur journalistischer Produktionsweisen und die Übertragbarkeit der ISO 9001-Forderungen auf den Redaktionsalltag. Es analysiert die 20 Elemente der ISO 9001 und ihre Relevanz für den Journalismus.
Schlüsselwörter
Qualitätsmanagement, Journalismus, ISO 9001, Medienproduktion, Redaktionsalltag, Qualitätssicherung, Normative Ansätze, Funktionale Ansätze, Rezipientenakzeptanz, Markterfolg, Standardisierung, Übertragbarkeit.
- Quote paper
- Sebastian Smulka (Author), 2002, Qualitätsmanagement im Journalismus - Konzepte aus der Produktions- und Dienstleistungswirtschaft im Redaktionsalltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12209