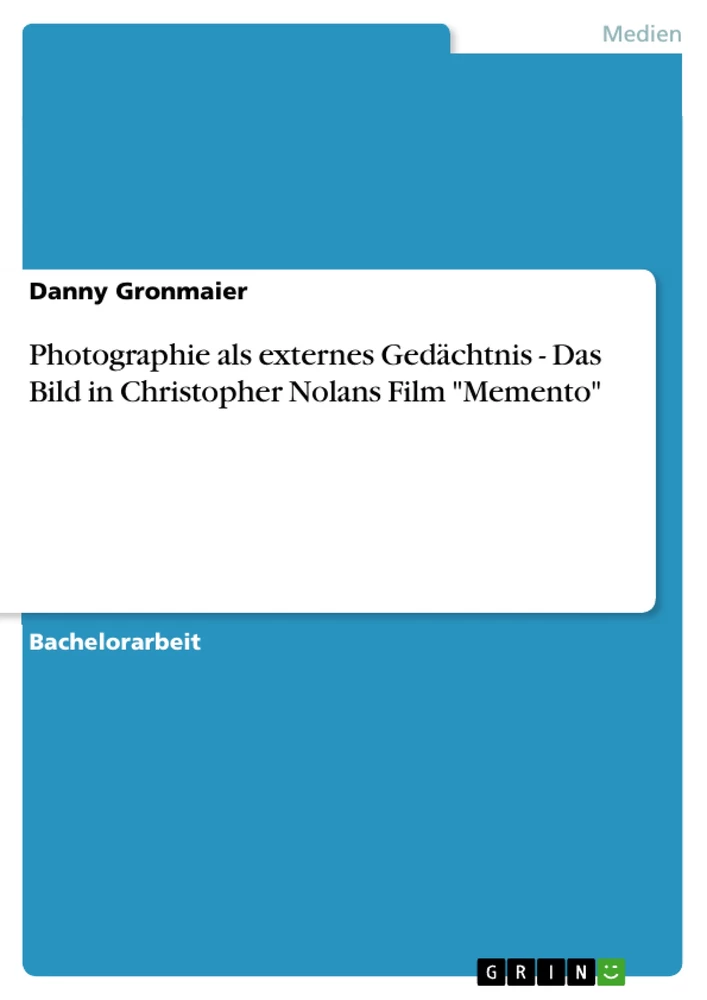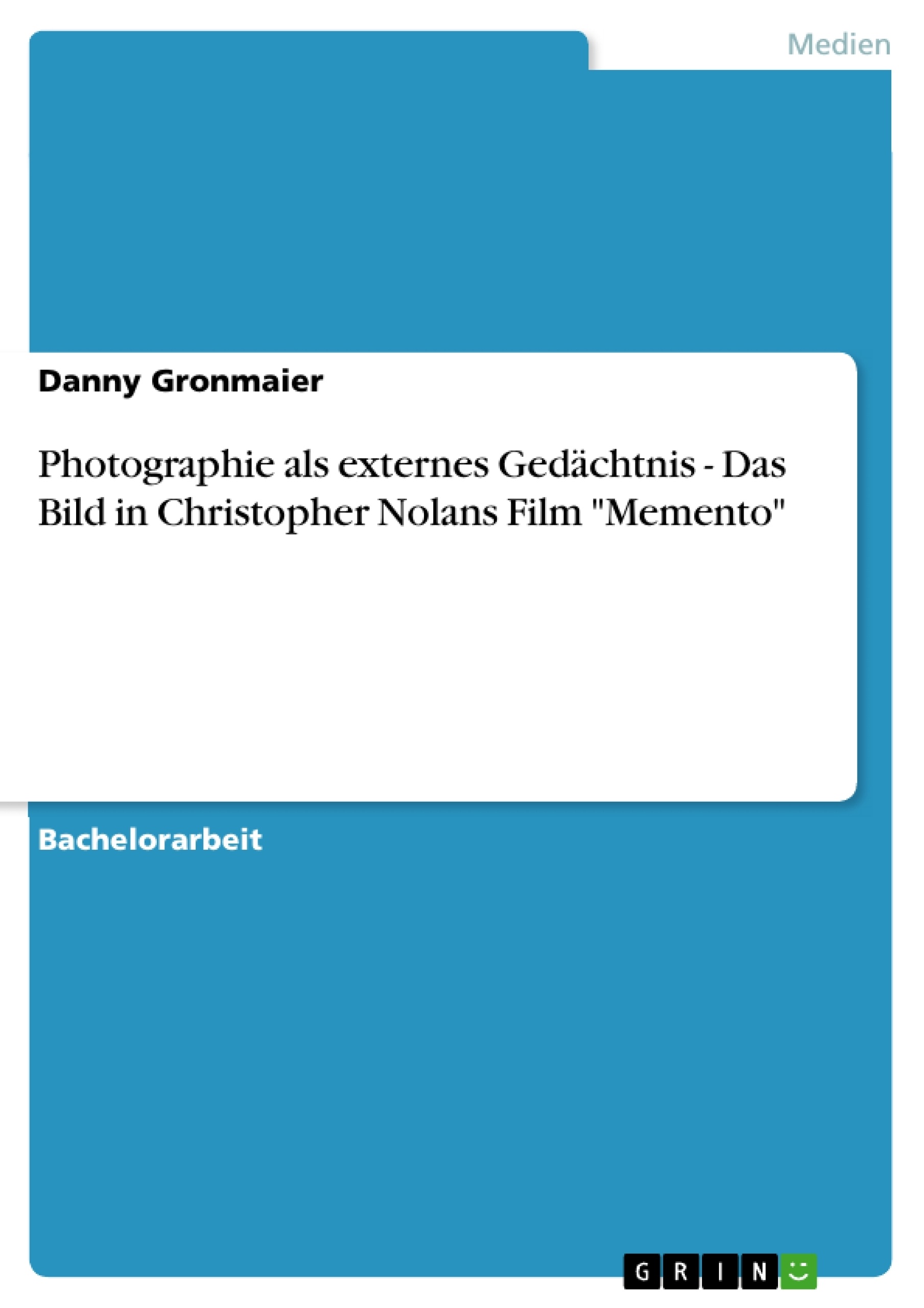„Es gibt keine besseren Andenken als Photographien, keine erfolgreicheren Souvenirs als die selbstgemachten Aufnahmen individueller Erinnerungen an die individuellen Momente je individuellen Lebens.“ Photographie dient wie kein zweites technisches Medium als Konservierungsmaschine von Erlebtem. Als zentral erweist sich dabei immer wieder die Frage nach den Möglichkeiten der Photographie: Was kann ein photographisches Bild überhaupt leisten? Inwieweit kann Photographie Realität abbilden, konstruieren und tatsächlich als Mittel zur Erkenntnis von Welt und so, in einem weiteren Schritt, als ein das biologische Gedächtnis und dessen Erinnerungsvermögen ersetzendes Mittel funktionieren? Was unterscheidet das photographische Bild vom menschlichen Gedächtnisbild? Im Laufe der Theoriegeschichte der Photographie entstanden zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Themenkomplex. Die vorliegende Arbeit möchte in einem ersten Teil vier solcher theoretischer Auseinandersetzungen mit dem Wesen und Vermögen der Photographie vorstellen (G. Santayana, S.Kracauer, R.Barthes, S.Sontag). Alle beschäftigen sich in einem weiteren Sinne mit der Ontologie des photographischen Bildes, dessen Möglichkeiten und im Speziellen mit dem Erinnerungs- und Gedächtnisdiskurs, der damit einhergeht. Mit diesem ausführlichen theoriegeschichtlichen Hintergrundwissen soll sich dann im zweiten Teil dieser Arbeit mit Christopher Nolans Film „Memento“ beschäftigt und die gewonnenen Erkenntnisse angewendet werden. Die Motivik des (nicht)erinnernden Gedächtnisses, gepaart mit der Thematisierung von Photographie als dessen Ersatzprothese, ist zentraler Gegenstand des Films. . Dazu trägt nicht nur die filmische Diegese, sondern auch deren besondere Präsentationsform bei: Der Film „Memento“ arbeitet mit einer äußerst komplexen Erzählweise, in deren Verlauf jegliche Chronologie dekonstruiert wird. Es bedarf daher vorab einer ausführlichen Analyse der narrativen Struktur des Films, um ihn dann im Hinblick auf die Reflexion des Verhältnisses von Photographie und Gedächtnis zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Photographie und Gedächtnis - Ein theoriegeschichtlicher Überblick
- 2.1 Photographie als das menschliche Vermögen bereichernder visueller Speicher (G. Santayana, 1905)
- 2.2 Photographie versus Gedächtnisbild (S. Kracauer, 1927)
- 2.3 Die Unwahrheit über die Wahrheit der Bilder (S. Sontag, 1977)
- 2.4 Das Ich erinnert sich (Barthes, 1980)
- 3. Memento
- 3.1 Eine narrative Analyse
- 3.1.1 Ein Versuch zur Story
- 3.1.2 Die besondere narrative Struktur des Films – Der Plot
- 3.2 Exkurs Intermedialität: Das Bild im Filmbild
- 3.3 Polaroid: Die besondere Ontologie des Sofortbildes
- 3.4 Leonards „condition“
- 3.5 Bilder als Gedächtnisprothese
- 3.6 Eine nicht hilfreiche Hilfe
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Photographie als externes Gedächtnis, insbesondere im Kontext von Christopher Nolans Film "Memento". Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene theoretische Positionen zur Beziehung zwischen Photographie und Gedächtnis zu präsentieren und diese mit der filmischen Darstellung in "Memento" zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen photographischer Abbildungen als Erinnerungsstütze und untersucht die Frage, inwieweit Photographie das menschliche Gedächtnis ersetzen oder ergänzen kann.
- Theoriegeschichte der Photographie und Gedächtnis
- Analyse der narrativen Struktur von "Memento"
- Die Funktion von Bildern als Gedächtnisprothesen im Film
- Vergleich zwischen photographischem Bild und Gedächtnisbild
- Die Rolle der Polaroid-Bilder in "Memento"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Funktion der Photographie als Gedächtnisstütze. Sie verweist auf die allgegenwärtige Nutzung von Fotografien als Erinnerungsanker und erwähnt die rasante Entwicklung der Digitalfotografie. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit vier wichtigen theoretischen Texten an, die die Beziehung zwischen Photographie und Gedächtnis untersuchen, sowie eine Analyse von Christopher Nolans Film "Memento".
2. Photographie und Gedächtnis - Ein theoriegeschichtlicher Überblick: Dieses Kapitel präsentiert vier zentrale theoretische Positionen zur Photographie und ihrem Verhältnis zum Gedächtnis. Es beginnt mit George Santayanas frühen Überlegungen zur Photographie als erweitertem visuellen Speicher und setzt sich dann mit Siegfried Kracauers, Susan Sontags und Roland Barthes' Ansichten auseinander. Das Kapitel vergleicht und kontrastiert die verschiedenen Perspektiven und beleuchtet die Entwicklung des Diskurses um die Ontologie des photographischen Bildes und seine Funktion im Kontext des Erinnerns und Vergessens. Die einzelnen Positionen werden in chronologischer Reihenfolge vorgestellt, um den Wandel der Perspektive über die Zeit zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Photographie, Gedächtnis, Erinnerung, Memento, Christopher Nolan, visueller Speicher, Gedächtnisprothese, Bild, Realität, narrative Struktur, Intermedialität, Polaroid, Theoriegeschichte der Photographie.
Häufig gestellte Fragen zu "Photographie und Gedächtnis in Christopher Nolans Memento"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Photographie als externes Gedächtnis, insbesondere im Kontext von Christopher Nolans Film "Memento". Sie analysiert die Beziehung zwischen Photographie und Gedächtnis anhand verschiedener theoretischer Positionen und deren Anwendung auf die filmische Darstellung in "Memento".
Welche theoretischen Positionen werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert und analysiert die Ansichten von George Santayana (Photographie als erweiterter visueller Speicher), Siegfried Kracauer (Photographie versus Gedächtnisbild), Susan Sontag (Unwahrheit über die Wahrheit der Bilder) und Roland Barthes (Das Ich erinnert sich) zum Verhältnis von Photographie und Gedächtnis. Die Positionen werden chronologisch dargestellt und verglichen.
Wie wird der Film "Memento" in die Arbeit eingebunden?
Der Film "Memento" dient als Fallbeispiel. Die Arbeit analysiert die narrative Struktur des Films, die Funktion von Bildern (insbesondere Polaroid-Bildern) als Gedächtnisprothesen, und den Vergleich zwischen photographischem Bild und Gedächtnisbild im Kontext der Hauptfigur Leonards Amnesie.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Theoriegeschichte der Photographie und Gedächtnis, die Analyse der narrativen Struktur von "Memento", die Funktion von Bildern als Gedächtnisprothesen, der Vergleich zwischen photographischem Bild und Gedächtnisbild, und die Rolle der Polaroid-Bilder in "Memento".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoriegeschichtlichen Überblick über Photographie und Gedächtnis, ein Kapitel zur Analyse von "Memento" (inkl. Unterkapiteln zur narrativen Struktur, Intermedialität, Polaroid-Bildern, Leonards Zustand und Bildern als Gedächtnisprothese), eine Schlussbetrachtung und ein Quellenverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Photographie, Gedächtnis, Erinnerung, Memento, Christopher Nolan, visueller Speicher, Gedächtnisprothese, Bild, Realität, narrative Struktur, Intermedialität, Polaroid, Theoriegeschichte der Photographie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen photographischer Abbildungen als Erinnerungsstütze zu untersuchen und die Frage zu beleuchten, inwieweit Photographie das menschliche Gedächtnis ersetzen oder ergänzen kann.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgt ein Kapitel, welches einen Überblick über die relevanten Theorien gibt. Ein weiterer Abschnitt widmet sich der Analyse des Films "Memento", bevor die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung und einem Literaturverzeichnis abschließt.
- Quote paper
- Danny Gronmaier (Author), 2008, Photographie als externes Gedächtnis - Das Bild in Christopher Nolans Film "Memento", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121868