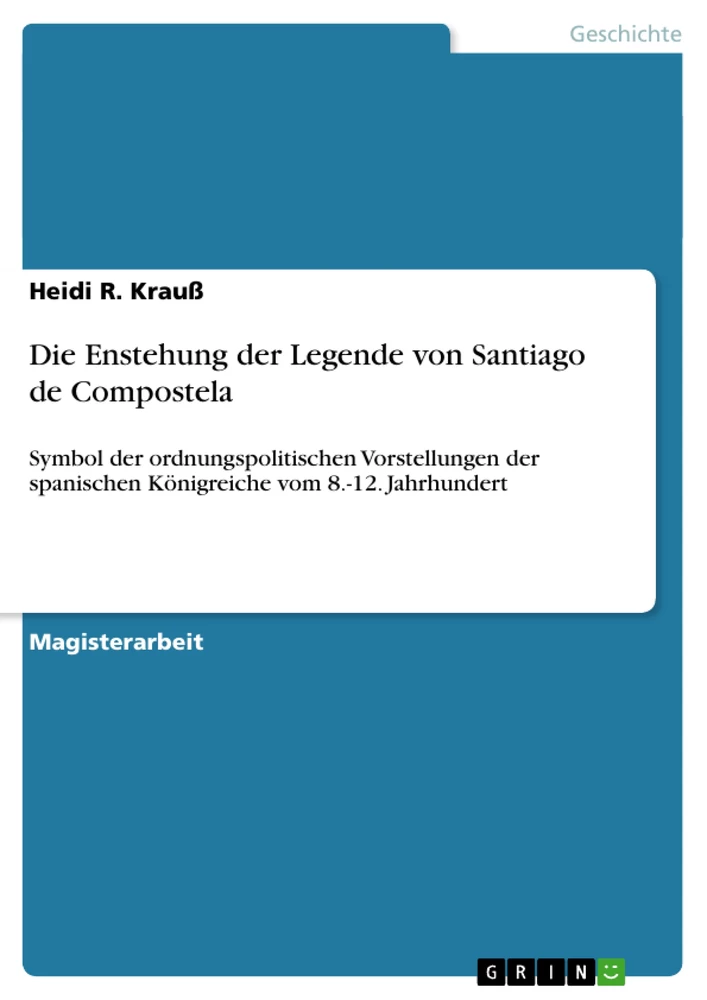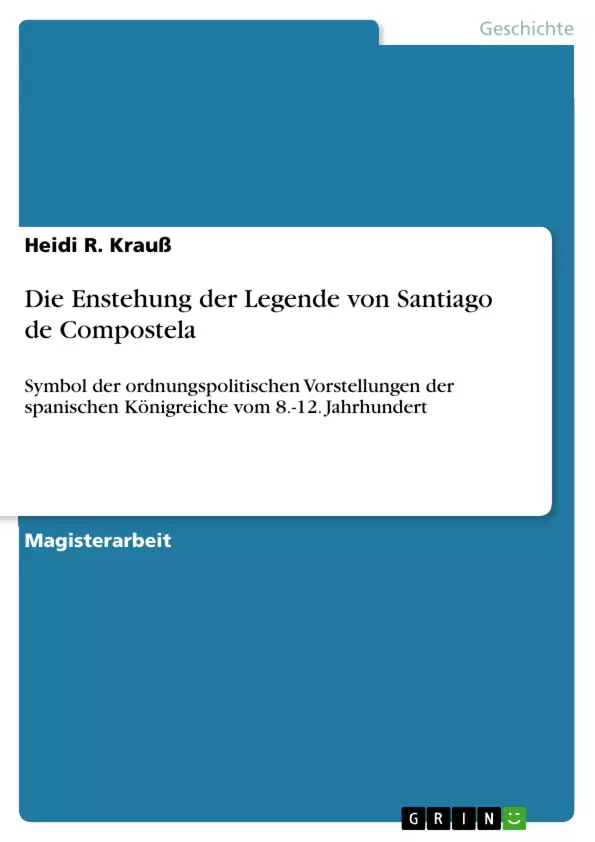Das christliche Spanien vom 8. bis 12. Jahrhundert ist geprägt durch zahlreiche einschneidende Ereignisse. Zum einen durch die externe Bedrohung des Islams und durch den Zerfall des Westgotenreiches, zum anderen durch die internen Begebenheiten in dieser Epoche. Auf national-politischer Ebene versuchten die nördlichen Königreiche Einfluss zu gewinnen. Auf religiöser Ebene versuchte sich Asturien von Toledo unabhängig zu machen.
Das Zentrum des asturischen Königreichs ist in den Picos de Europa anzusiedeln. Unter Pelayo suchten hier Mitglieder der hispano-gotischen Aristokratie Zuflucht vor den eindringenden Muslimen. Diese Zeit wird als die erste Epoche (718-739) des asturischen Königreichs angesehen. Die zweite Epoche (739-757) beginnt mit Alfons I. Er eroberte die Gebiete nördlich der kantabrischen Kordillere und siedelte dort die Mehrheit der christlichen Gemeinden um. Es begann somit eine „Vermischungsphase“ in der die neuen Siedler den Einwohnern dieser Region die hispano-gotischen Lebensweisen weitergaben. Die dritte Phase (791-842) ist geprägt durch die Bildung von ideologischen Konzepten, die den Kampf gegen den muslimischen Eindringling rechtfertigen. Diese Phase liegt in der Regierungszeit Alfons II. Die vierte Phase (850-911) ist geprägt durch die territoriale Ausbreitung des Königreichs unter Ordoño III. und Alfons III., sowie die Verlegung der Hauptstadt nach León und die Entstehung des astur-leónesischen Königreiches.
In diese Zeit der Wirren und Bedrohungen fällt die Entdeckung des Grabes des heiligen Jacobus. Mit der Entdeckung dieses Grabes wurde ein Rahmen geschaffen, um verschieden motivierte Handlungen zu rechtfertigen.
Ein weiterer entscheidender Faktor für die Entstehung der Jacobuslegende, der sich in den Zwistigkeiten zwischen Asturien und Toledo herauskristallisieren sollte, wird vor allem durch zwei Personen verkörpert. Auf asturischer Seite Beatus von Liébana und auf der anderen Seite Elipand von Toledo. Sie bereiteten in Spanien die Anfänge des Adoptianismusstreites vor, welcher in der Folgezeit über die Iberische Halbinsel hinaus weittragendere Folgen hatte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung in das Thema und den Aufbau der Arbeit, Hinweise auf den Forschungsstand
- 2. Zeugnisse des 12. Jahrhunderts
- 2.1. Der Codex Calixtinus - die ausgeformte Jacobuslegende
- 2.1.1. Allgemeine Einführung in das Werk
- 2.1.2. Die Modica passio sancti Iacobi
- 2.1.3. Die Magna Passio
- 2.1.4. Der Translationsbericht im Codex Calixtinus
- 2.1.5. Folgerungen aus dem Codex
- 2.2. Die Historia Compostelana
- 2.2.1. Über das Werk und seinen Inhalt
- 2.2.2. Die Historia Compostelana bis zur Machtübernahme des Diego Gelmírez
- 2.2.3. Die Übernahme des Bischofssitzes durch Diego Gelmírez
- 2.2.4. Die Regierungszeit von Urraca und Alfons VII. - Santiago als Stadt seiner Taufe, Erziehung und Krönung
- 2.1. Der Codex Calixtinus - die ausgeformte Jacobuslegende
- 3. Die frühen Zeugnisse zur Jacobuslegende
- 3.1. Die Bibel als Ausgangspunkt
- 3.2. Das Breviarium Apostolorum
- 3.3. Die Martyrologien
- 3.4. Das De ortu et obitu Patrum
- 3.5. Aldelm von Malmesbury
- 3.6. Beatus von Liébana – Der Apokalypsenkommentar und der Hymnus O dei uerbum. Die Rolle des Beatus als Wegbereiter der Jacobuskultes.
- 4. Die königlichen Urkunden unter besonderer Berücksichtigung von Alfons III., Alfons VII. und Alfons IX.
- 4.1. Der Tumbo A der Kathedrale von Santiago de Compostela
- 4.2. Alfons II. - Die erste königliche Urkunde in Bezug auf Santiago
- 4.3. Die königlichen Urkunden von Alfons III.
- 4.4. Exkurs - Der Brief des Abtes Caesarius an Papst Johannes XIII. als Beispiel für die schon gefestigte Stellung des Compostelaner Bischofssitzes im zehnten Jahrhundert
- 4.5. Alfons VII.
- 4.6. Alfons IX.
- 4.7. Zusammenfassendes zu den königlichen Urkunden des Tumbo A
- 4.8. Exkurs - Die Darstellung der Könige in den Miniaturen des Tumbo A
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entstehung der Legende von Santiago de Compostela im Kontext der ordnungspolitischen Vorstellungen der spanischen Königreiche vom 8. bis 12. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert verschiedene historische Quellen, um die Entwicklung des Jakobuskultes und seine Bedeutung für die politische und religiöse Landschaft dieser Zeit zu beleuchten.
- Die Rolle des Codex Calixtinus und der Historia Compostelana in der Ausformung der Jacobuslegende.
- Der Einfluss frühmittelalterlicher Zeugnisse auf die Entwicklung des Jakobuskultes.
- Die Bedeutung königlicher Urkunden für die Legitimierung und Förderung des Santiago-Kults.
- Das Verhältnis von Politik und Religion in der Entstehung und Verbreitung der Legende.
- Die Bedeutung des Grabes des heiligen Jakobus für die Macht des Bischofssitzes von Santiago de Compostela.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext des christlichen Spaniens vom 8. bis 12. Jahrhundert und skizziert den Forschungsstand. Kapitel 2 analysiert wichtige Zeugnisse des 12. Jahrhunderts, insbesondere den Codex Calixtinus und die Historia Compostelana, um die Ausgestaltung der Jacobuslegende zu untersuchen. Kapitel 3 beleuchtet die frühen Zeugnisse zur Jacobuslegende, untersucht ihre Ursprünge und verfolgt deren Entwicklung. Kapitel 4 konzentriert sich auf königliche Urkunden, vor allem die des Tumbo A, um den Einfluss der Könige auf die Entwicklung und Verbreitung des Kultes zu analysieren.
Schlüsselwörter
Santiago de Compostela, Jacobuslegende, Codex Calixtinus, Historia Compostelana, Königreich Asturien, Reconquista, Adoptianismusstreit, königliche Urkunden, politische Ordnung, religiöse Legitimation, mittelalterliches Spanien.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand die Legende von Santiago de Compostela?
Die Legende entstand im christlichen Spanien zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert, insbesondere nach der Entdeckung des vermeintlichen Grabes des Apostels Jakobus, um den Kampf gegen den Islam und politische Ansprüche zu legitimieren.
Was ist der Codex Calixtinus?
Der Codex Calixtinus ist ein bedeutendes Werk des 12. Jahrhunderts, das die ausgeformte Jacobuslegende, Berichte über Wunder und einen Pilgerführer enthält.
Welche Rolle spielte das asturische Königreich bei der Entstehung des Kultes?
Unter Königen wie Alfons II. wurde der Kult genutzt, um Asturien religiös von Toledo unabhängig zu machen und eine ideologische Basis für die Reconquista zu schaffen.
Was war der Adoptianismusstreit?
Es war ein theologischer Konflikt zwischen Beatus von Liébana (Asturien) und Elipand von Toledo, der die Anfänge des Jacobuskultes in Spanien mitprägte.
Welche Bedeutung haben königliche Urkunden für Santiago?
Urkunden (z. B. im Tumbo A) dienten dazu, dem Bischofssitz von Santiago Privilegien zu verleihen und die religiöse Legitimation der christlichen Herrscher zu festigen.
- Citation du texte
- Magister Artium Heidi R. Krauß (Auteur), 2004, Die Enstehung der Legende von Santiago de Compostela, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120727