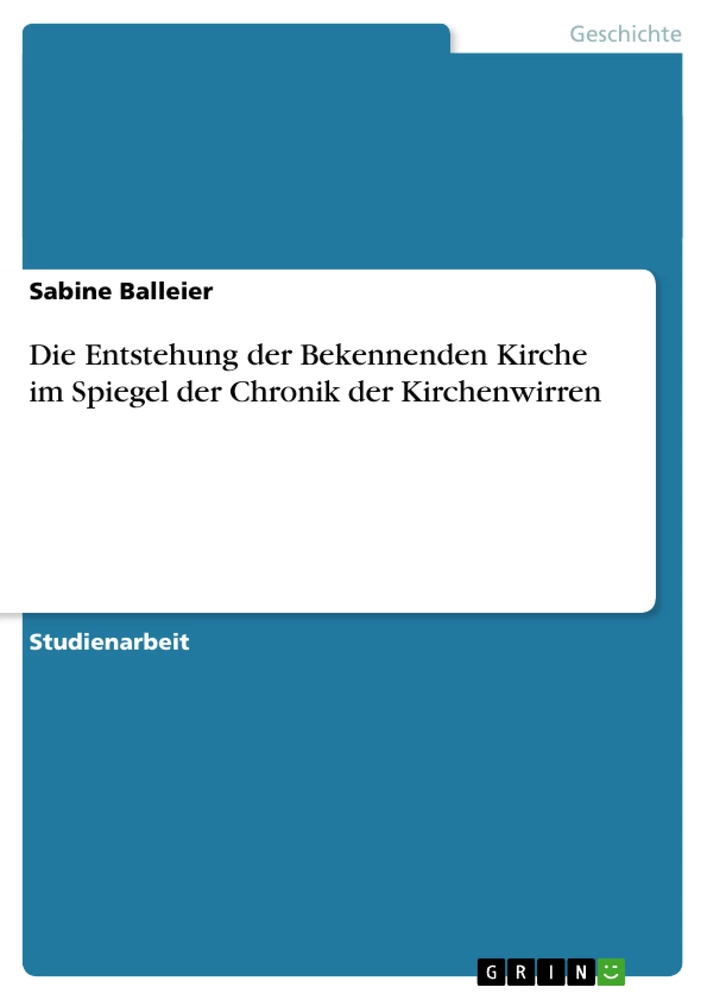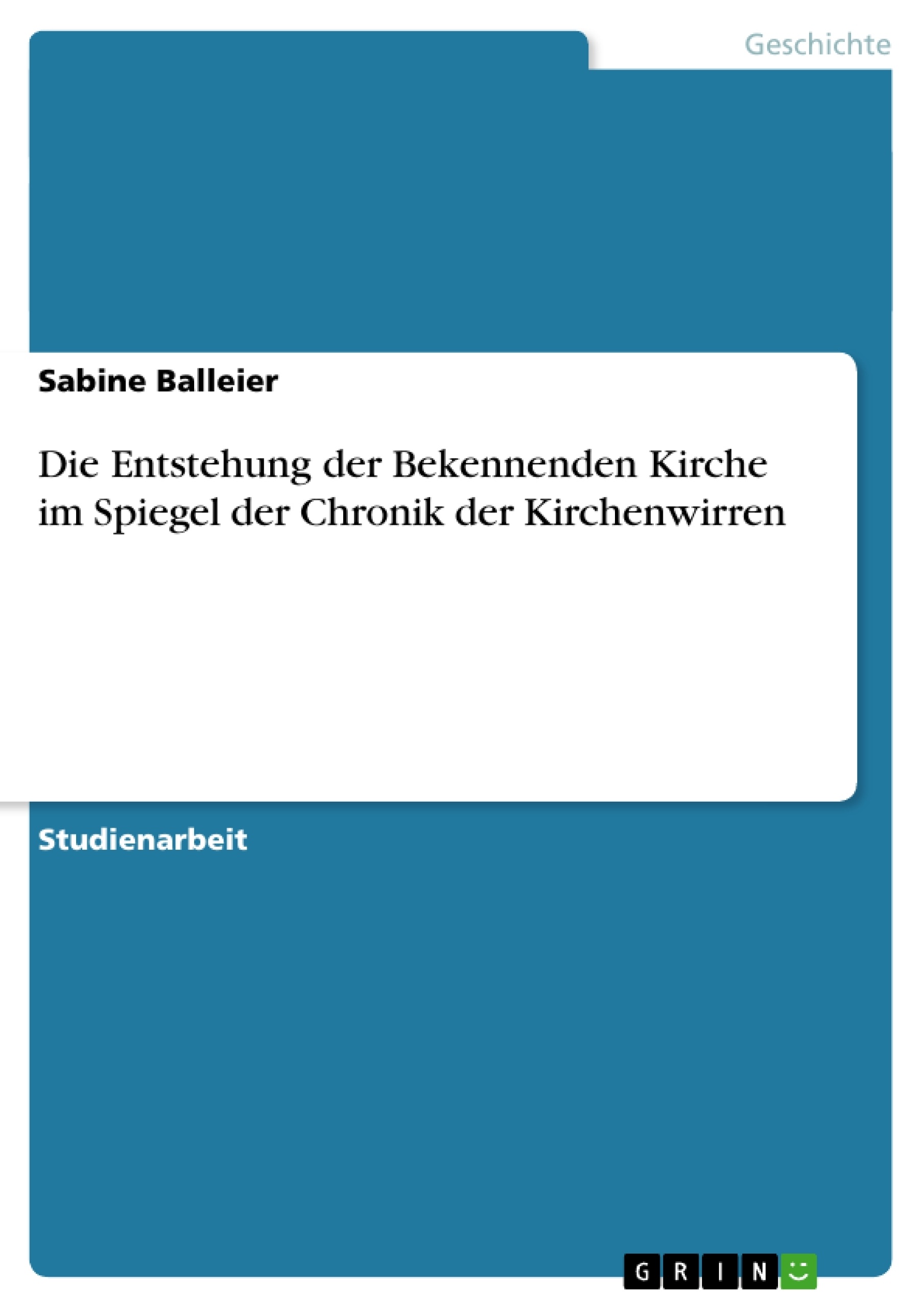„Der totalitäre und zutiefst unmenschliche Grundcharakter des Nationalsozialismus ...
mußte wohl notgedrungen entweder zu einer völligen Integration der Kirche in dieses Herrschaftssystem
oder zur Konfrontation mit den Kräften in den Kirchen, die solche Integration
verweigerten, führen.“1 Was Andreas Lindt in dieser Aussage noch als ein „Entweder-Oder“
darstellt, muss in der evangelischen Kirchengeschichte des Dritten Reiches eigentlich als
„Und“ betrachtet werden. Der Kirchenkampf, der seine Anfänge mit der nationalsozialistischen
Machtergreifung 1933 nahm, spaltete die evangelische Kirche in Deutschland in - zunächst
- zwei Teile, die systemtreuen Deutschen Christen (DC) und die oppositionelle Bekennende
Kirche (BK).
Die vorliegende Arbeit will nun den Entstehungsprozess der Bekennenden Kirche anhand
der „Chronik der Kirchenwirren“2 nachvollziehen. Die Veröffentlichung, auch unter
dem Namen „Gotthard-Briefe“ bekannt geworden, zeichnet in akribischer Dokumentation die
Ereignisse in Staat, Partei, evangelischer Reichskirche, der Glaubensgemeinschaft Deutsche
Christen und der entstehenden Bekenntnisfront nach. Ihr Verfasser, Joseph Gauger, bemüht
sich aus journalistischem Selbstverständnis heraus um weitestgehende Neutralität und kommentarlose
Gegenüberstellung der Geschehnisse.3 [...]
1 Lindt, Andreas: Kirchenkampf und Widerstand als Thema der Kirchlichen Zeitgeschichte. In: Besier, Gerhard/
Ringshausen, Gerhard (Hrsg.): Bekenntnis, Widerstand, Martyrium. Von Barmen 1934 bis Plötzensee 1944.
Göttingen 1986, S. 85.
2 Gauger, Joseph (Hrsg.): Chronik der Kirchenwirren. Erster Teil: Vom Aufkommen der „Deutschen Christen“
1932 bis zur Bekenntnis-Reichssynode im Mai 1934 (Gotthard-Briefe, 138. Brief v. Mai 1934 – 145. Brief v.
Dezember 1934). Wuppertal-Elberfeld 1934. Die Chronik stellt eine Vielzahl verschiedener Quellen zusammen,
bei denen es sich überwiegend um Presseberichte handelt. Im Rahmen dieser Arbeit wäre es nicht möglich gewesen,
diese im Original einzusehen. Daher wird hier darauf verwiesen, dass es sich bei den angegebenen Fundstellen
lediglich um Rezitate handelt. Im Folgenden wird dies nicht mehr für den Einzelfall kenntlich gemacht.
3 Zu Joseph Gauger vgl. sowohl die biographischen Angaben von Karl Halaski in: NDB, Bd. 6. Berlin 1964, S.
97-98, als auch ausführlichere Angaben in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 2, hg. von
Friedrich Wilhelm Bautz. Hamm 1990, S. 186-187.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte: Die Ausgangslage der Evangelischen Kirche vor der nationalsozialistischen Machtergreifung
- 1933 – Nationalsozialistische Machtergreifung und Klärung der Fronten in der Evangelischen Kirche
- Gleiche Ziele, unterschiedliche Ansätze: Abgrenzung von den Deutschen Christen
- Der Kampf um das Reichsbischofsamt und die Macht in der Reichskirche – Entstehungspunkt erster Bekenntnisopposition
- Der Aufbau der Bekenntnisfront während der Machtphase der Deutschen Christen
- Arierparagraph und Pfarrernotbund
- Die Sportpalast-Kundgebung: Brüskierung der Opposition und Niedergang der Deutschen Christen
- 1934 – Der Weg zur Sammlung der Bekenntnisfront
- Vom Maulkorberlass zur Unterwerfung der oppositionellen Kirchenführer
- Der Niederlage zum Trotz: Die Bekenntniskräfte sammeln sich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den Entstehungsprozess der Bekennenden Kirche anhand der „Chronik der Kirchenwirren“ von Joseph Gauger nachzuvollziehen. Die Arbeit analysiert die Ereignisse von 1933 bis zur Ulmer Einung 1934, um die Komplexität des Bildungsprozesses der Bekennenden Kirche aufzuzeigen. Es werden sowohl die Beweggründe für die ideologische Distanzierung von der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) als auch die Zielrichtung des Kirchenkampfes untersucht.
- Die Ausgangslage der Evangelischen Kirche vor 1933
- Die Reaktionen innerhalb der Evangelischen Kirche auf die nationalsozialistische Machtergreifung
- Der Kampf zwischen den Deutschen Christen und der sich formierenden Bekennenden Kirche
- Der Aufbau und die Strategien der Bekenntnisfront
- Der Weg zur Ulmer Einung 1934
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Entstehungsprozess der Bekennenden Kirche und der Auseinandersetzung zwischen ihr und den Deutschen Christen im Dritten Reich. Sie beschreibt die "Chronik der Kirchenwirren" als zentrale Quelle und erläutert den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf die akribische Dokumentation der Ereignisse in der Chronik stützt. Die Einleitung hebt die Komplexität des Prozesses hervor und deutet die Notwendigkeit, sowohl die theologischen als auch die politischen Aspekte des Kirchenkampfes zu berücksichtigen.
Vorgeschichte: Die Ausgangslage der Evangelischen Kirche vor der nationalsozialistischen Machtergreifung: Dieses Kapitel beleuchtet die strukturellen und ideologischen Schwächen der Evangelischen Kirche in der Weimarer Republik. Es beschreibt die Zersplitterung in verschiedene Landeskirchen, die fehlende Einheitlichkeit in der Organisation und die unterschiedlichen konfessionellen Richtungen. Weiterhin wird der nationalistische und antisemitische Einfluss innerhalb der Kirche thematisiert und auf die Verwirrung unter den Theologen hinsichtlich der nationalsozialistischen Ideologie hingewiesen. Die mangelnde Geschlossenheit der Kirche wird als entscheidender Faktor für die spätere Spaltung dargestellt.
1933 – Nationalsozialistische Machtergreifung und Klärung der Fronten in der Evangelischen Kirche: Dieses Kapitel analysiert die unmittelbaren Reaktionen der Evangelischen Kirche auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Es beschreibt die Spaltung in die Deutschen Christen und die sich formierende Bekennende Kirche und beleuchtet den Kampf um die Macht und das Reichsbischofsamt. Das Kapitel analysiert den Aufbau der Bekenntnisfront, den Einfluss des Arierparagraphen und des Pfarrernotbundes, und den Wendepunkt der Sportpalast-Kundgebung, die die Schwäche der Deutschen Christen aufzeigt.
1934 – Der Weg zur Sammlung der Bekenntnisfront: Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse des Jahres 1934, die zur Ulmer Einung führten. Es analysiert den Einfluss des Maulkorberlasses auf die oppositionellen Kirchenführer und gleichzeitig den Prozess der Konsolidierung und Sammlung der Bekenntniskräfte trotz der Unterdrückung. Das Kapitel betont die Bedeutung der Ulmer Einung als ersten Schritt zur Institutionalisierung der Bekennenden Kirche als einheitliche Opposition.
Schlüsselwörter
Bekenntende Kirche, Deutsche Christen, Kirchenkampf, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Joseph Gauger, Chronik der Kirchenwirren, Reichsbischofsamt, Arierparagraph, Pfarrernotbund, Ulmer Einung, theologischer Widerstand, politischer Widerstand, Evangelische Kirche.
Häufig gestellte Fragen zur Chronik der Kirchenwirren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Entstehungsprozess der Bekennenden Kirche im Dritten Reich zwischen 1933 und der Ulmer Einung 1934. Sie analysiert die Ereignisse anhand der „Chronik der Kirchenwirren“ von Joseph Gauger und beleuchtet den Konflikt zwischen den Deutschen Christen und der sich formierenden Bekennenden Kirche.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Hauptquelle dieser Arbeit ist die „Chronik der Kirchenwirren“ von Joseph Gauger. Die Arbeit stützt sich auf die akribische Dokumentation der Ereignisse in dieser Chronik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ausgangslage der Evangelischen Kirche vor 1933, die Reaktionen auf die nationalsozialistische Machtergreifung, den Kampf zwischen Deutschen Christen und Bekennender Kirche, den Aufbau der Bekenntnisfront, den Einfluss des Arierparagraphen und des Pfarrernotbundes, die Bedeutung der Sportpalast-Kundgebung und den Weg zur Ulmer Einung 1934.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, den komplexen Entstehungsprozess der Bekennenden Kirche nachzuvollziehen und die Beweggründe für die ideologische Distanzierung von der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) sowie die Zielrichtung des Kirchenkampfes zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, der Vorgeschichte (Ausgangslage der Evangelischen Kirche vor 1933), den Ereignissen von 1933 (Machtergreifung und Klärung der Fronten), den Ereignissen von 1934 (Weg zur Sammlung der Bekenntnisfront) und ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bekennende Kirche, Deutsche Christen, Kirchenkampf, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Joseph Gauger, Chronik der Kirchenwirren, Reichsbischofsamt, Arierparagraph, Pfarrernotbund, Ulmer Einung, theologischer Widerstand, politischer Widerstand, Evangelische Kirche.
Wie wird der methodische Ansatz beschrieben?
Der methodische Ansatz basiert auf der detaillierten Analyse der Ereignisse, wie sie in der „Chronik der Kirchenwirren“ von Joseph Gauger dokumentiert sind. Es werden sowohl theologische als auch politische Aspekte des Kirchenkampfes berücksichtigt.
Was ist die Bedeutung der Ulmer Einung?
Die Ulmer Einung 1934 wird als erster Schritt zur Institutionalisierung der Bekennenden Kirche als einheitliche Opposition gegen die Deutsche Evangelische Kirche unter nationalsozialistischer Herrschaft dargestellt.
Welche Rolle spielte der Arierparagraph und der Pfarrernotbund?
Der Arierparagraph und der Pfarrernotbund spielten eine entscheidende Rolle im Kampf zwischen den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche. Sie zeigen die Unterdrückung und Verfolgung der Gegner des NS-Regimes innerhalb der Kirche.
Was war die Bedeutung der Sportpalast-Kundgebung?
Die Sportpalast-Kundgebung markierte einen Wendepunkt, indem sie die Schwäche der Deutschen Christen aufzeigte und den Niedergang ihrer Machtposition verdeutlichte.
- Quote paper
- Sabine Balleier (Author), 2003, Die Entstehung der Bekennenden Kirche im Spiegel der Chronik der Kirchenwirren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12024