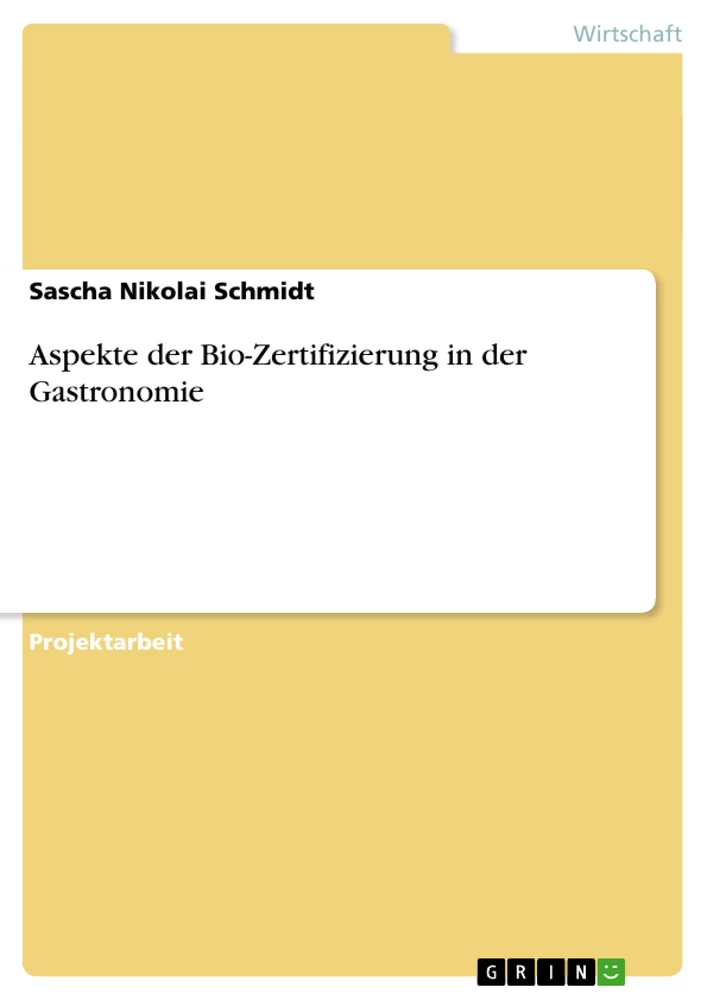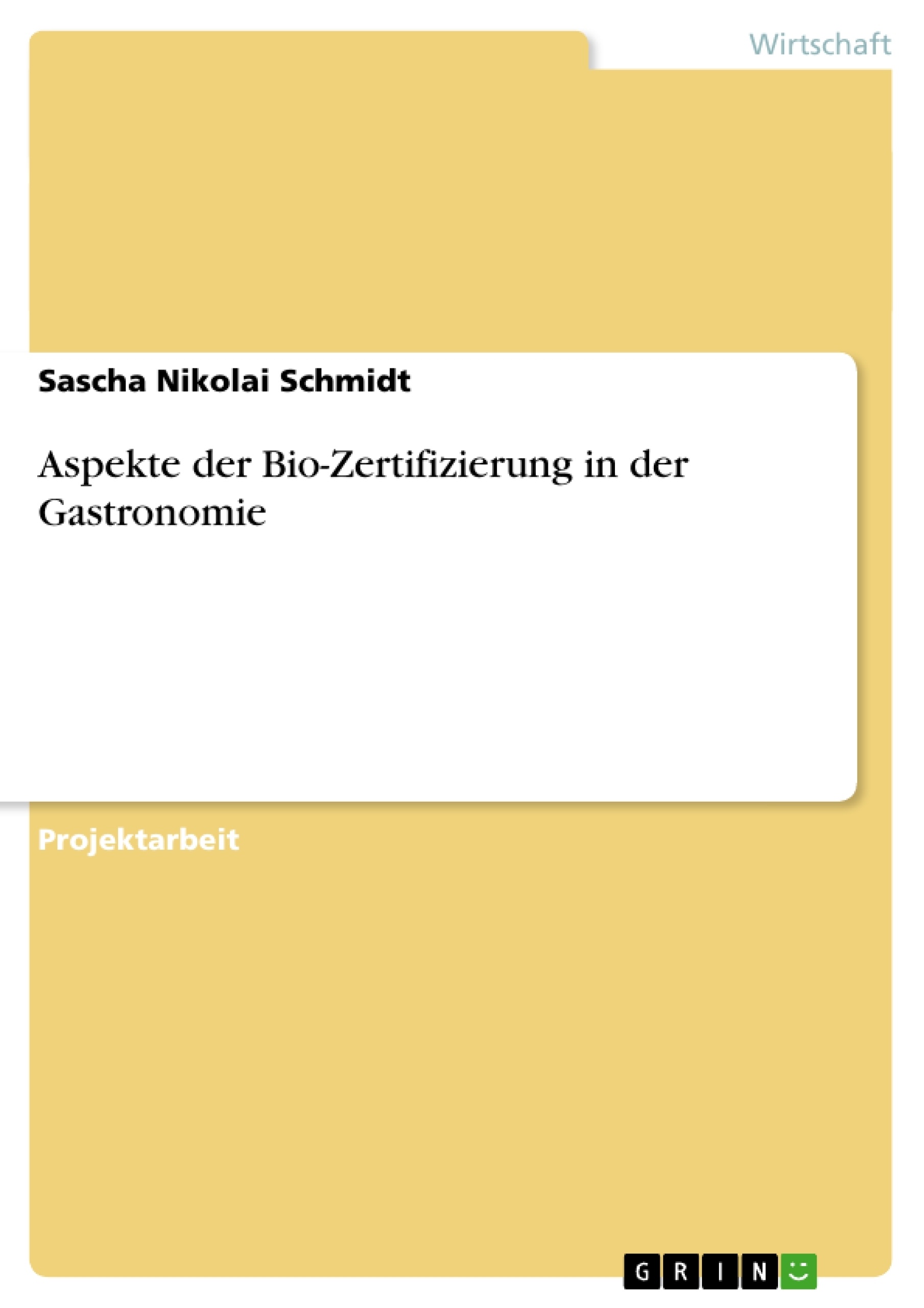Die Arbeit untersucht gesellschaftliche Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen des BIO-Bereichs, widmet sich potentiellen Käuferschichten bzw. Kaufhemmnissen und erklärt dezidiert den technischen Ablauf einer BIO-Zertifizierung („Künast-Siegel“) „entlang der Verwertungskette“ am Beispiel eines Verarbeiters, nämlich eines Restaurants. Einige Überlegungen zu den unvermeidlichen Mehrkosten runden die Arbeit ab:
Bio hat sein Palästinensertuch und die Birkenstock-Sandalen abgelegt und ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen
Der Umsatz mit ökologischen Lebensmitteln in Deutschland ist allein in den Jahren 2000 bis 2006 um 125% gestiegen und lag zuletzt bei 4,5 Mrd, Euro:
Dies zeigt, dass Bio-Produkte in den letzten Jahren starken Anklang finden und sich einer kontinuierlich wachsenden Nachfrage erfreuen können. Es dürfte sich um mehr als einen temporären Trend handeln, sondern um eine neue konstante Option bei Kaufentscheidungen wesentlicher Teile der Bevölkerung (Deutschlands).
Entsprechend ist auch der flächenmäßige Anteil ökologischen Landbaus (nicht nur) in Deutschland im steten Wachstum, was die Wahrscheinlichkeit, ökologische Produkte „aus der Region“ erwerben zu können, entsprechend erhöht. Dieser Aspekt ist gerade für die Vermarktung ökologischer Produkte in der Gastronomie nicht unerheblich, worauf noch einzugehen sein wird.
Der Bio-Boom erklärt sich nicht zuletzt aus Skandalen im Bereich der sog. konventionellen Landwirtschaft , so z.B. die Schweinepest (1991), Salmonellen in Eiern (1993), BSE (2000) und Maul-und Klauenseuche (2001) bei Rindern .Jedoch ist die Wirkung von Skandalen auf das Kaufverhalten langfristig nicht überzubewerten, Schlussendlich verlieren mediale Skandalmeldungen sukzessive an Nachrichtenwert, die Medienpräsenz lässt nach, eine andere Sau wird durch´s mediale Dorf getrieben, die öffentliche Besorgnis sinkt bzw. wird umgelenkt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Häufige Begriffe im BIO-Segment
- Überblick über gängige BIO-Kennzeichen
- Das staatliche BIO-Siegel
- Sonstige BIO-Siegel
- Objekte der Zertifizierung entlang der Verwertungskette
- Rechtliche Grundlagen
- Erzeuger/Produzenten
- Handel
- Verarbeiter
- Verarbeiter im Allgemeinen
- Besonderheiten der Gastronomie als Verarbeiter
- Hintergrund und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- Aktueller BIO-Trend
- Zweck der staatlichen Zertifizierung
- Verbraucherschutz
- Schutz der Wettbewerber
- Transparenz
- „Neue“ Zielgruppen im BIO-Lebensmittelbereich
- Technischer Ablauf einer BIO-Zertifizierung mit dem staatlichen BIO-Siegel
- Informationsbeschaffung
- Kontrollstelle auswählen
- Erstkontrolle
- Betriebsbeschreibung
- Kennzeichnungsvarianten in der Gastronomie / Auslobung der BIO-Produkte
- Getrennte Lagerhaltung und Waren(fluss)kontrolle
- Jährliche Überprüfungskontrolle
- Betriebswirtschaftliche Würdigung
- Höhere Kosten für potentielle Käufer
- Mehrkostenvermeidungsstrategien
- Kostenüberwälzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die BIO-Zertifizierung im gastronomischen Betrieb, insbesondere die spezifischen Anforderungen und den Ablauf der Zertifizierung für Restaurantküchen. Sie grenzt das Objekt der Zertifizierung im gastronomischen Bereich von anderen zertifizierten Betrieben ab und beleuchtet betriebswirtschaftliche Aspekte einer BIO-Umstellung.
- Der Ablauf der BIO-Zertifizierung für gastronomische Betriebe
- Die spezifischen Herausforderungen der BIO-Zertifizierung in der Gastronomie
- Rechtliche Grundlagen und Kennzeichnung von BIO-Produkten in der Gastronomie
- Verbraucherwahrnehmung und -verhalten im Bezug auf BIO-Produkte
- Betriebswirtschaftliche Folgen der BIO-Umstellung in der Gastronomie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den steigenden Umsatz von Bio-Lebensmitteln und die Bedeutung der BIO-Zertifizierung im Gastronomiebereich. Das Hauptziel der Arbeit wird definiert.
Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet häufige Begriffe im Bio-Segment, klärt mögliche Verwirrungen beim Verbraucher und gibt einen Überblick über gängige Bio-Kennzeichen, einschließlich des staatlichen BIO-Siegels und anderer Siegel. Es werden die rechtlichen Grundlagen und die Objekte der Zertifizierung entlang der Wertschöpfungskette (Erzeuger, Handel, Verarbeiter) beschrieben.
Hintergrund und gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel betrachtet den aktuellen Bio-Trend, den Zweck der staatlichen Zertifizierung (Verbraucherschutz, Wettbewerbsschutz, Transparenz) und neue Zielgruppen im Bio-Lebensmittelbereich.
Technischer Ablauf einer BIO-Zertifizierung: Detaillierte Beschreibung des technischen Ablaufs einer BIO-Zertifizierung mit dem staatlichen BIO-Siegel, von der Informationsbeschaffung über die Auswahl der Kontrollstelle bis hin zur Erst- und jährlichen Überprüfungskontrolle. Spezifische Aspekte für die Gastronomie, wie Kennzeichnung und Lagerhaltung, werden behandelt.
Betriebswirtschaftliche Würdigung: Dieses Kapitel beleuchtet die höheren Kosten für potentielle Käufer von Bio-Produkten und mögliche Strategien zur Mehrkostenvermeidung und Kostenüberwälzung.
Schlüsselwörter
BIO-Zertifizierung, Gastronomie, Ökologische Lebensmittel, staatliches BIO-Siegel, Kennzeichnung, Verbraucherschutz, Betriebswirtschaft, Kosten, Mehrkostenvermeidung, Kontrollstelle, Rechtliche Grundlagen.
- Quote paper
- Sascha Nikolai Schmidt (Author), 2007, Aspekte der Bio-Zertifizierung in der Gastronomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119568