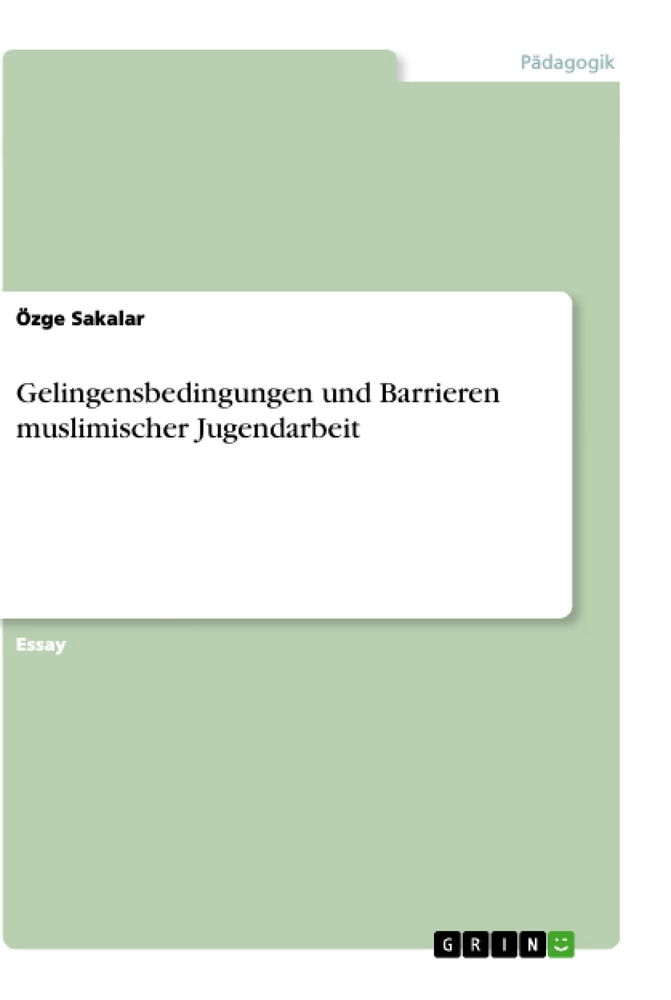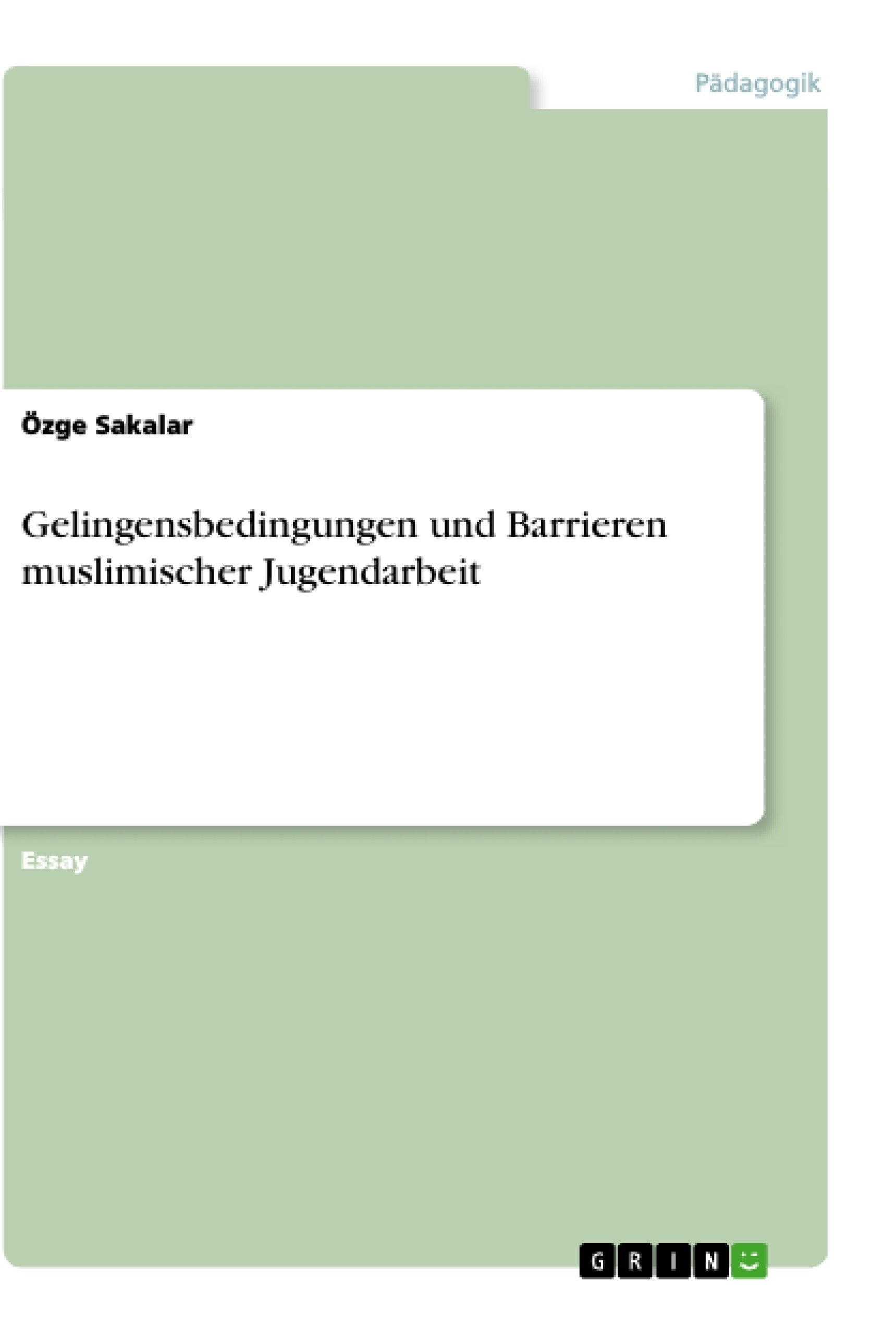Die vorliegende Arbeit behandelt Organisationsformen muslimischer Jugendlicher im Rahmen der Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Die Konzentration auf dieses Bundesland liegt darin begründet, dass 33,1 % der in Deutschland lebenden MuslimInnen in NRW wohnhaft seien (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW. Von den insgesamt ca. 4 Mio. MuslimInnen in Deutschland seien zudem 25 % höchstens 15 Jahre alt. Diese Ausgangslage verdeutlicht die Relevanz einer religiös orientierten JA. Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen sowie wissenschaftlichen Interesses an einer muslimischen JA wird folgende Gliederung ausgearbeitet: Um eine Grundlage zu schaffen, erfolgt ein Abriss über die JA und ihre rechtlichen Grundlagen. Daraufhin erfolgt eine Annäherung an den Begriff der muslimischen JA unter Berücksichtigung des Islam als eine der größten Weltreligionen. Auf dieser Basis wird die Muslimische Jugend in Deutschland e.V. (MJD) als Jugendverband angeführt und mithin ein Beispiel für eine muslimische JA illustriert. Als weiterer Gesichtspunkt dient die Deutsche Islam Konferenz. An diese Grundlagen anknüpfend, werden zuletzt schwerpunktmäßig mögliche Gelingensbedingungen und Barrieren muslimischer JA reflektiert und mithin die Fragestellung dieser Arbeit aufgegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- Jugendarbeit
- Die JA gilt neben den erzieherischen Hilfen, den Kindertageseinrichtungen und den Sozialen Diensten als weitere Säule der sozialpädagogischen Praxislandschaft
- Basierend auf § 11 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB), ist die JA ein Aspekt des ersten Abschnitts „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“
- Aus § 11 Absatz 1 Satz 2 gehen bedeutsame Begrifflichkeiten wie die „Anknüpfung an Interessen junger Menschen, Mitgestaltung und Mitbestimmung, Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement\"
- Absatz 2 Satz 1 dieser Rechtsnorm thematisiert die Anbieter der JA.
- Der zweite Satz dieses Absatzes beschreibt verschiedene Formen von JA: „bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote“
- Der vierte Absatz der Rechtsnorm gibt kund, dass auch Personen, die laut Gesetz keine jungen Menschen (gem. § 7 SGB VIII) mehr sind, auch Angebote der JA in Anspruch nehmen können.
- Insgesamt gilt § 11 SGB VIII insofern als unvollständig, als dass darin keine Rechtsfolge definiert sei.
- NRW nutzt jenen Spielraum insofern, als dass es im Jahr 2004 das Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG) als entsprechendes Landesrecht verabschiedete
- § 12 KJFG widmet sich der Beschreibung der Offenen JA
- „Muslimische“ JA
- Stüwe (2004) merkt eine Schwierigkeit in Bezug auf die Offene JA an, wenn er schreibt:
- Mit einer Offenen JA wird indes nicht die spezifische Ausrichtung auf die Zielgruppe der muslimischen Jugendlichen, die sogenannte muslimische JA, thematisiert.
- Ferner kann insofern nicht die Rede von der muslimischen JA sein, als dass es im Islam mehrere Glaubensrichtungen und Rechtsschulen, Gruppen und Strömungen gibt, die sich dennoch nicht als „verschiedene ,Konfessionen'“ (Löhde o.J.: 1) beschreiben würden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Organisationsformen muslimischer Jugendlicher im Rahmen der Jugendarbeit (JA) in Nordrhein-Westfalen (NRW). Der Fokus liegt auf der Bedeutung und dem Stellenwert muslimischer Jugendverbände innerhalb der JA und der damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.
- Die rechtlichen Grundlagen und Definitionen von JA in Deutschland
- Die Entwicklung und Bedeutung muslimischer Jugendverbände in Deutschland
- Die Rolle des Islam als Religion und die daraus resultierenden Besonderheiten der muslimischen JA
- Die Herausforderungen und Chancen muslimischer JA in Bezug auf Integration und gesellschaftliche Teilhabe
- Die Bedeutung von Dialog und Interaktion zwischen muslimischen Jugendverbänden und staatlichen Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die rechtlichen Grundlagen und Definitionen der Jugendarbeit (JA) in Deutschland dar, wobei insbesondere die Rolle des SGB VIII und des KJFG beleuchtet wird. Im zweiten Kapitel wird eine Annäherung an den Begriff der muslimischen JA unter Berücksichtigung des Islam als eine der größten Weltreligionen vorgenommen. Anschließend werden die Muslimische Jugend in Deutschland e. V. (MJD) als Jugendverband und die Deutsche Islam Konferenz (DIK) als Beispiel für eine muslimische JA auf politischer Ebene präsentiert.
Schlüsselwörter
Jugendarbeit, Muslimische Jugend, Islam, Jugendverband, Integration, Deutsche Islam Konferenz, Jugendförderung, Religionsfreiheit, Interkulturelle Kompetenz, Gesellschaftliche Teilhabe
- Citar trabajo
- Özge Sakalar (Autor), 2018, Gelingensbedingungen und Barrieren muslimischer Jugendarbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194625