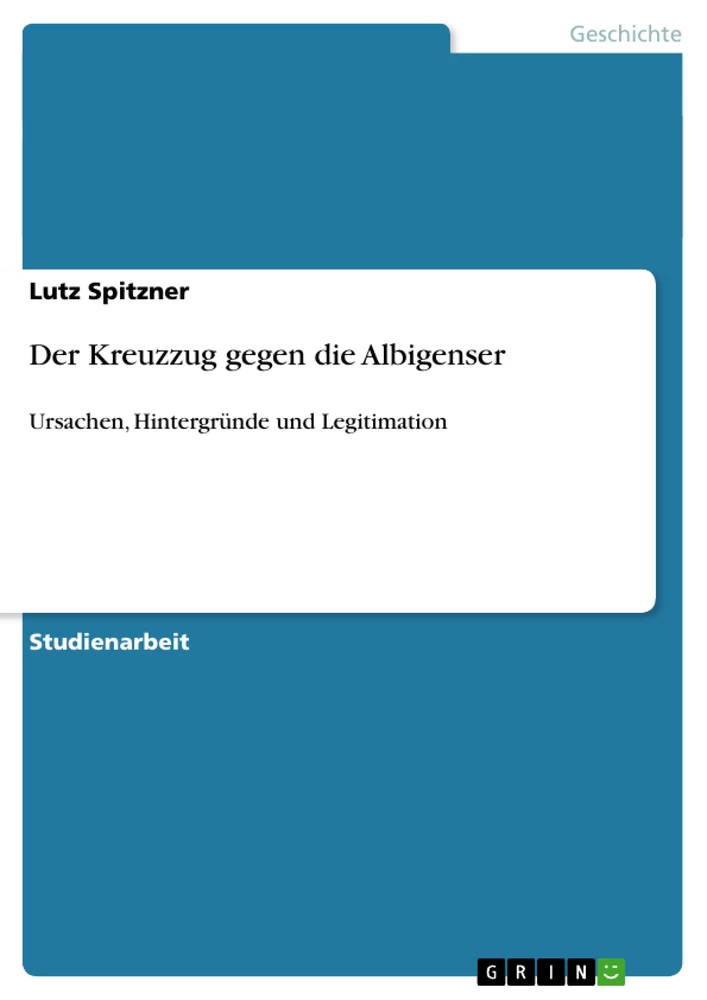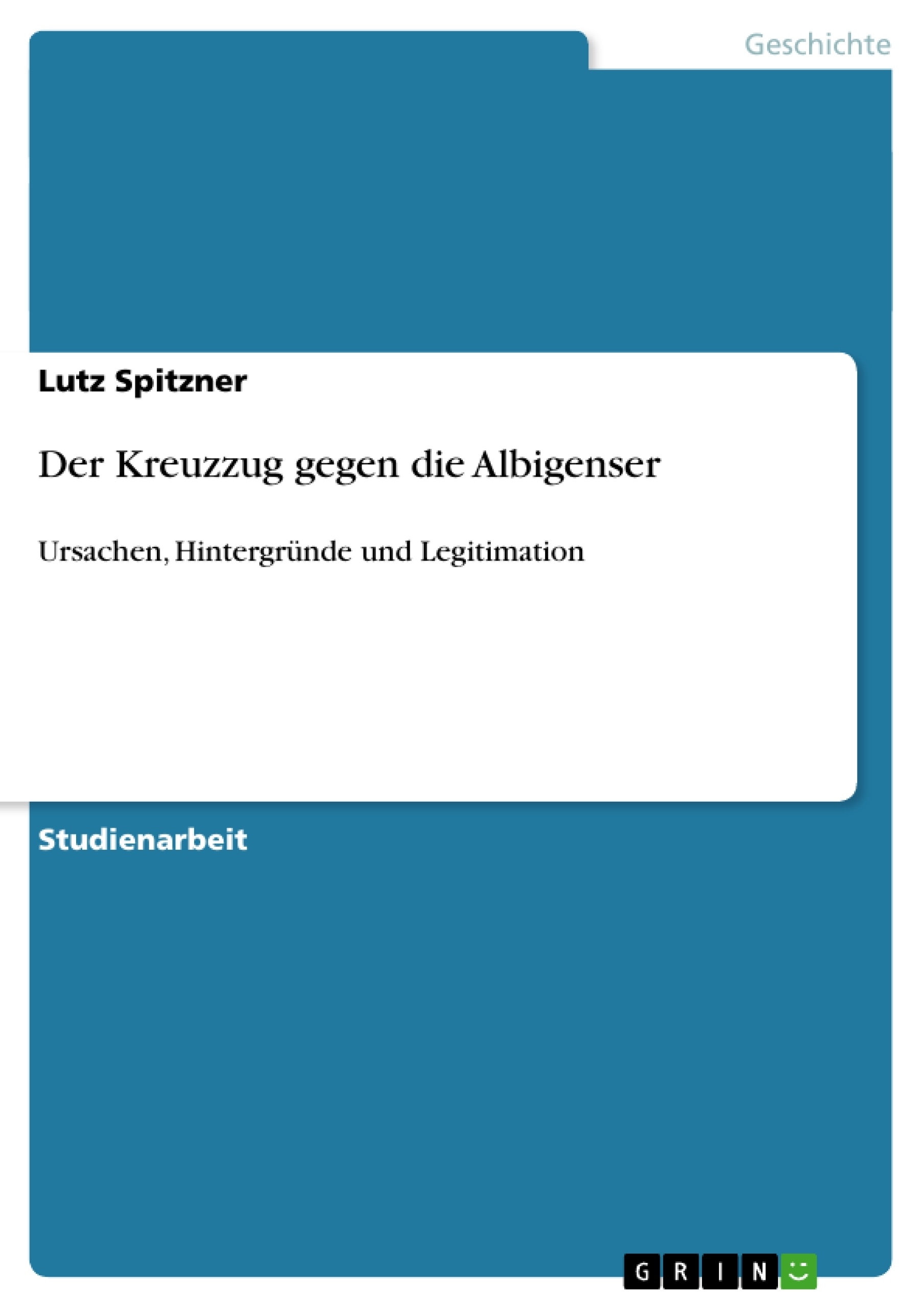Der nachfolgenden Arbeit liegt das Thema der Ketzerei im Mittelalter und deren Verfolgung zu Grunde. Dazu soll zu Beginn kurz umrissen werden, inwiefern sich der Begriff der Ketzerei überhaupt definieren lässt, beziehungsweise wie er im zeitgenössischen Kontext definiert wurde. Im Fokus der Arbeit steht die – während des 12. Jahrhunderts im Languedoc, auch als Okzitanien bezeichnet, weit verbreitete und letztlich kriegerisch niedergeschlagene – Bewegung der Albigenser, welche wiederum zu den Katharern, als der größten Häresiebewegung im Mittelalter gehörte. […] Der Schwerpunkt der hier vorliegenden Arbeit soll darin liegen, aufzuzeigen, wie es möglich war, dass sich in Südfrankreich eine alternative Glaubensgemeinschaft entwickeln konnte. Dabei wird zu erläutern sein, dass die Menschen nicht vom Glauben abgefallen waren, sondern ernstzunehmende und aus heutiger Sicht wohl auch zumindest nachvollziehbare Gründe hatten, sich von der katholischen Kirche ab – und der katharischen Kirche zuzuwenden. Es war eben nicht, wie noch in Abschnitt 2.1 zu behandeln
sein wird, ein Mangel an Frömmigkeit, sondern vielmehr die Hoffnung auf die
Erlösung, welche viele Menschen zu diesem Schritt veranlasste. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Themas ist schließlich die Verfolgung der Albigenser.
Dazu sind die die Gründe für das Vorgehen gegen sie näher zu beleuchten und auch die Argumentationsweise der katholischen Kirche zu betrachten. Insbesondere der Gedanke der Strafbarkeit von Häresie sowie deren Unterstützung und Duldung sollen hierbei ins Licht gerückt und analysiert werden. Dabei wird auch auf die Ursprünge dieser Beweisführung und ihre frühchristlichen Wurzeln eingegangen, um letztlich nachvollziehen zu können, was die katholische Kirche dazu veranlasste, einen blutigen Krieg zwischen Christen auszurufen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Verbreitung
- Verbreitung im Volk
- Entwicklung der katharischen Lehre
- Die Rolle des Adels
- Verbreitung im Volk
- Der Weg zum Krieg
- Entstehung des Konfliktes
- Reaktionen der katholischen Kirche
- Der Krieg gegen die Albigenser
- Grundlagen der Verfolgung
- Willensfreiheit als Rechtfertigung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verfolgung der Katharer im Mittelalter, insbesondere den Albigenserkreuzzug. Sie beleuchtet die Entstehung und Verbreitung der katharischen Lehre im Languedoc, die Gründe für den Konflikt mit der katholischen Kirche und die Rechtfertigung des Vorgehens der Kirche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Gründe, warum sich die Bevölkerung der Katharer zuwandte und wie die katholische Kirche ihre Verfolgung legitimierte.
- Entstehung und Ausbreitung der katharischen Lehre im Languedoc
- Gründe für den Konflikt zwischen Katharern und katholischer Kirche
- Rechtfertigung des Kreuzzuges gegen die Albigenser durch die katholische Kirche
- Sozio-religiöse Ursachen der Katharerbewegung
- Die Rolle des Adels im Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung definiert den Begriff der Ketzerei im mittelalterlichen Kontext und stellt die Albigenser als größte häretische Bewegung im Mittelalter vor. Kapitel Entstehung und Verbreitung untersucht die Ausbreitung der katharischen Lehre unter der Bevölkerung und den Adel. Es wird beleuchtet, wie trotz des Alleinanspruchs des Christentums eine alternative Glaubensgemeinschaft entstehen konnte. Der Weg zum Krieg beschreibt die Entstehung des Konflikts zwischen Katharern und der katholischen Kirche und die Reaktionen der Kirche auf die Verbreitung der häretischen Lehre. Die Grundlagen der Verfolgung und die Rechtfertigung der Gewalt durch die katholische Kirche mittels des Konzepts der Willensfreiheit werden in Kapitel Der Krieg gegen die Albigenser angesprochen.
Schlüsselwörter
Albigenser, Katharer, Ketzerei, Mittelalter, Languedoc, Katholische Kirche, Kreuzzug, Häresie, religiöser Dualismus, Verfolgung, Willensfreiheit, Ungehorsam, Erlösung.
- Quote paper
- Lutz Spitzner (Author), 2007, Der Kreuzzug gegen die Albigenser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119429