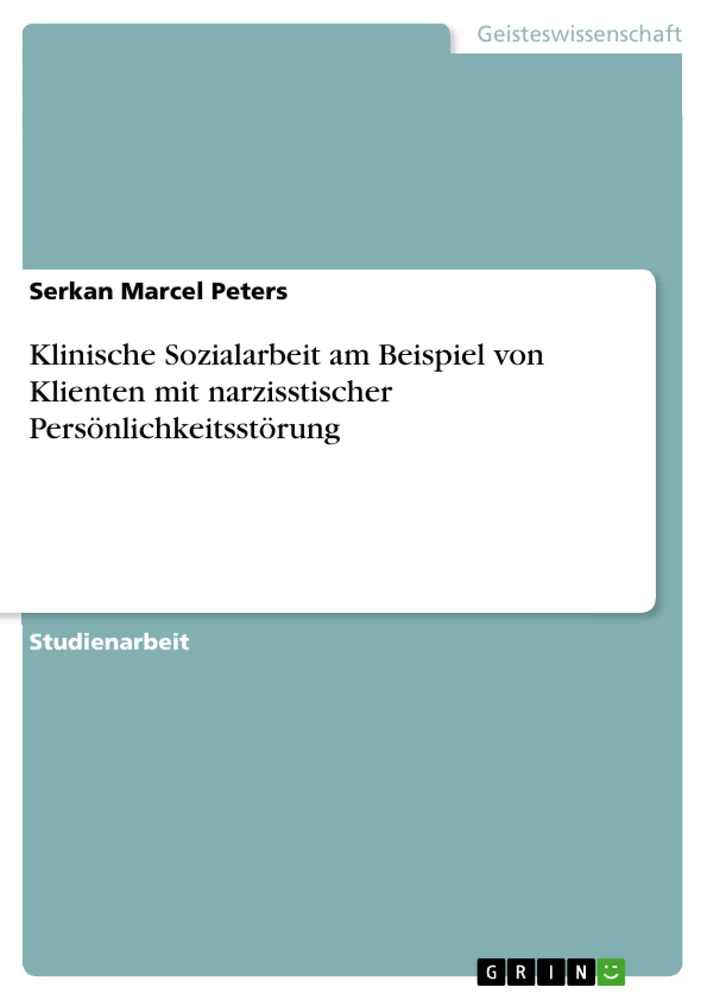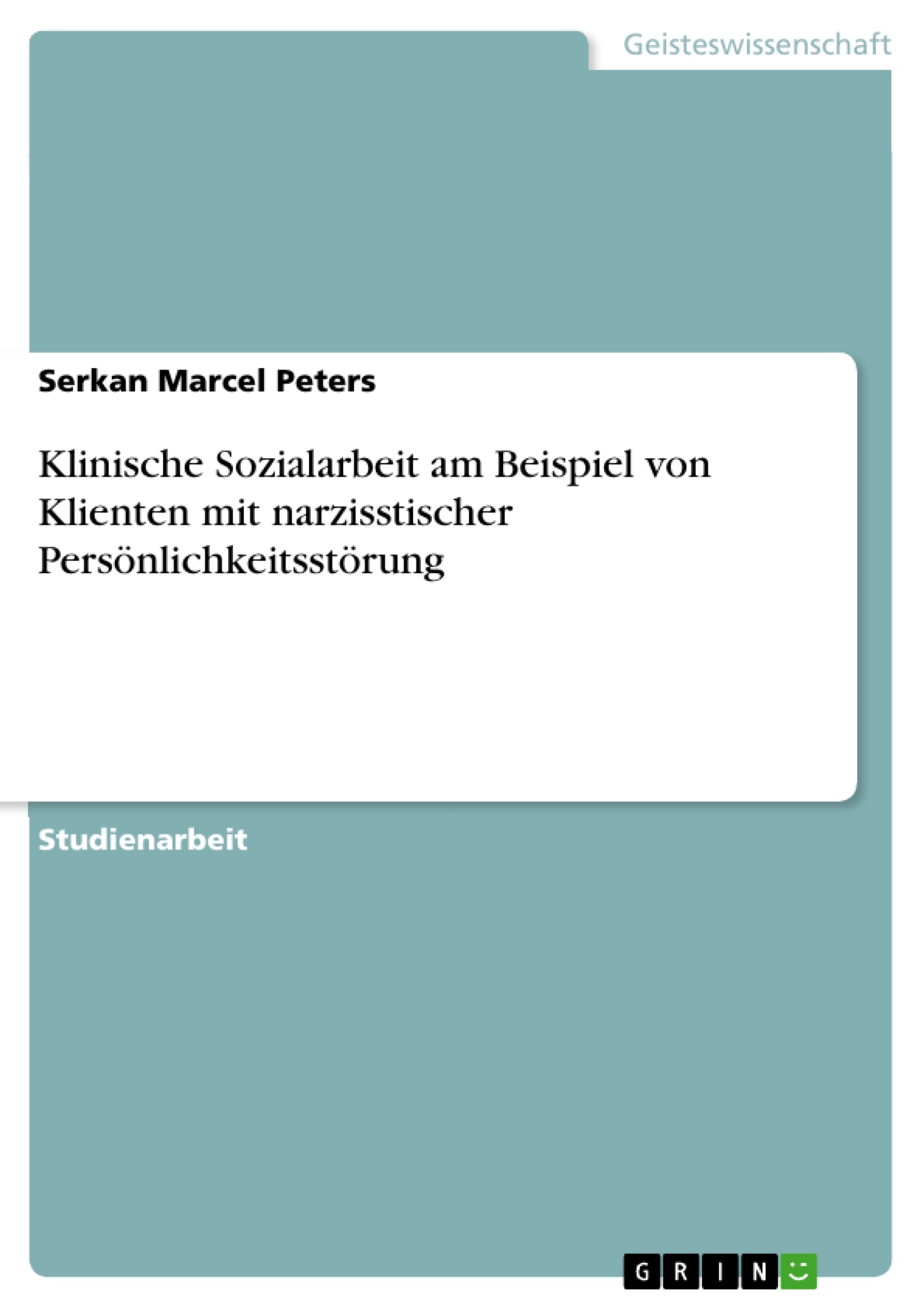Dass Narzissmus einen sehr viel umfassenderen Charakter besitzt und von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung klar abgekoppelt existiert, bleibt meist im Verborgenen, weshalb im Verlauf dieser Seminararbeit ein genauer Blick auf die Definition und Auffassungen hinsichtlich des Narzissmus bzw. der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geworfen werden soll. Dieser Idee folgend werden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die Entstehungsursachen, das Störungsbild, aber auch die jeweilig anzustrebenden Ziele sowie der erfolgreiche Umgang mit narzisstischen Klienten, einschließlich des mentalisierungsbasierten Konzepts als Methode, erläutert. Die Anwendung im sozialarbeiterischen Kontext steht hierbei an vorderster Stelle.
In einer Gesellschaft, in welcher soziale Medien überaus präsent sind, rückt das Individuum durch brisante Posts, einen außergewöhnlichem Lebensstil oder schlichtweg schönes Aussehen schrittweise weiter in den Fokus. Es geht darum, immer beliebter, interessanter und bunter als der Rest zu sein, weshalb der Begriff Narzissmus in diesem Zusammenhang gerne und häufig Gebrauch findet. Auch außerhalb der sozialen Medien findet der Begriff seinen Platz, ja, ist sogar alltäglicher Natur und wird gemeinhin für Personen verwendet, die für den eigenen Geschmack zu selbstbewusst sind oder kurz gesagt: Eine falsche, überzogene, ungesunde Haltung zum Selbst besitzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Definition von Narzissmus
- Narzissmus - Die verschiedenen Auffassungen
- Sigmund Freud's Perspektive
- Heinz Kohut's Auffassung
- Otto F. Kernberg's Verständnis
- Formen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung
- Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS)
- Grandioser Typus
- Vulnerabler Typus
- Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPS)
- Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS)
- Narzissmus - Eine Frage des Geschlechts
- Der weibliche Narzissmus
- Der männliche Narzissmus
- Enstehungsursachen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung
- Die Genetik
- Bindungsstörungen
- Mentalisierungsstörungen
- Traumatisierungen
- Störungsbild von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen
- Selbstregulationsstörungen
- Antisoziales Verhalten und Anspruchshaltung
- Formulierung von Zielen
- Zielführender Umgang mit narzisstischem Klientel
- Die komplementäre Beziehungsgestaltung
- Menschen keinesfalls defizitär betrachten
- Streit mit den Klienten bestmöglich vermeiden
- Stetiges Verstärken
- Orientierung an den Ressourcen
- Die Gelegenheit zur Selbstdarstellung erlauben
- Bedingungslose Wertschätzung entgegenbringen
- Stetiges Mitwirken fördern
- Komplementärer Umgang mit dem Testverhalten der Klienten
- Die komplementäre Beziehungsgestaltung
- Mentalisierungsbasierte Therapie als zielführende Methode, innerhalb des Mentalisierungskonzeptes, in der klinischen Sozialarbeit mit narzisstisch persönlichkeitsgestörten Menschen
- Empathisches Validieren
- Klarifikation
- Herausfordern bzw. -fördern eines Perspektivwechsels
- Die Stop and stand Technik
- Affektelaboration
- Mentalisieren der Beziehung untereinander und mit anderen Menschen
- Abschließende Worte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der klinischen Sozialarbeit im Umgang mit Klienten, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieser Störung zu entwickeln und zielführende Strategien für den sozialarbeiterischen Kontext aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Perspektiven auf Narzissmus und untersucht die Entstehung, das Störungsbild und den Umgang mit betroffenen Personen.
- Definition und verschiedene Auffassungen von Narzissmus
- Entstehungsursachen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung
- Das Störungsbild narzisstischer Persönlichkeitsstörungen
- Zielführender Umgang mit narzisstischem Klientel
- Mentalisierungsbasierte Therapie als Methode
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Worte: Die Arbeit beginnt mit einer Betrachtung des zunehmenden Fokus auf das Individuum in der heutigen Gesellschaft, insbesondere im Kontext sozialer Medien. Sie führt ein in die Thematik des Narzissmus und seiner verschiedenen Ausprägungen, von gesunden narzisstischen Eigenschaften bis hin zur pathologischen narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS). Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zwischen alltäglicher Verwendung des Begriffs und der klinischen Diagnose, und kündigt die folgende detaillierte Auseinandersetzung mit Definitionen, Entstehung, Störungsbild und sozialarbeiterischem Umgang mit NPS an.
Definition von Narzissmus: Dieses Kapitel differenziert zwischen Narzissmus als normale Persönlichkeitseigenschaft und der pathologischen narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS). Es wird die Definition von Erich Fromm erläutert, die Narzissmus als einen Erlebniszustand beschreibt, in dem nur die eigene Person und ihr Umfeld als real wahrgenommen werden. Der fließende Übergang zwischen gesunden narzisstischen Zügen und der klinischen Störung wird hervorgehoben, ebenso wie die Tendenz von NPS-Betroffenen zur Selbstüberschätzung und Projektion von Misserfolgen auf andere.
Narzissmus - Die verschiedenen Auffassungen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene psychoanalytische Perspektiven auf Narzissmus. Es werden die Ansichten von Sigmund Freud, der Narzissmus als sexuelle Ergänzung zum Egoismus beschreibt und zwischen primärer und sekundärer Form unterscheidet, sowie die von Heinz Kohut, der die Entstehung von krankhaftem Narzissmus durch narzisstische Traumen in der Kindheit erklärt, beleuchtet. (Der Abschnitt zu Otto F. Kernberg fehlt im vorliegenden Textauszug.)
Formen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung: Hier werden verschiedene Formen narzisstischer Persönlichkeitsstörungen beschrieben, darunter die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) mit ihren grandiosen und vulnerablen Typen und die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPS). Die Charakteristika der jeweiligen Typen werden vermutlich im Detail erläutert, jedoch sind diese Details im gegebenen Textauszug nicht enthalten.
Narzissmus - Eine Frage des Geschlechts: Dieser Abschnitt behandelt die unterschiedlichen Manifestationen von Narzissmus bei Frauen und Männern. Die spezifischen Ausprägungen des weiblichen und männlichen Narzissmus werden vermutlich näher beleuchtet, aber die Details fehlen im gegebenen Textauszug.
Enstehungsursachen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung: Dieses Kapitel untersucht die möglichen Ursachen für die Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Es werden genetische Faktoren, Bindungsstörungen, Mentalisierungsstörungen und Traumatisierungen als mögliche Einflussfaktoren diskutiert. Die komplexen Wechselwirkungen dieser Faktoren auf die Entstehung der Störung werden vermutlich detailliert dargelegt.
Störungsbild von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen: Dieser Abschnitt beschreibt die charakteristischen Merkmale und Symptome einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die Kapitel befassen sich wahrscheinlich mit Selbstregulationsstörungen und antisozialem Verhalten, sowie der damit verbundenen Anspruchshaltung.
Formulierung von Zielen: Dieses Kapitel legt wahrscheinlich die Ziele der therapeutischen Interventionen bei Klienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung fest. Der Textauszug enthält jedoch keine weiteren Details.
Zielführender Umgang mit narzisstischem Klientel: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Strategien und Techniken für den erfolgreichen Umgang mit Klienten, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Der Schwerpunkt liegt vermutlich auf der komplementären Beziehungsgestaltung und der Vermeidung von Konflikten. Die einzelnen Punkte (9.1.1 - 9.1.8) geben Aufschluss auf verschiedene Aspekte dieser Strategie.
Mentalisierungsbasierte Therapie als zielführende Methode, innerhalb des Mentalisierungskonzeptes, in der klinischen Sozialarbeit mit narzisstisch persönlichkeitsgestörten Menschen: Dieses Kapitel befasst sich mit der mentalisierungsbasierten Therapie als Methode im Umgang mit narzisstischen Klienten. Es werden Techniken wie empathisches Validieren, Klarifikation, Perspektivwechsel fördern und die "Stop and stand Technik" beschrieben. Der Fokus liegt auf dem Verständnis und der Förderung der Mentalisierung bei den Klienten.
Schlüsselwörter
Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS), Narzissmus, klinische Sozialarbeit, Mentalisierungsbasierte Therapie, Bindungsstörungen, Selbstwertgefühl, Beziehungsgestaltung, Traumatisierung, antisoziales Verhalten, Selbstregulation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Narzisstische Persönlichkeitsstörung und Klinische Sozialarbeit
Was ist der Hauptfokus dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die klinische Sozialarbeit im Umgang mit Klienten, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) leiden. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Störung zu entwickeln und zielführende Strategien für den sozialarbeiterischen Kontext aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, darunter Definition und verschiedene Auffassungen von Narzissmus (inklusive der Perspektiven von Freud und Kohut), Entstehung der Störung (Genetik, Bindungsstörungen, Traumatisierungen), das Störungsbild (Selbstregulationsstörungen, antisoziales Verhalten), den zielführenden Umgang mit betroffenen Klienten und die Mentalisierungsbasierte Therapie als Methode.
Wie wird Narzissmus in der Arbeit definiert und differenziert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Narzissmus als normale Persönlichkeitseigenschaft und der pathologischen narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS). Es wird die Definition von Erich Fromm erläutert und der fließende Übergang zwischen gesunden narzisstischen Zügen und der klinischen Störung hervorgehoben.
Welche verschiedenen Auffassungen von Narzissmus werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene psychoanalytische Perspektiven, insbesondere die Ansichten von Sigmund Freud (primärer und sekundärer Narzissmus) und Heinz Kohut (Entstehung durch narzisstische Traumen in der Kindheit). Die Perspektive von Otto Kernberg wird ebenfalls erwähnt, aber im vorliegenden Auszug nicht detailliert dargestellt.
Welche Formen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung werden unterschieden?
Die Arbeit beschreibt die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) mit ihren grandiosen und vulnerablen Typen sowie die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ASPS). Die Charakteristika der jeweiligen Typen werden zwar erwähnt, aber im Auszug nicht im Detail erläutert.
Wie werden die Geschlechterunterschiede beim Narzissmus behandelt?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Manifestationen von Narzissmus bei Frauen und Männern. Konkrete Details zu den spezifischen Ausprägungen fehlen jedoch im gegebenen Textauszug.
Welche Entstehungsursachen für NPS werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht genetische Faktoren, Bindungsstörungen, Mentalisierungsstörungen und Traumatisierungen als mögliche Einflussfaktoren für die Entwicklung einer NPS. Die komplexen Wechselwirkungen dieser Faktoren werden vermutlich detailliert dargelegt, sind aber im Auszug nicht vollständig beschrieben.
Wie wird das Störungsbild von NPS charakterisiert?
Das Störungsbild wird durch Selbstregulationsstörungen und antisoziales Verhalten mit Anspruchshaltung beschrieben. Weitere Details fehlen im Textauszug.
Welche Strategien für den Umgang mit narzisstischem Klientel werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt Strategien für den erfolgreichen Umgang mit Klienten mit NPS, mit Schwerpunkt auf der komplementären Beziehungsgestaltung und der Vermeidung von Konflikten. Konkrete Techniken wie das Vermeiden von Streit, stetiges Verstärken, Orientierung an Ressourcen und die Ermöglichung von Selbstdarstellung werden genannt.
Welche Rolle spielt die mentalisierungsbasierte Therapie?
Die mentalisierungsbasierte Therapie wird als zielführende Methode vorgestellt. Es werden Techniken wie empathisches Validieren, Klarifikation, Perspektivwechsel fördern und die "Stop and stand Technik" beschrieben. Der Fokus liegt auf dem Verständnis und der Förderung der Mentalisierung bei den Klienten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS), Narzissmus, klinische Sozialarbeit, Mentalisierungsbasierte Therapie, Bindungsstörungen, Selbstwertgefühl, Beziehungsgestaltung, Traumatisierung, antisoziales Verhalten, Selbstregulation.
- Quote paper
- Serkan Marcel Peters (Author), 2021, Klinische Sozialarbeit am Beispiel von Klienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1193196