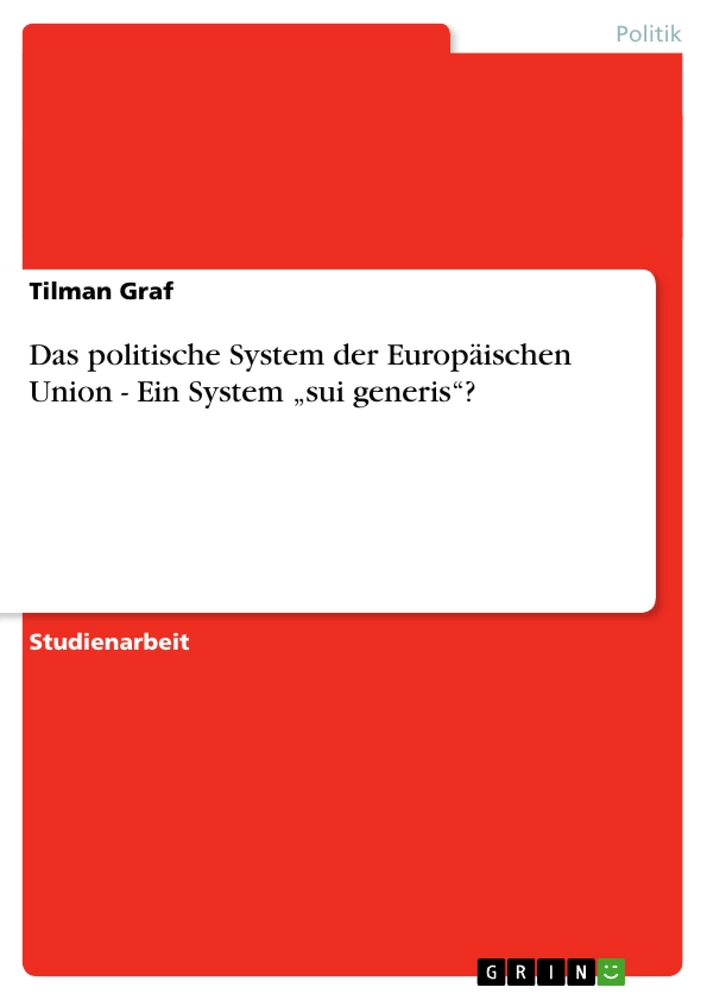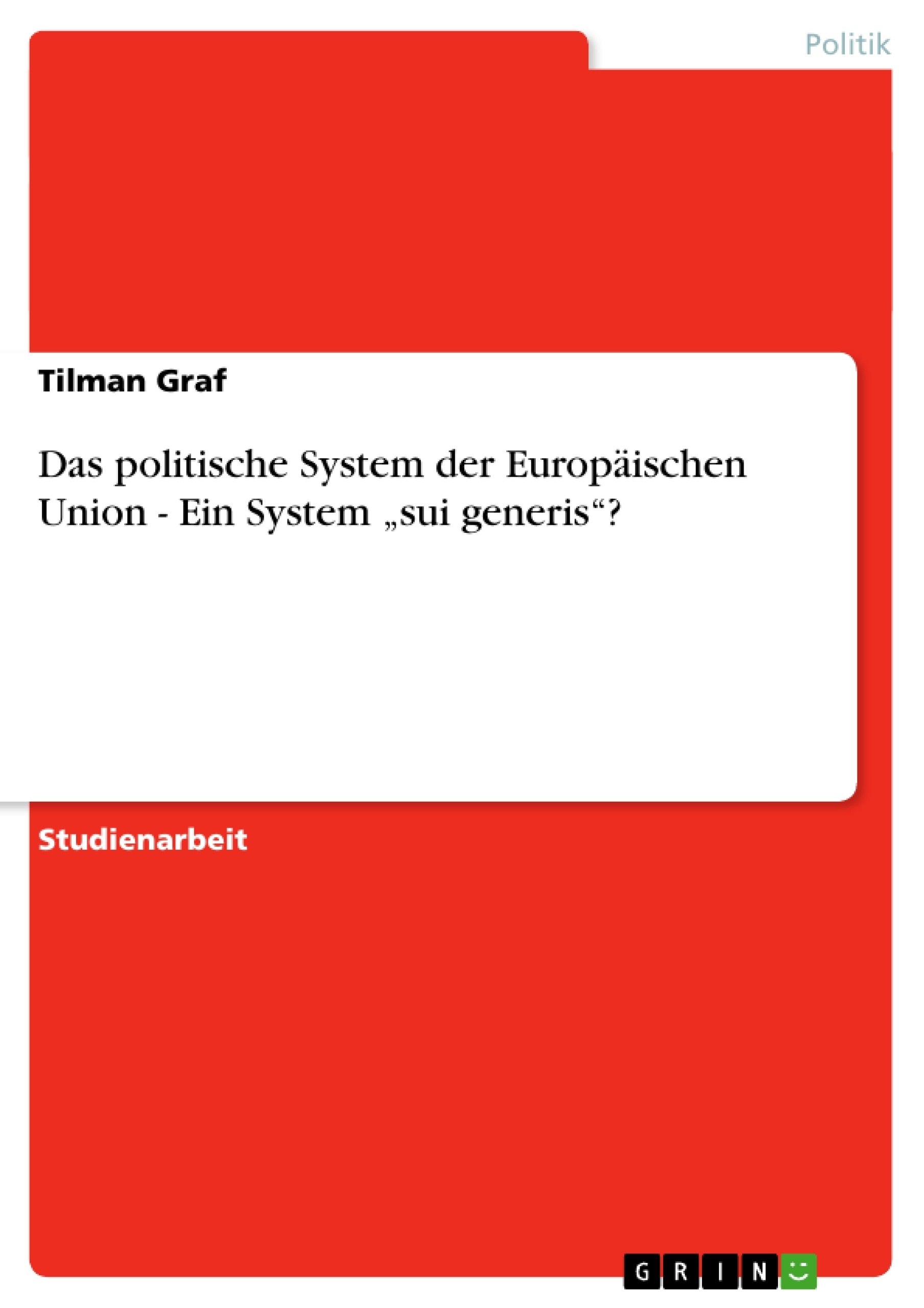[...] Da sich die Frage nach dem „sui-generis Charakter“ des politischen Systems EU nicht am Anfang einer Hausarbeit schon beantworten lässt, sondern erst nach sorgfältiger Bearbeitung bewertet werden kann, will ich mich bei der Erörterung von einer abstrakten Problembeschreibung zu einer eher praktisch orientierten Darstellung bewegen, um nicht schon eine mögliche Antwort auf die Frage vorwegzunehmen. Die Komplexität der Europäischen Gemeinschaft - mit ihrem institutionellen Mehrebenencharakter und ihrem historischen Erbe - bedarf einer Reduktion. Solch eine Reduktion von Komplexität kann erreicht werden, indem der Druck der „ständig zunehmenden Möglichkeit von der beschränkt belastbaren Erlebnisfähigkeit des Menschen“ minimiert wird. Eine geistige Ordnung zur Erfassung der relevanten Aspekte des von mir zu bearbeitenden Themas erhoffe ich mir daher von dem Versuch der Betrachtung der EU aus der Perspektive von Eastons Systemtheorie. Aus seiner Analyseperspektive ist es klar, dass aufgrund des hohen Abstraktionslevels, die von mir zu bearbeitende Fragestellung nicht beantwortet werden kann; die Möglichkeit der Beantwortung hierauf liegt wohl vielmehr auf der konkreteren Dimension der polities, des Mehrebenencharakters der europäischen Gemeinschaft sowie der sozialen Legitimation der EU in der Bevölkerung. Trotzdem erlaubt mir Eastons Systematik eine Einordnung der auch für die EU geltenden verschiedenen Dimensionen des Politikbegriffs, nämlich polity, politics und policy.
Ich stelle mir im Folgenden die Frage, ob die an Kompetenzen gewachsene europäische Gemeinschaft (EG) bei ihrer Entwicklung hin zu einer politischen Union (EU) mit komparativen demokratietheoretischen Kriterien, die sich aus dem Vergleich mit Nationalstaaten entwickelt haben, zu messen ist oder ob man an eine Grenze der Übertragbarkeit entsprechender Konzepte stößt. Hierbei werde ich auch näher auf die politischen Institutionen (polities) sowie aktuelle politische Inhalte (policies) und die Prozesse, welche die politischen Entscheidungen (politics) für die Menschen in der EU verbindlich machen, eingehen. Außer mit politikwissenschaftlichen Methoden ist das politische System der EU aber auch aus rechtswissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Der eigentlich aus den Rechtswissenschaften stammende Terminus „sui generis“, der hier in meiner Fragestellung im Zusammenhang mit der EU verwendet wird, rechtfertigt einen Exkurs in die Juristerei, um die Idee hinter dieser umständlichen und gewollt uneindeutigen Bezeichnung für das vereinte Europa zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Perspektiven der Analyse
- Moderne Demokratietheorien als Maßstab der Analyse
- Parlamentarismus-Präsidentialismus-Theorie
- Mehrheits-Konsensusdemokratie-Theorie
- Schlussfolgerungen für das politische System der EG
- Moderne Demokratietheorien als Maßstab der Analyse
- Das „sui generis“ Problem aus juristischer Sichtweise
- Perspektiven / Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob das politische System der Europäischen Union (EU) mit komparativen demokratietheoretischen Kriterien, die aus dem Vergleich mit Nationalstaaten entwickelt wurden, gemessen werden kann, oder ob die Übertragbarkeit solcher Konzepte an ihre Grenzen stößt. Die Arbeit analysiert den „sui generis“ Charakter der EU und beleuchtet, inwieweit die EU als Staat mit Gewaltmonopol betrachtet werden kann.
- Der „sui generis“ Charakter der EU
- Anwendbarkeit von Demokratietheorien auf die EU
- Die EU als Staat im Vergleich zu Nationalstaaten
- Soziale Legitimation der EU
- Eastons Systemtheorie und die EU
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Stillstand in der Diskussion um die Ausweitung der Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft nach dem Scheitern der Verfassungsgebung. Sie thematisiert das Problem der sozialen Legitimation der EU und die Frage nach ihrem „sui generis“ Charakter. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die EU anhand komparativer demokratietheoretischer Kriterien zu untersuchen und dabei die verschiedenen Dimensionen des Politikbegriffs (polity, politics, policy) nach Easton zu berücksichtigen.
Perspektiven der Analyse: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Begriffs „sui generis“ und dessen Anwendung auf das politische System der EU. Es werden verschiedene politikwissenschaftliche Theorien, insbesondere die Ansätze von Max Weber und David Easton, vorgestellt, um die Komplexität des EU-Systems zu analysieren und zu bewerten, ob die EU anhand etablierter Kriterien für Nationalstaaten gemessen werden kann. Die Kapitel erläutert die relevanten Konzepte und legt den Fokus auf die Analyse des politischen Systems der EU unter Berücksichtigung von Polity, Politics und Policy.
Das „sui generis“ Problem aus juristischer Sichtweise: Dieses Kapitel wird eine rechtswissenschaftliche Perspektive auf den „sui generis“ Charakter der EU einnehmen, den Begriff weiter erläutern und die Besonderheiten des europäischen politischen Systems aus juristischer Sicht beleuchten. Es wird sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Rechtswissenschaft die Einzigartigkeit der EU-Ordnung einordnet und welche Konsequenzen sich daraus für die vergleichende Analyse ergeben.
Schlüsselwörter
Europäische Union, „sui generis“, Demokratietheorien, Komparative Regierungslehre, Max Weber, David Easton, Staatscharakter, Soziale Legitimation, Gewaltmonopol, Politische Systeme, Rechtswissenschaft, Polity, Politics, Policy.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des politischen Systems der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob das politische System der Europäischen Union (EU) mit komparativen demokratietheoretischen Kriterien, die aus dem Vergleich mit Nationalstaaten entwickelt wurden, gemessen werden kann, oder ob die Übertragbarkeit solcher Konzepte an ihre Grenzen stößt. Ein besonderer Fokus liegt auf dem „sui generis“ Charakter der EU und der Frage, inwieweit die EU als Staat mit Gewaltmonopol betrachtet werden kann.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit analysiert den „sui generis“ Charakter der EU unter Anwendung verschiedener politikwissenschaftlicher Theorien, insbesondere der Ansätze von Max Weber und David Easton. Sie berücksichtigt die verschiedenen Dimensionen des Politikbegriffs (polity, politics, policy) nach Easton und bezieht eine rechtswissenschaftliche Perspektive auf den „sui generis“ Charakter der EU mit ein.
Welche Demokratietheorien werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf moderne Demokratietheorien, darunter die Parlamentarismus-Präsidentialismus-Theorie und die Mehrheits-Konsensusdemokratie-Theorie, um das politische System der EU zu bewerten und zu vergleichen.
Was ist der „sui generis“ Charakter der EU?
Der „sui generis“ Charakter der EU beschreibt ihre Einzigartigkeit und die Schwierigkeit, sie mit etablierten Kriterien für Nationalstaaten zu messen. Die Arbeit untersucht diesen Charakter sowohl aus politikwissenschaftlicher als auch aus juristischer Sicht.
Welche Rolle spielt Eastons Systemtheorie?
Eastons Systemtheorie dient als analytisches Werkzeug, um die Komplexität des EU-Systems zu verstehen und die verschiedenen Aspekte des politischen Systems (Polity, Politics, Policy) zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Perspektiven der Analyse (inkl. relevanter Theorien), ein Kapitel zum „sui generis“ Problem aus juristischer Sichtweise und ein Schlusskapitel mit Perspektiven und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Union, „sui generis“, Demokratietheorien, Komparative Regierungslehre, Max Weber, David Easton, Staatscharakter, Soziale Legitimation, Gewaltmonopol, Politische Systeme, Rechtswissenschaft, Polity, Politics, Policy.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, ob und wie die Übertragbarkeit von demokratietheoretischen Konzepten, die auf Nationalstaaten angewendet werden, auf die EU funktioniert. Schlussfolgerungen beziehen sich auf die Anwendbarkeit der Theorien und die Einordnung der EU im Vergleich zu Nationalstaaten.
- Citar trabajo
- Tilman Graf (Autor), 2007, Das politische System der Europäischen Union - Ein System „sui generis“?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119197