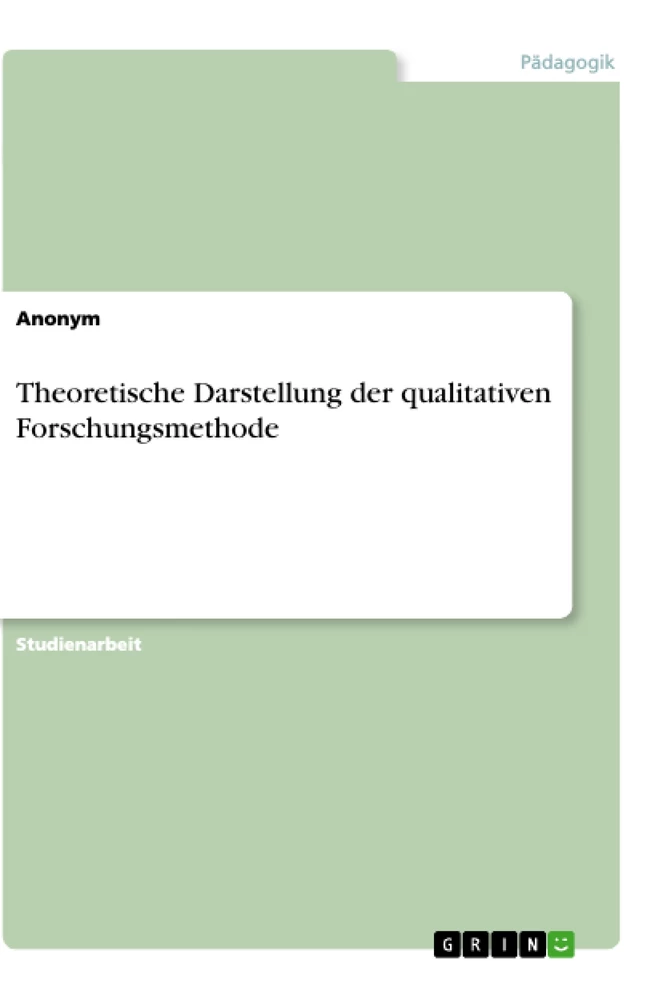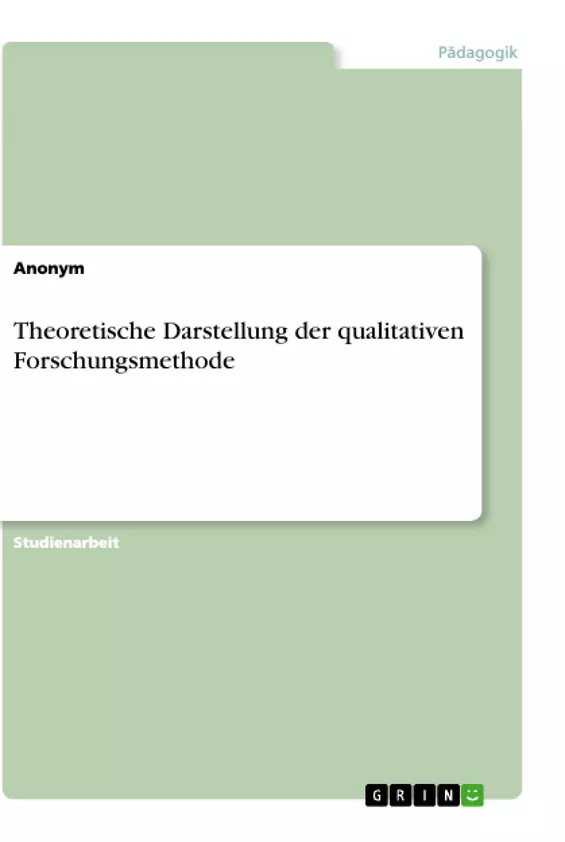Im Modul „Qualitative Forschungsmethoden“ stellt diese Fallstudie eine Prüfungsleistung dar. Den Studierenden stehen in diesem Modul drei Fallstudien zur Auswahl. In diesem Fall fiel die Wahl auf die Studie 1 zum Fallbeispiel „Schulische Inklusion in Beispielhausen“, mit dem Hinweis, dass diese Fallstudie eine fiktive Studie ist. Ziel dieser Fallstudie ist die Entwicklung eines Forschungsdesigns. Die Fallvorstellung der Studie sowie die Forschungsfrage werden im zweiten Punkt erläutert. Danach folgt die methodologische Positionierung im dritten Punkt sowie die grundlagentheoretische Einbettung im vierten Punkt. Im Anschluss daran folgt die Bestimmung der Forschungsfrage.
Die Datenerhebungsmethode mit dem narrativen Interview wird im nächsten Schritt beschrieben, woraufhin das Sampling folgt, was die genaue Wahl der Interviewpartner beschreibt. Danach wird die Datenauswertungsmethode beschrieben, um im darauffolgenden Schritt näher auf die Erstellung des Erhebungsinstruments einzugehen. Am Ende der Fallstudie wird ein Fazit gezogen. Im Anhang befindet sich eine Darstellung des Erhebungsinstruments in tabellarischer Form zum besseren Überblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallvorstellung und Forschungsfrage
- Methodologische Positionierung
- Grundlagentheoretische Einbettung
- Bestimmung des Forschungsfeldes
- Datenerhebungsmethode
- Sampling
- Datenaufbereitung
- Datenauswertung
- Erstellung eines Erhebungsinstruments
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie zielt darauf ab, ein Forschungsdesign zur Untersuchung der Inklusion an Grundschulen zu entwickeln. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Umsetzung inklusiver Bildung aus der Perspektive der Lehrkräfte. Die Studie basiert auf einem fiktiven Fallbeispiel.
- Schulische Inklusion in Beispielhausen
- Perspektiven der Lehrkräfte auf inklusive Bildung
- Methodologische Herausforderungen qualitativer Forschung
- Entwicklung eines Forschungsdesigns für qualitative Studien
- Analyse von Erfahrungen mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Fallstudie als Prüfungsleistung im Modul „Qualitative Forschungsmethoden“. Sie stellt das fiktive Fallbeispiel „Schulische Inklusion in Beispielhausen“ vor und skizziert den Aufbau der Studie, der sich mit der Entwicklung eines Forschungsdesigns befasst. Die Forschungsfrage wird im zweiten Kapitel erläutert. Die Einleitung betont den explorativen Charakter der Studie und die Notwendigkeit, ein geeignetes Forschungsdesign zu entwickeln, um die komplexe Thematik der Inklusion zu untersuchen.
Fallvorstellung und Forschungsfrage: Dieses Kapitel präsentiert das Fallbeispiel „Schulische Inklusion in Beispielhausen“, einer Stadt mit 75 Grundschulen, die sich mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandersetzt. Es beschreibt die unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen von Lehrkräften und Eltern bezüglich der Inklusion, die von erhöhter Arbeitsbelastung bis hin zu positiven Entwicklungen der Kinder reichen. Ausgehend von diesen vielschichtigen Erfahrungen wird die zentrale Forschungsfrage formuliert: „Wie kann Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte an den Regelgrundschulen in Beispielhausen gut funktionieren?“. Die Forschungsfrage wird als Ausgangspunkt für eine explorative Untersuchung positioniert, die im Laufe der Forschung angepasst werden kann.
Methodologische Positionierung: Dieses Kapitel legt die methodologische Grundlage der Studie fest. Es vergleicht quantitative und qualitative Forschungsansätze und argumentiert für einen qualitativen Ansatz aufgrund des Fokus auf die subjektiven Erfahrungen der Lehrkräfte. Es werden die Gütekriterien qualitativer Forschung detailliert erläutert, wie Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation. Diese Kriterien sollen die Qualität der Forschungsergebnisse sichern. Die Wahl für eine qualitative Herangehensweise wird begründet mit dem Interesse an der Innenperspektive der Lehrkräfte und der Notwendigkeit, nicht-numerische Aspekte der Inklusion zu erfassen.
Grundlagentheoretische Einbettung: Dieses Kapitel befasst sich mit bestehenden Studien zur schulischen Inklusion. Es beschreibt zwei relevante Studien: eine videogestützte ethnografische Studie, die sich auf die kulturelle Teilhabe von Kindern in inklusiven Schulen konzentriert, und eine weitere Studie, die die Bedingungen einer positiven Schulzeit untersucht. Beide Studien werden als Grundlage zur Einordnung der eigenen Forschungsfrage verwendet. Der Abschnitt betont den Mangel an Studien, die explizit die Perspektive von Lehrkräften mit Erfahrung im Umgang mit sonderpädagogischem Förderbedarf berücksichtigen, und begründet damit die Relevanz der vorliegenden Fallstudie.
Bestimmung des Forschungsfeldes: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung der Eingrenzung des Forschungsfeldes im Kontext der Forschungsfrage. Es beschreibt die Auswahl von Grundschulen in Beispielhausen, an denen Inklusion bereits implementiert ist, und die weitere Eingrenzung auf Lehrkräfte, die bereits Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet haben. Das Kapitel betont die Notwendigkeit eines zugänglichen Forschungsfeldes und die Wichtigkeit des Engagements der Forschenden für die Befragten.
Datenerhebungsmethode: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswahl der Datenerhebungsmethode. Nach der Bestimmung des Forschungsfeldes werden verschiedene Methoden vorgestellt, wie z.B. narrative Interviews, Leitfadeninterviews, Beobachtungen und Gruppendiskussionen. Die Wahl des narrativen Interviews wird begründet mit dem Fokus auf das freie Erzählen der Lehrkräfte und dem Erfassen subjektiver Bedeutungsstrukturen. Die Prinzipien der Offenheit und Kommunikation im narrativen Interview werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Schulische Inklusion, Qualitative Forschung, Narrative Interviews, Lehrkräfteperspektiven, UN-Behindertenrechtskonvention, Forschungsdesign, sonderpädagogischer Förderbedarf, Beispielhausen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Fallstudie: Schulische Inklusion in Beispielhausen
Was ist der Gegenstand dieser Fallstudie?
Diese Fallstudie befasst sich mit der Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Untersuchung der Inklusion an Grundschulen. Der Fokus liegt auf der Perspektive der Lehrkräfte und den Herausforderungen und Möglichkeiten der Umsetzung inklusiver Bildung in der fiktiven Stadt Beispielhausen.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie kann Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte an den Regelgrundschulen in Beispielhausen gut funktionieren?“. Die Studie hat einen explorativen Charakter und die Forschungsfrage kann im Laufe der Forschung angepasst werden.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Studie verwendet einen qualitativen Forschungsansatz. Es werden narrative Interviews mit Lehrkräften durchgeführt, um deren subjektive Erfahrungen und Bedeutungsstrukturen zu erfassen. Die Wahl des narrativen Interviews wird durch den Fokus auf das freie Erzählen der Lehrkräfte begründet.
Warum wurde ein qualitativer Ansatz gewählt?
Ein qualitativer Ansatz wurde gewählt, da der Fokus auf den subjektiven Erfahrungen der Lehrkräfte liegt und nicht-numerische Aspekte der Inklusion erfasst werden sollen. Quantitative Ansätze werden explizit abgegrenzt und die Vorteile eines qualitativen Zugangs, wie die Erfassung der Innenperspektive, werden hervorgehoben. Die Gütekriterien qualitativer Forschung wie Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation sichern die Qualität der Ergebnisse.
Welche theoretische Grundlage hat die Studie?
Die Studie bezieht sich auf bestehende Studien zur schulischen Inklusion, darunter eine videogestützte ethnografische Studie zur kulturellen Teilhabe von Kindern und eine Studie zu den Bedingungen einer positiven Schulzeit. Der Mangel an Studien, die explizit die Perspektive von Lehrkräften mit Erfahrung im Umgang mit sonderpädagogischem Förderbedarf berücksichtigen, wird als Begründung für die Relevanz dieser Studie hervorgehoben.
Wie wurde das Forschungsfeld bestimmt?
Das Forschungsfeld wurde auf Grundschulen in Beispielhausen eingegrenzt, an denen Inklusion bereits implementiert ist. Die Auswahl konzentriert sich auf Lehrkräfte, die bereits Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet haben. Die Bedeutung eines zugänglichen Forschungsfeldes und das Engagement der Forschenden für die Befragten werden betont.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie beinhaltet Kapitel zu Einleitung, Fallvorstellung und Forschungsfrage, methodologischer Positionierung, grundlagentheoretischer Einbettung, Bestimmung des Forschungsfeldes, Datenerhebungsmethode, Sampling (Stichprobenziehung), Datenaufbereitung, Datenauswertung, Erstellung eines Erhebungsinstruments und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Schulische Inklusion, Qualitative Forschung, Narrative Interviews, Lehrkräfteperspektiven, UN-Behindertenrechtskonvention, Forschungsdesign, sonderpädagogischer Förderbedarf, Beispielhausen.
Was ist das Ziel der Studie?
Das Ziel der Studie ist die Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Untersuchung der Inklusion an Grundschulen. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Umsetzung inklusiver Bildung aus der Perspektive der Lehrkräfte und basiert auf einem fiktiven Fallbeispiel.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2022, Theoretische Darstellung der qualitativen Forschungsmethode, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191695