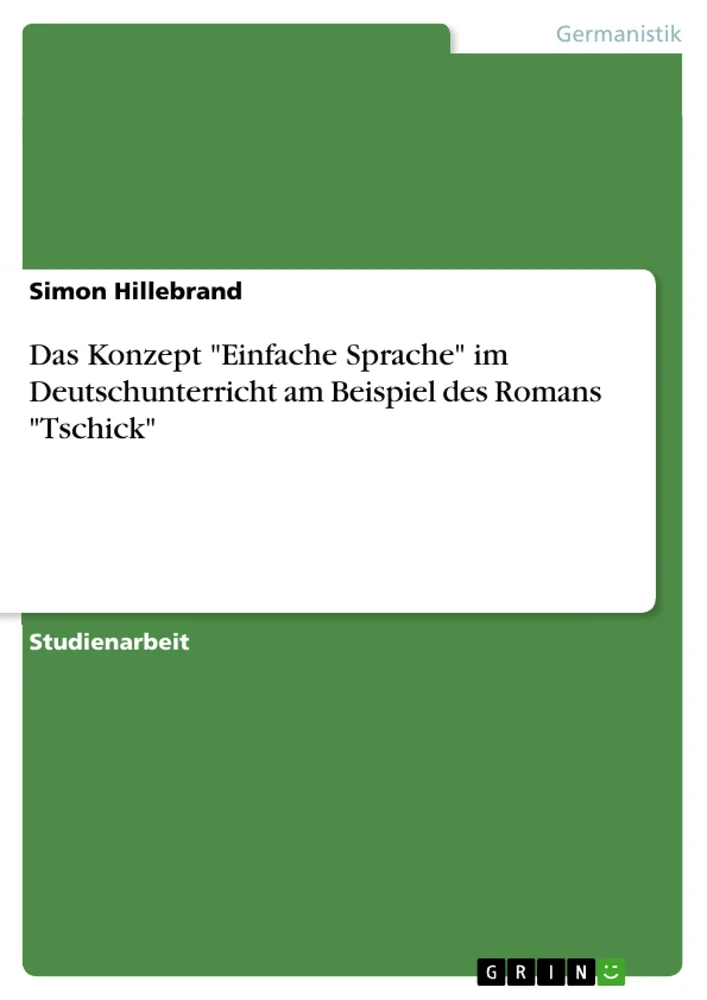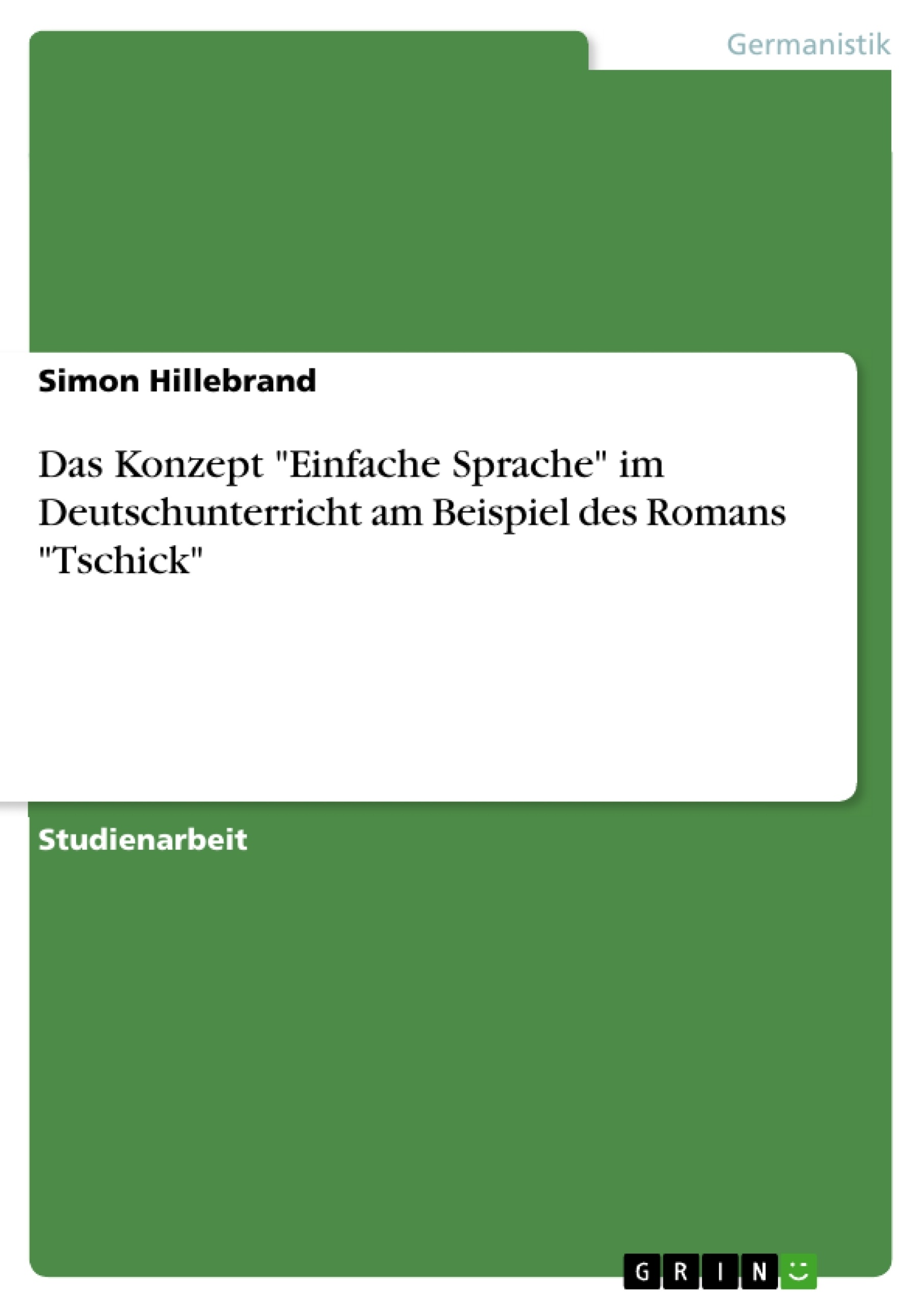Diese Hausarbeit befasst sich mit den Konzepten der "Leichten Sprache" und der "Einfachen Sprache" und stellt diese einander gegenüber. Im Verlauf der Arbeit wird das Konzept Einfache Sprache am Roman Tschick angewendet und verglichen, wie sich der Text von dem Original abgrenzt. Die Unterschiede zwischen Originaltexten und ihrer Fassung in Einfacher Sprache werden am expliziten Beispiel eines Kapitels aufgezeigt. Kann der Originaltext so reduziert werden, dass der Inhalt und die Sprache nicht in Mitleidenschaft gezogen wird?
Der Alltag an deutschen Schulen ist unter anderem geprägt von diversen Kulturen, sozialer Herkunft und Leistungsunterschieden. Diese Heterogenität wird durch die zunehmende Zusammenlegung der Real- und Hauptschulen zu Sekundarschulen und die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 verstärkt. Zwar wünschen sich die deutschen Lehrkräfte auch heute noch homogene Lerngruppen, dies ist aber aus der realistischen Perspektive eine utopische Sehnsucht. Statt diesem Wunsch nachzueifern, scheint es doch viel sinnvoller, sich diese Heterogenität zu Nutzen zu machen und zu lernen, mit ihr und nicht gegen sie zu arbeiten. Die (Leistungs-)Heterogenität der Schüler:innen ist auch im Deutschunterricht festzustellen und zeichnet sich durch beunruhigende PISA-Ergebnisse ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leichte Sprache und Einfache Sprache
- Das Konzept Leichte Sprache
- Das Konzept Einfache Sprache
- Einfache und leichte Sprache im Literaturunterricht
- Vergleich Tschick zu Tschick - in einfacher Sprache
- Formale Ebene
- Inhaltliche Ebene
- Sprachliche Ebene
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte „Leichte Sprache“ und „Einfache Sprache“ im Kontext des Deutschunterrichts und analysiert deren Anwendung anhand des Romans „Tschick“. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Konzepte zu verdeutlichen und deren Eignung für den Unterricht, insbesondere im Umgang mit heterogenen Lerngruppen, zu bewerten. Der Vergleich des Originaltextes mit einer vereinfachten Version von „Tschick“ soll die Auswirkungen der Vereinfachung auf formaler, inhaltlicher und sprachlicher Ebene aufzeigen.
- Konzepte Leichte Sprache und Einfache Sprache
- Anwendung im Deutschunterricht
- Analyse der Vereinfachung von literarischen Texten
- Vergleich formaler, inhaltlicher und sprachlicher Aspekte
- Didaktische Implikationen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: die zunehmende Heterogenität in deutschen Schulen und die damit verbundenen Herausforderungen im Deutschunterricht. Sie führt die Konzepte „Leichte Sprache“ und „Einfache Sprache“ ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit begründet die Relevanz der vereinfachten Sprachformen durch die UN-Behindertenrechtskonvention und die Notwendigkeit, mit der Heterogenität der Lerngruppen effektiv umzugehen.
Leichte Sprache und Einfache Sprache: Dieses Kapitel dient als Einführung in die beiden Konzepte. Es beginnt mit einer Erläuterung der „Leichten Sprache“, ihrer Definition als Varietät des Deutschen mit systematischen Reduktionen im Satzbau und Wortschatz und deren Zielgruppen (Menschen mit Behinderung, funktionaler Analphabetismus, Migrationshintergrund etc.). Die Reduktion zielt auf eine erleichterte Informationsverarbeitung ab, mittels einfacher Wörter, kurzer Hauptsätze und Vermeidung komplexer Strukturen. Das Kapitel dient als Grundlage für den späteren Vergleich mit „Einfacher Sprache“ und legt die theoretischen Grundlagen für die gesamte Arbeit.
Einfache und leichte Sprache im Literaturunterricht: Dieses Kapitel (nicht im Ausgangstext explizit benannt, aber implizit vorhanden durch den Bezug auf Kapitel 4) legt die didaktischen Grundlagen für den Einsatz von vereinfachten Sprachformen im Literaturunterricht dar. Es stützt sich auf einschlägige Studien und liefert mögliche Ansatzpunkte für die Unterrichtspraxis. Die Kapitel erläutert, wie die Konzepte „Leichte“ und „Einfache Sprache“ im Literaturunterricht eingesetzt werden können und welche Vorteile sie bieten. Es wird vermutlich die Legitimation für den Vergleich von Originaltext und vereinfachter Version in Kapitel 4 liefern.
Vergleich Tschick zu Tschick - in einfacher Sprache: Dieses Kapitel vergleicht den Originaltext von „Tschick“ mit einer vereinfachten Version auf formaler, inhaltlicher und sprachlicher Ebene. Die Analyse untersucht, inwieweit die Vereinfachung den Inhalt und die sprachliche Qualität beeinträchtigt. Es wird ein detaillierter Vergleich durchgeführt, der die Auswirkungen der Vereinfachungen auf die Wirkung des Textes beleuchtet. Hier werden die verschiedenen Ebenen der Textanalyse (formal, inhaltlich, sprachlich) detailliert dargestellt und verglichen.
Schlüsselwörter
Leichte Sprache, Einfache Sprache, Deutschunterricht, Inklusion, Heterogenität, Literaturunterricht, Roman Tschick, Textvereinfachung, sprachliche Analyse, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse von "Leichter" und "Einfacher Sprache" im Kontext des Romans "Tschick"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konzepte „Leichte Sprache“ und „Einfache Sprache“ im Kontext des Deutschunterrichts und analysiert deren Anwendung anhand des Romans „Tschick“. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Originaltextes mit einer vereinfachten Version, um die Auswirkungen der Vereinfachung auf formaler, inhaltlicher und sprachlicher Ebene aufzuzeigen und die Eignung der vereinfachten Sprachformen für den Unterricht, insbesondere mit heterogenen Lerngruppen, zu bewerten.
Welche Konzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte „Leichte Sprache“ und „Einfache Sprache“. Es wird erläutert, was diese Konzepte beinhalten (systematische Reduktionen im Satzbau und Wortschatz bei „Leichter Sprache“, Fokus auf erleichterte Informationsverarbeitung), und welche Zielgruppen sie adressieren (Menschen mit Behinderung, funktionaler Analphabetismus, Migrationshintergrund etc.).
Wie wird der Roman "Tschick" in die Analyse einbezogen?
Der Roman „Tschick“ dient als Fallbeispiel. Die Arbeit vergleicht den Originaltext mit einer vereinfachten Version von „Tschick“ auf formaler, inhaltlicher und sprachlicher Ebene. Diese Analyse untersucht, wie die Vereinfachung den Inhalt und die sprachliche Qualität beeinflusst und welche Auswirkungen die Vereinfachungen auf die Wirkung des Textes haben.
Welche Aspekte werden im Vergleich des Originaltextes und der vereinfachten Version von "Tschick" betrachtet?
Der Vergleich umfasst eine detaillierte Analyse auf drei Ebenen: der formalen Ebene (z.B. Satzbau), der inhaltlichen Ebene (z.B. Handlung, Thema) und der sprachlichen Ebene (z.B. Wortschatz, Komplexität der Sätze). Es wird untersucht, welche Veränderungen durch die Vereinfachung vorgenommen wurden und welche Konsequenzen diese Veränderungen haben.
Welche didaktischen Implikationen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die didaktischen Implikationen des Einsatzes von „Leichter Sprache“ und „Einfacher Sprache“ im Literaturunterricht, insbesondere im Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Es werden mögliche Ansatzpunkte für die Unterrichtspraxis aufgezeigt und die Vorteile des Einsatzes von vereinfachten Sprachformen im Unterricht diskutiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen „Leichter Sprache“ und „Einfacher Sprache“ zu verdeutlichen und deren Eignung für den Deutschunterricht, besonders im Umgang mit heterogenen Lerngruppen, zu bewerten. Sie soll die Auswirkungen der Textvereinfachung aufzeigen und didaktische Konsequenzen für den Unterricht ableiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Leichte Sprache, Einfache Sprache, Deutschunterricht, Inklusion, Heterogenität, Literaturunterricht, Roman Tschick, Textvereinfachung, sprachliche Analyse, Didaktik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Konzepten "Leichte Sprache" und "Einfache Sprache", ein Kapitel zu deren Anwendung im Literaturunterricht, einen Vergleich des Originals und einer vereinfachten Version von "Tschick" sowie ein Fazit.
- Citar trabajo
- Simon Hillebrand (Autor), 2021, Das Konzept "Einfache Sprache" im Deutschunterricht am Beispiel des Romans "Tschick", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190607