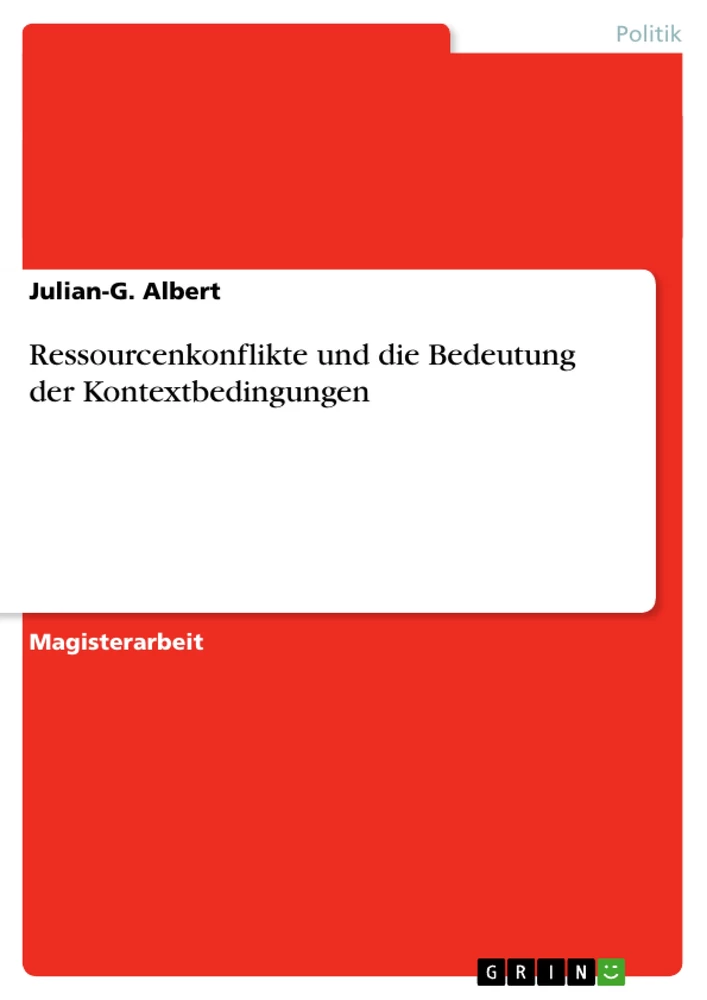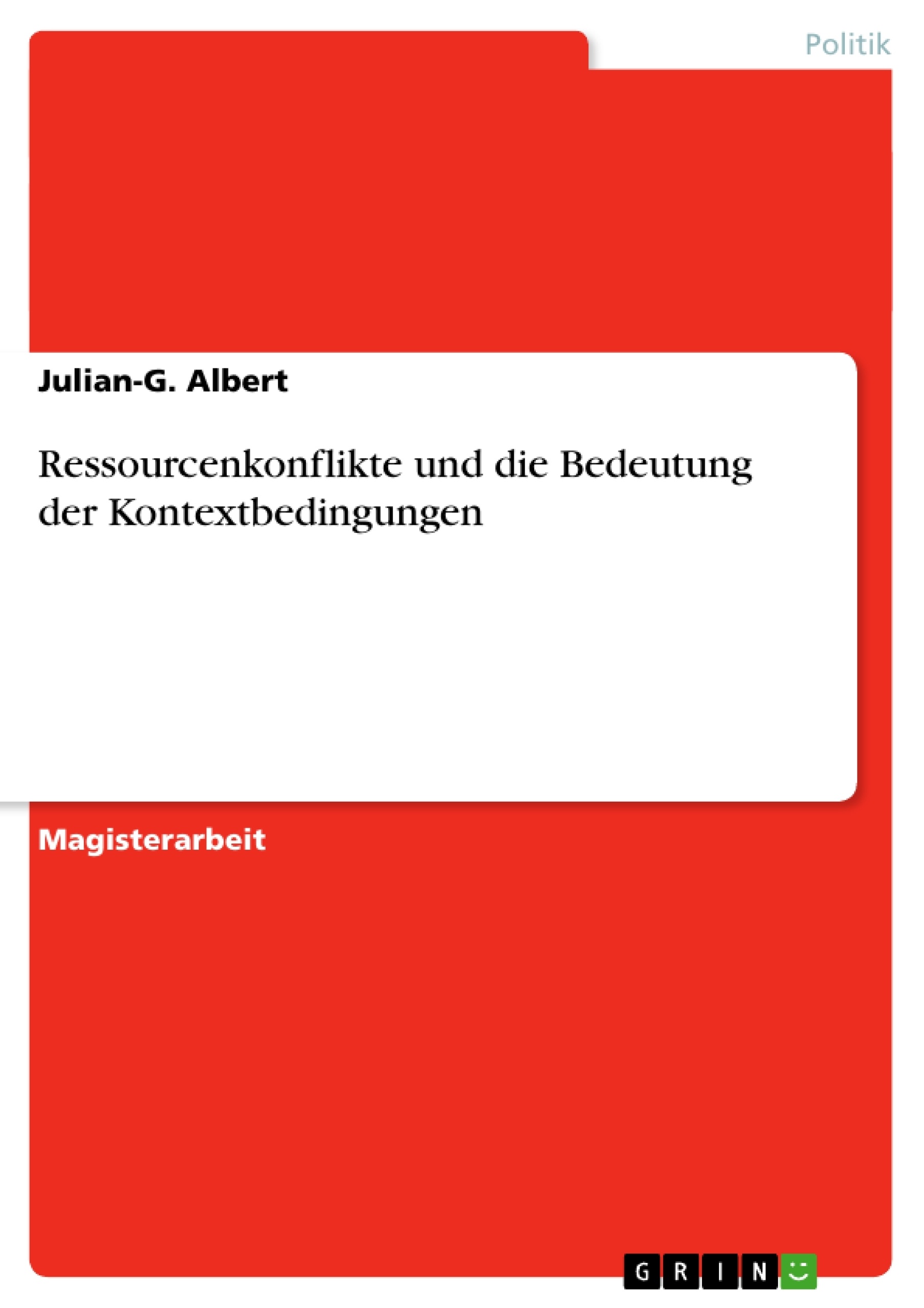Das globale Konfliktgeschehen hat sich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und besonders nach dem Ende des Kalten Krieges grundlegend gewandelt. Besonders das als "Neue Kriege" beschriebene Phänomen hat sämtliche bisherige Kriegsformen häufig abgelöst. In Afrika südlich der Sahara tritt diese Form am deutlichsten auf. Ein wesentlicher Bestandteil und Problematik der Neuen Kriege ist die Perpetuierung der Gewalt. Ermöglicht wird dies primär durch eine nicht versiegende Finanzierungsquelle, die Konflikt als ökonomischen Selbstzweck ermöglicht. Die Finanzierung durch die Aneignung und den Verkauf von natürlichen Ressourcen kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu, weil seltene Bodenschätze exorbitante Erträge auf dem Markt bringen können und das teure Unterfangen einer Kriegsführung finanzierbar wird.
In dieser Arbeit geht zunächst darum den aktuellen Forschungsstand dieser so genannten "Ressourcenkonflikte" zu erfassen. Dabei wird zu Beginn zunächst einheitliche Arbeitsdefinitionen abgegrenzt. Anschliessend wird aufgezeigt, inwiefern und ob natürliche Ressourcen einen Einfluss auf Gewaltkonflikte haben. Im vierten Kapitel soll sich der Frage zugewandt werden, ob der Mangel oder Überfluss an natürlichen Ressourcen für Konflikte verantwortlich sind. Bisher bestehen beide Erklärungsansätze noch weitestgehend parallel zueinander. Es wird empirisch deutlich, dass der Überfluss die primäre Triebfeder sind, aber der Knappheitsfaktor darin aufgehen kann. Im darauf folgenden Kapitel wird beschrieben, wie natürliche Ressourcen konkret auf Konflikte einwirken. Es zeigt sich jedoch, dass Regionen mit vielen natürlichen Ressourcen nicht zwangsläufig konfliktanfälliger sind. Somit scheinen andere Rahmenbedingungen eine Rolle in diesem Mechanismus zu spielen. Entsprechendes wird im sechsten Kapitel erörtert und möglichst präzise herausgearbeitet. In einem abschliessenden einfachen empirischen Vergleich soll im Sinne des MSCD zwei möglichst ähnliche Fälle herangezogen werden, die jeweils über wertvolle natürliche Ressourcen verfügen, aber das Ergebnis bzgl. der Konfliktanfälligkeit gegensätzlich ausfällt. Der Unterschied sollte nun in den Kontextfaktoren liegen.
Ziel dieser Arbeit war es, neben dem systematisieren des Forschungsstandes, der Bedeutung der Kontextfaktoren in den Vordergrund zu stellen. Es ist jedoch nur als verfolgenswerter Ansatz zu betrachten, weil die Fallauswahl sehr extrem ist und die Operationalisierung auf einem eher einfachen Level stattfand.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1. Natürliche Ressourcen
- 2.2. Gewaltsamer innerstaatlicher Konflikt und Bürgerkrieg
- 2.3. Ressourcenkonflikt
- 3. Der Einfluss natürlicher Ressourcen auf gewaltsame Konflikte
- 3.1. Ökonomischer Ansatz nach Collier und Hoeffler
- 3.1.1. Allgemein
- 3.1.2. Empire
- 3.1.3. Ergebnis
- 3.1.4. Vorteile der Modelle
- 3.1.5. Nachteile der Modelle
- 3.2. Natürliche Ressourcen und gewaltsamer Konflikt
- 3.1. Ökonomischer Ansatz nach Collier und Hoeffler
- 4. Mangel oder Überfluss?
- 4.1. Einleitung
- 4.2. Konfliktfaktor: Ressourcenknappheit
- 4.2.1. Der neo-malthusianische Ansatz
- 4.2.2. Sonderfall Wasserkonflikte?
- 4.2.3. Alternative Ansätze
- 4.3. Konfliktfaktor: Ressourcenüberfluss
- 4.3.1. Einleitung
- 4.3.2. Risikofaktoren aus Ressourcenüberfluss
- 4.3.3. Fazit: Ressourcenüberfluss - ein Fluch?
- 4.4. Zwischenergebnis
- 5. Rolle von natürlichen Ressourcen im gewaltsamen Konflikt
- 5.1. Einleitung
- 5.2. Rebellenfinanzierung
- 5.2.1. Eigener Abbau und Direktvermarktung
- 5.2.2. Entführungen und Erpressungen
- 5.2.3. Verkauf zukünftiger Abbaurechte
- 5.3. Konfliktdimensionen
- 5.3.1. Konfliktausbruch
- 5.3.2. Konfliktdauer
- 5.3.3. Konfliktintensität
- 5.3.4. Konflikttyp
- 6. Konfliktbegünstigende Kontextfaktoren
- 6.1. Erklärungsbedürftige Ausnahmen
- 6.2. Die entscheidende Rolle der Kontextbedingungen
- 6.2.1. Ressourcenspezifische Eigenschaften und Bedingungen
- 6.2.2. Endogene Kontextbedingungen
- 6.2.3. Exogene Kontextbedingungen
- 6.3. Zwischenfazit
- 7. Empirischer Vergleich
- 7.1. Vorüberlegungen
- 7.2. Fallauswahl
- 7.2.1. Warum Afrika südlich der Sahara?
- 7.2.2. DR Kongo: Ressourcenüberfluss und Konflikt
- 7.2.3. Botsuana: Ressourcenüberfluss und kein Konflikt
- 7.3. Ressourcenspezifische Bedingungen
- 7.3.1. Technischer Zugang
- 7.3.2. Illegalität und Anonymität
- 7.3.3. Blockierbarkeit
- 7.4. Vergleich der Kontextfaktoren
- 7.4.1. Geschichte
- 7.4.2. Institutionengefüge
- 7.4.3. Armut
- 7.4.4. Geographie
- 7.4.5. Weltwirtschaft
- 7.4.6. Fremdintervention
- 7.5. Ergebnis der Fallstudie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Ressourcenkonflikten und den sie beeinflussenden Kontextbedingungen. Ziel ist es, die Rolle natürlicher Ressourcen bei gewaltsamen Konflikten zu analysieren und zu verstehen, welche Faktoren neben dem bloßen Vorhandensein von Ressourcen deren konfliktauslösende Wirkung verstärken oder abschwächen.
- Der Einfluss von Ressourcenknappheit und -überfluss auf Konflikte
- Die Rolle von Ressourcen im Kontext der Finanzierung von bewaffneten Gruppen
- Die Bedeutung von Kontextfaktoren wie politische Institutionen, Armut und Geographie
- Ein empirischer Vergleich anhand von Fallstudien
- Die Entwicklung von theoretischen Modellen zur Erklärung von Ressourcenkonflikten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Ressourcenkonflikte ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie beschreibt die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Kontextfaktoren, die neben den Ressourcen selbst einen entscheidenden Einfluss auf den Ausbruch und die Eskalation von Konflikten haben.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter "natürliche Ressourcen", "gewaltsamer innerstaatlicher Konflikt" und "Ressourcenkonflikt". Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven vorgestellt und kritisch diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis der zentralen Konzepte zu schaffen. Eine klare und präzise Definition dieser Begriffe bildet die Grundlage für die nachfolgende Analyse.
3. Der Einfluss natürlicher Ressourcen auf gewaltsame Konflikte: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss natürlicher Ressourcen auf gewaltsame Konflikte, vor allem anhand des ökonomischen Ansatzes von Collier und Hoeffler. Es werden die Modelle von Collier und Hoeffler detailliert dargestellt, ihre Stärken und Schwächen bewertet und die Bedeutung von natürlichen Ressourcen im Kontext von gewaltsamen Konflikten diskutiert. Hierbei werden die ökonomischen Mechanismen herausgearbeitet, durch die Ressourcen zu Konflikten beitragen können.
4. Mangel oder Überfluss?: Dieses Kapitel untersucht die beiden gegensätzlichen Szenarien von Ressourcenknappheit und -überfluss als Konfliktfaktoren. Es werden verschiedene theoretische Ansätze, wie der neo-malthusianische Ansatz, vorgestellt und diskutiert. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Konfliktmechanismen und der Frage, ob Mangel oder Überfluss eher zu Konflikten führt. Die Ergebnisse dieses Kapitels bieten einen differenzierten Blick auf die Beziehung zwischen Ressourcen und Konflikten, die über einfache Kausalzusammenhänge hinausgeht.
5. Rolle von natürlichen Ressourcen im gewaltsamen Konflikt: Das Kapitel beleuchtet die Rolle der natürlichen Ressourcen im gewaltsamen Konflikt, indem es verschiedene Mechanismen der Rebellenfinanzierung analysiert. Es wird detailliert auf den Abbau und die Vermarktung von Ressourcen durch Rebellen eingegangen, ebenso wie auf die Nutzung von Entführungen und Erpressungen. Zudem werden die Auswirkungen der Ressourcenkontrolle auf verschiedene Konfliktdimensionen wie Ausbruch, Dauer, Intensität und Typ diskutiert. Dies liefert ein umfassendes Bild der komplexen Interaktion zwischen Ressourcen und Konfliktdynamik.
6. Konfliktbegünstigende Kontextfaktoren: Dieses Kapitel betont die Bedeutung von Kontextbedingungen für das Verständnis von Ressourcenkonflikten. Es untersucht ressourcenspezifische Eigenschaften, endogene und exogene Faktoren, die den Einfluss von Ressourcen auf Konflikte verstärken oder abschwächen. Es wird erläutert, warum das bloße Vorhandensein von Ressourcen nicht ausreicht, um Konflikte zu erklären, sondern die Interaktion mit anderen Faktoren entscheidend ist. Das Kapitel erklärt scheinbare Ausnahmen von der Regel und unterstreicht die Komplexität des Zusammenhangs.
7. Empirischer Vergleich: Dieses Kapitel präsentiert einen empirischen Vergleich anhand von Fallstudien aus Afrika südlich der Sahara, um die theoretischen Erkenntnisse zu überprüfen. Der Vergleich zwischen dem DR Kongo (Ressourcenüberfluss und Konflikt) und Botsuana (Ressourcenüberfluss und kein Konflikt) illustriert die Bedeutung der Kontextbedingungen. Die Analyse ressourcenspezifischer Bedingungen und Kontextfaktoren ermöglicht ein tieferes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Ressourcen und Konflikten.
Schlüsselwörter
Ressourcenkonflikte, natürliche Ressourcen, gewaltsamer Konflikt, Bürgerkrieg, Ressourcenknappheit, Ressourcenüberfluss, Rebellenfinanzierung, Kontextbedingungen, politische Institutionen, Armut, Geographie, Collier-Hoeffler-Modell, Afrika südlich der Sahara, DR Kongo, Botsuana.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Ressourcenkonflikte und Kontextbedingungen
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen natürlichen Ressourcen und gewaltsamen Konflikten, insbesondere die Rolle von Kontextbedingungen bei der Entstehung und Eskalation solcher Konflikte. Sie analysiert den Einfluss von Ressourcenknappheit und -überfluss und beleuchtet verschiedene Mechanismen der Rebellenfinanzierung.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie natürliche Ressourcen gewaltsame Konflikte beeinflussen, welche Faktoren neben dem bloßen Vorhandensein von Ressourcen deren konfliktauslösende Wirkung verstärken oder abschwächen, und welche Rolle Ressourcenknappheit und -überfluss spielen. Sie analysiert auch die Bedeutung von Kontextfaktoren wie politische Institutionen, Armut und Geographie.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich unter anderem auf den ökonomischen Ansatz von Collier und Hoeffler, den neo-malthusianischen Ansatz und weitere relevante Theorien zur Erklärung von Ressourcenkonflikten. Die Stärken und Schwächen dieser Modelle werden kritisch bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen, Einfluss natürlicher Ressourcen auf gewaltsame Konflikte, Mangel oder Überfluss?, Rolle von natürlichen Ressourcen im gewaltsamen Konflikt, Konfliktbegünstigende Kontextfaktoren und ein empirischer Vergleich anhand von Fallstudien (DR Kongo und Botsuana).
Welche Rolle spielen Ressourcenknappheit und -überfluss?
Die Arbeit untersucht sowohl Ressourcenknappheit als auch -überfluss als potenzielle Konfliktfaktoren. Es wird analysiert, welche Mechanismen in beiden Szenarien zu Konflikten führen können und ob der eine Faktor eher konfliktauslösend ist als der andere.
Wie werden Rebellen finanziert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Mechanismen der Rebellenfinanzierung durch natürliche Ressourcen, darunter der eigene Abbau und die Direktvermarktung, Entführungen und Erpressungen sowie der Verkauf zukünftiger Abbaurechte.
Welche Kontextfaktoren werden berücksichtigt?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Kontextbedingungen wie ressourcenspezifische Eigenschaften (z.B. technischer Zugang, Illegalität), endogene Faktoren (z.B. politische Institutionen, Armut) und exogene Faktoren (z.B. Geographie, Weltwirtschaft, Fremdintervention).
Wie wird der empirische Teil der Arbeit gestaltet?
Der empirische Teil besteht aus einem Vergleich von Fallstudien aus Afrika südlich der Sahara, insbesondere dem DR Kongo (Ressourcenüberfluss und Konflikt) und Botsuana (Ressourcenüberfluss und kein Konflikt). Dieser Vergleich soll die Bedeutung der Kontextbedingungen für das Verständnis von Ressourcenkonflikten verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ressourcenkonflikte, natürliche Ressourcen, gewaltsamer Konflikt, Bürgerkrieg, Ressourcenknappheit, Ressourcenüberfluss, Rebellenfinanzierung, Kontextbedingungen, politische Institutionen, Armut, Geographie, Collier-Hoeffler-Modell, Afrika südlich der Sahara, DR Kongo, Botsuana.
- Quote paper
- M.A. Julian-G. Albert (Author), 2008, Ressourcenkonflikte und die Bedeutung der Kontextbedingungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118945