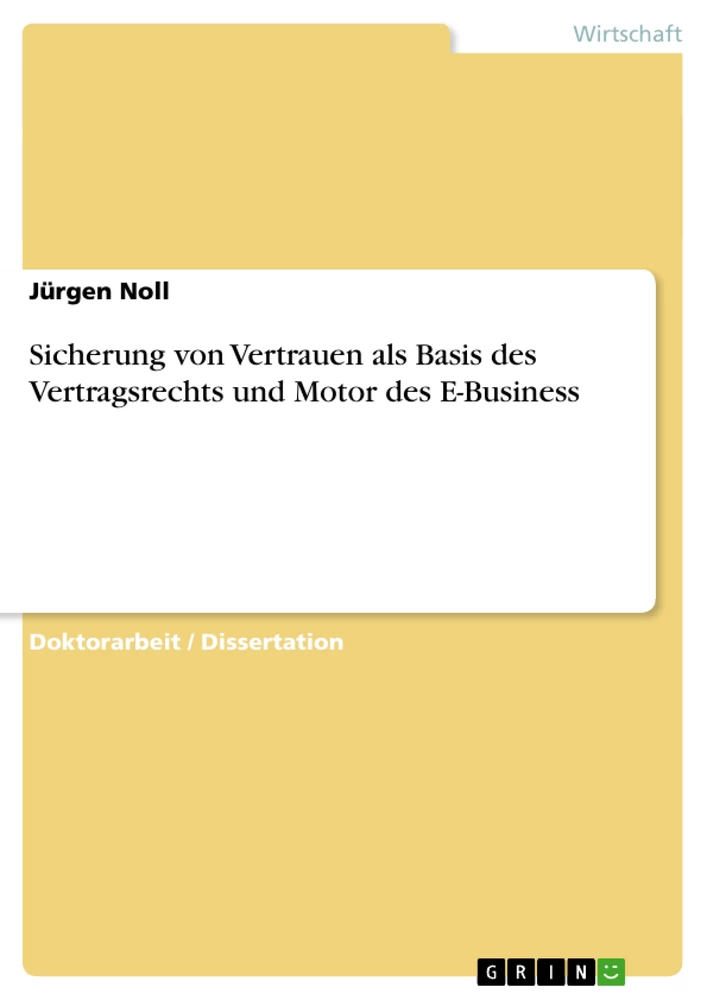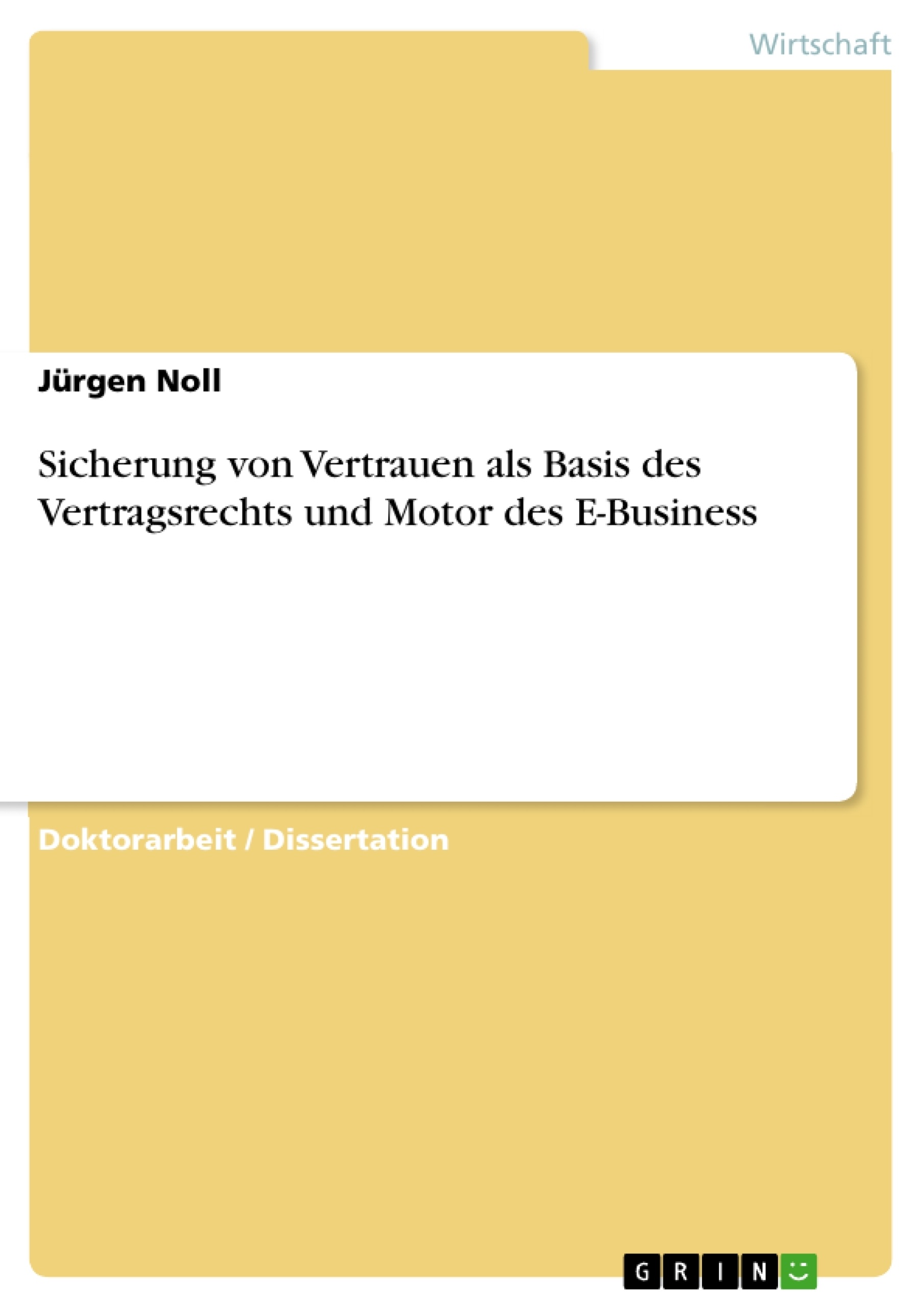Anhand einiger Gedanken zum Vertragsrecht möchte ich aufzeigen, dass das geltende Recht von dem Bestreben getragen ist, beide Arten von Vertrauen zu schützen, sowohl das nach dem Eingehen einer Geschäftsbeziehung als auch das durch Versprechen und Signale hervorgerufenes. Dabei erfolgt diese Sicherung des Vertrauens in aller Regel entweder durch direkte Handlungsanweisungen an eine Vertragsseite, die notfalls gerichtlich erzwungen werden können, oder durch die Auferlegung von Ersatzpflichten für den Fall der Verletzung einer Norm. Im Bereich des Gewährleistungsrechts, also dem Einstehenmüssen für zugesagte Qualität, gibt es bspw. solche Vorschriften, die zum Austausch bzw. der Reparatur von Gütern verpflichten. Auch in den Regeln über die Lauterkeit des Wettbewerbs (und der Werbung) manifestieren sich direkte Anweisungen. Ergänzt wird all dies durch das allgemeine Haftpflichtrecht, welches für den Fall von Schäden, die im Zuge eines Vertragsverhältnisses entstehen, sogar besondere (gläubigerfreundliche) Sonderregeln enthalten. Auswirkungen haben diese Punkte u.a. auf die richtige Wahl der Produktionsqualität, den optimalen Einsatz von Marketingmethoden und die Effizienz des Abgehens von Versprechen, d.h. Vertragsbrüchen. Daher stelle ich im ersten Hauptteil dieser Arbeit zunächst die Grundzüge des Vertragsrechts und dessen Bedeutung für den Güteraustausch dar. Danach wird der Einsatz des Rechtsinstituts der Konventionalstrafe und die letzte Novelle des Gewährleistungsrechts auf deren Auswirkungen auf die Leistungsqualität und deren Transparenz beleuchtet, wobei ebenfalls ein Vergleich mit der Verwendung anderer Werbemethoden angestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Vertrauen im Vertragsrecht
- Die Rechtslage
- Penalty-Klauseln
- Qualitätssicherung
- Gewährleistungsrecht
- Vertrauen in der neuen Wirtschaft
- E-Business
- Aufbau von Vertrauen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Konsumentenverhalten
- Virtuelle Unternehmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation befasst sich mit der Bedeutung von Vertrauen im Vertragsrecht und in der neuen Wirtschaft. Sie analysiert, wie Vertrauen als Grundlage des Vertragsrechts dient und als Motor für die Entwicklung des E-Business wirkt. Die Arbeit untersucht auch die Herausforderungen, die mit dem Aufbau von Vertrauen in der digitalen Welt verbunden sind, und bietet Lösungsansätze für die Förderung von Vertrauen in E-Commerce-Transaktionen.
- Die Rolle von Vertrauen im Vertragsrecht
- Die Auswirkungen von Vertrauensverlust auf Geschäftsbeziehungen
- Die Bedeutung von Vertrauen im E-Business
- Herausforderungen beim Aufbau von Vertrauen in der digitalen Welt
- Lösungsansätze zur Förderung von Vertrauen in E-Commerce-Transaktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Beziehung zwischen Recht und Wirtschaft sowie die Geschichte der Forschung in diesem Bereich dar. Sie beleuchtet, wie das Recht zum Schutz vor Vertrauensverlust beiträgt und langfristige Geschäftsbeziehungen fördert.
Der erste Teil der Dissertation befasst sich mit Problemen im Vertragsrecht. Er bietet einen Überblick über die Rechtslage und analysiert die Auswirkungen von Penalty-Klauseln auf Preis und Leistung. Das Kapitel untersucht auch die Rolle von Qualitätssignalen und entwickelt ein ökonomisches Modell, um die Anreize für höhere Produktionsqualität zu bestimmen. Die Ergebnisse werden auf das geltende Gewährleistungsrecht und das Recht gegen irreführende Werbung angewendet.
Der zweite Teil der Dissertation befasst sich mit vertrauensbezogenen Themen in der neuen Wirtschaft. Er stellt die wichtigsten Unterschiede zwischen der "alten" und der "neuen" Wirtschaft sowie die Management-Implikationen der neuen Wirtschaftsmerkmale dar. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Vertrauen im E-Business und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau von Vertrauen in der digitalen Welt verbunden sind.
Die Dissertation analysiert auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für E-Commerce und untersucht die aktuelle Gesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft. Sie beleuchtet das Gesetz über elektronische Signaturen und den Entwurf eines Bundesgesetzes über E-Commerce in Österreich.
Das Kapitel über Konsumentenverhalten präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie, die Unterschiede im Kaufverhalten und in der Kundenbindung zwischen traditionellen und E-Commerce-Unternehmen untersucht.
Das Konzept der virtuellen Unternehmen wird als Beispiel für neue Formen der elektronisch ermöglichten Zusammenarbeit zwischen Unternehmen vorgestellt. Die Dissertation untersucht die Gründe für die Entstehung virtueller Unternehmen und die Hindernisse für ihre zukünftige Entwicklung, wobei die Bedeutung von Vertrauen hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Vertrauen, Vertragsrecht, E-Business, E-Commerce, Neue Wirtschaft, Konsumentenverhalten, Virtuelle Unternehmen, Qualitätssignale, Gewährleistungsrecht, Penalty-Klauseln, Rechtliche Rahmenbedingungen, Europäische Gemeinschaft, Elektronische Signaturen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Vertrauen im Vertragsrecht?
Vertrauen ist die Basis für den Güteraustausch. Das Recht schützt sowohl das Vertrauen in bestehende Geschäftsbeziehungen als auch das Vertrauen, das durch Signale und Versprechen geweckt wird.
Wie sichert das Gesetz Vertrauen ab?
Dies geschieht durch direkte Handlungsanweisungen, Gewährleistungsrechte (Reparatur/Austausch) und Ersatzpflichten bei Verletzung von Normen oder Versprechen.
Was sind Penalty-Klauseln?
Penalty-Klauseln (Konventionalstrafen) sind rechtliche Instrumente, die Anreize zur Einhaltung von Qualitätsversprechen setzen und die Transparenz der Leistung erhöhen sollen.
Warum ist Vertrauen im E-Business besonders kritisch?
In der digitalen Welt fehlen oft physische Kontakte, weshalb rechtliche Rahmenbedingungen wie das Gesetz über elektronische Signaturen notwendig sind, um Sicherheit zu gewährleisten.
Was versteht man unter virtuellen Unternehmen?
Virtuelle Unternehmen sind neue Formen der elektronisch ermöglichten Zusammenarbeit, deren Erfolg massiv von gegenseitigem Vertrauen der Partner abhängt.
Gibt es Unterschiede im Kaufverhalten zwischen E-Commerce und Traditionshandel?
Ja, empirische Studien zeigen Unterschiede in der Kundenbindung und im Vertrauensaufbau, die spezifische Management-Strategien in der "neuen Wirtschaft" erfordern.
- Quote paper
- DDr. Jürgen Noll (Author), 2003, Sicherung von Vertrauen als Basis des Vertragsrechts und Motor des E-Business, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118904