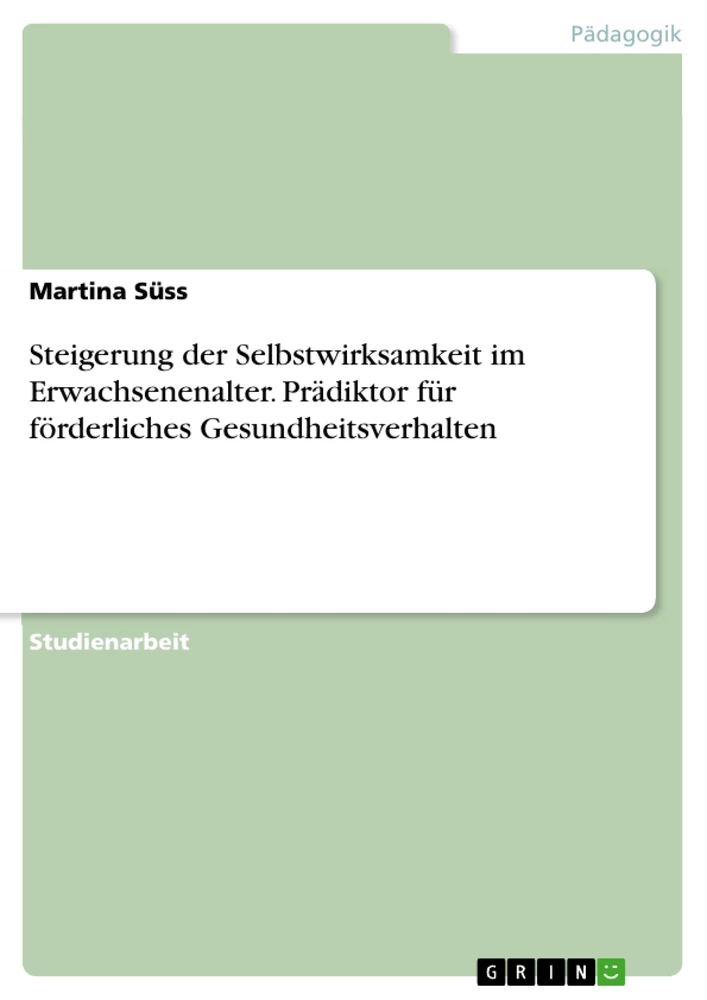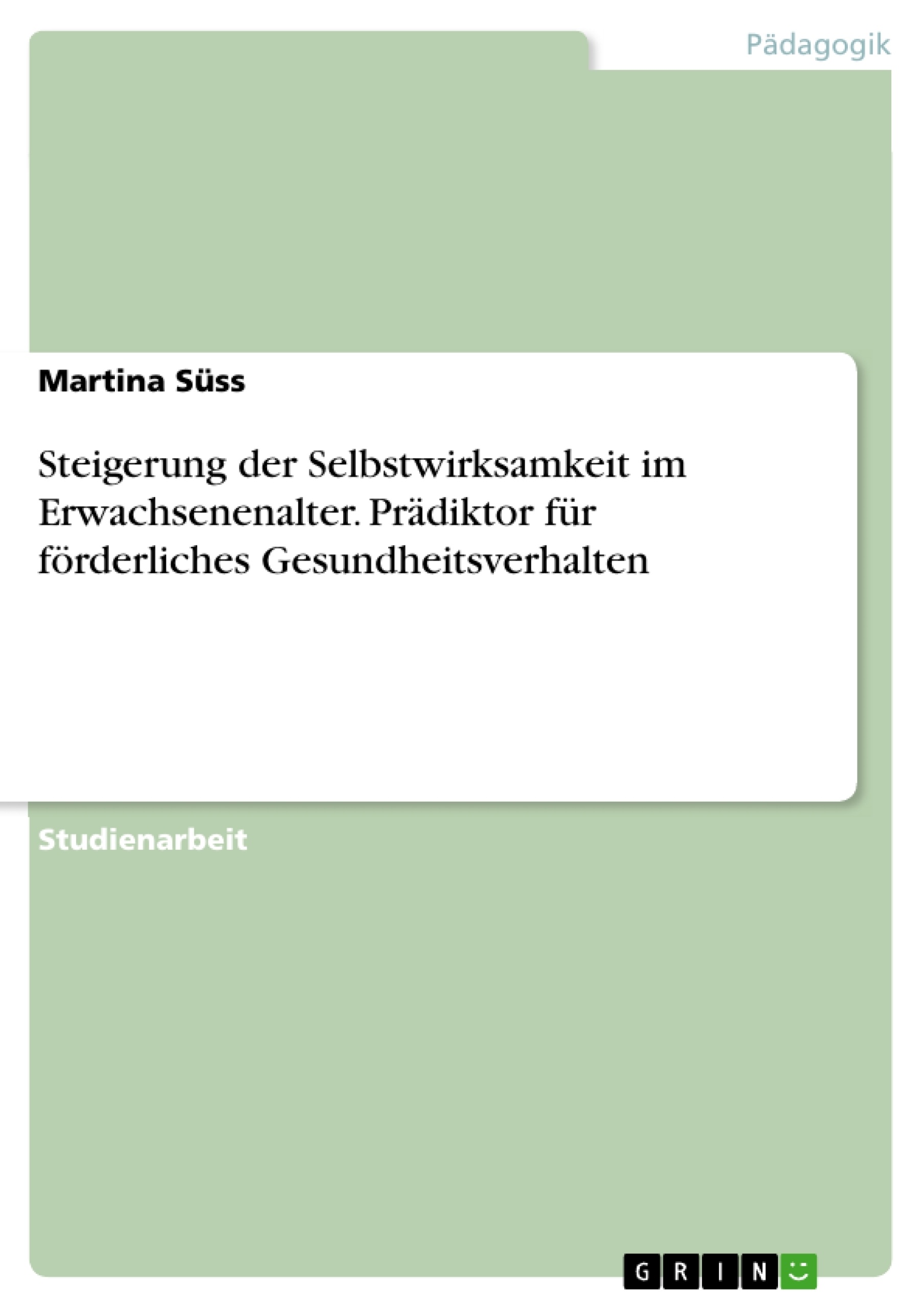In dieser Arbeit soll deshalb der Fragestellung nachgegangen werden, welche Quellen für Selbstwirksamkeit es gibt und welche Interventionsmöglichkeiten effektiv sind, um die Selbstwirksamkeit im Erwachsenenalter zu fördern, und ob diese Steigerung der Selbstwirksamkeit positives Gesundheitshandeln zur Folge hat.
Zuallererst soll hierfür die Relevanz für die Psychologie dargestellt und der Begriff der Selbstwirksamkeit definiert werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Arbeit von Albert Bandura, der das Konstrukt der Selbstwirksamkeit maßgeblich geprägt hat. Auch bedarf es einer Definition, was unter "förderlichem Gesundheitsverhalten" verstanden wird. In dieser Arbeit wird primär die Erhaltung und Förderung von Gesundheit, und nicht die Heilung von Krankheit betrachtet, also somit eine salutogenetische Sichtweise eingenommen. Auf die Zusammenhänge von Selbstwirksamkeit und Gesundheitshandeln wird in den darauffolgenden Abschnitten eingegangen, sowie die möglichen Quellen von Selbstwirksamkeit dargestellt. Selbstwirksamkeitsfördernde Interventionsmaßnahmen werden im letzten Abschnitt auf Basis der aktuellen Studienlage vorgestellt. Abschließend wird ein Fazit aus den zentralen Ergebnissen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärung und Relevanz
- 2.1 Definition von Selbstwirksamkeit
- 2.2 Gesundheitsförderliche Verhaltensweisen
- 3 Die Wirkung von Selbstwirksamkeit auf Gesundheitsverhalten
- 3.1 Studienlage zu Selbstwirksamkeit und gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen
- 3.2 Studienlage zu Selbstwirksamkeit im Zusammenhang mit anderen gesundheitsbezogenen Faktoren
- 4 Quellen für Selbstwirksamkeit
- 4.1 Eigene Erfahrungen
- 4.2 Stellvertretende Erfahrungen
- 4.3 Persuasive Botschaften
- 4.4 Physiologische Reaktionen
- 5 Interventionen zur Förderung von Selbstwirksamkeit
- 5.1 Aktive Interventionen
- 5.2 Passive Interventionen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Selbstwirksamkeit auf gesundheitsförderliches Verhalten im Erwachsenenalter. Sie beleuchtet die Quellen von Selbstwirksamkeit und stellt Interventionsmöglichkeiten zur Steigerung derselben vor. Das Hauptziel ist es, den Zusammenhang zwischen erhöhter Selbstwirksamkeit und positivem Gesundheitsverhalten zu erforschen.
- Definition und Relevanz von Selbstwirksamkeit
- Gesundheitsförderliche Verhaltensweisen und deren Bedeutung
- Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und gesundheitsförderlichem Verhalten
- Quellen der Selbstwirksamkeit
- Interventionen zur Förderung von Selbstwirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bedeutung von Gesundheit im Erwachsenenalter ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss von Selbstwirksamkeit auf gesundheitsförderliches Verhalten. Sie hebt die Diskrepanz zwischen vorhandenem Wissen über gesundheitsförderliche Maßnahmen und deren Umsetzung hervor und benennt Albert Banduras Konzept der Selbstwirksamkeit als zentralen Erklärungsansatz. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die einzelnen Kapitel.
2 Begriffserklärung und Relevanz: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Selbstwirksamkeit nach Bandura und erläutert seine Relevanz in der Gesundheitspsychologie. Es wird der Fokus auf die salutogenetische Perspektive gelegt, also die Erhaltung und Förderung von Gesundheit statt Krankheit. Zudem werden gesundheitsförderliche Verhaltensweisen definiert und mit empirischen Befunden belegt. Das Kapitel betont den Einfluss von Überzeugungen, insbesondere der Selbstwirksamkeitserwartung, auf die Verhaltensänderung.
2.1 Definition von Selbstwirksamkeit: Dieser Abschnitt vertieft die Definition von Selbstwirksamkeit nach Bandura, betont ihre Rolle in Banduras sozial-kognitiver Theorie und ihren Einfluss auf Motivation, Ausdauer und Zielsetzung. Es wird der Unterschied zwischen tatsächlichen Fähigkeiten und der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit hervorgehoben. Die Verwendung des "General Self-Efficacy Scale" zur Messung von Selbstwirksamkeit wird ebenfalls erläutert.
2.2 Gesundheitsförderliche Verhaltensweisen: Dieser Abschnitt beschreibt gesundheitsförderliche Verhaltensweisen basierend auf der Definition der WHO und weiteren wissenschaftlichen Studien. Er benennt Beispiele wie Rauchverzicht, moderater Alkoholkonsum, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und die Aufrechterhaltung eines normalen Körpergewichts, und unterstreicht die positive Korrelation zwischen diesen Verhaltensweisen und einer erhöhten Lebenserwartung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Selbstwirksamkeit auf gesundheitsförderliches Verhalten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Selbstwirksamkeit auf gesundheitsförderliches Verhalten im Erwachsenenalter. Sie beleuchtet die Quellen von Selbstwirksamkeit und stellt Interventionsmöglichkeiten zur Steigerung derselben vor. Das Hauptziel ist es, den Zusammenhang zwischen erhöhter Selbstwirksamkeit und positivem Gesundheitsverhalten zu erforschen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Relevanz von Selbstwirksamkeit, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen und deren Bedeutung, den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und gesundheitsförderlichem Verhalten, Quellen der Selbstwirksamkeit und Interventionen zur Förderung von Selbstwirksamkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffserklärung und Relevanz (inkl. Definition von Selbstwirksamkeit und gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen), Die Wirkung von Selbstwirksamkeit auf Gesundheitsverhalten (inkl. Studienlage), Quellen für Selbstwirksamkeit (eigene Erfahrungen, stellvertretende Erfahrungen, persuasive Botschaften, physiologische Reaktionen), Interventionen zur Förderung von Selbstwirksamkeit (aktive und passive Interventionen) und Fazit.
Was wird unter Selbstwirksamkeit verstanden?
Selbstwirksamkeit, nach Bandura, beschreibt die Überzeugung einer Person, dass sie in der Lage ist, bestimmte Handlungen erfolgreich auszuführen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Die Arbeit betont den Unterschied zwischen tatsächlichen Fähigkeiten und der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit und erläutert die Verwendung des "General Self-Efficacy Scale" zur Messung.
Welche gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet gesundheitsförderliche Verhaltensweisen basierend auf der Definition der WHO und weiteren Studien. Beispiele sind Rauchverzicht, moderater Alkoholkonsum, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und die Aufrechterhaltung eines normalen Körpergewichts. Der positive Zusammenhang dieser Verhaltensweisen mit einer erhöhten Lebenserwartung wird hervorgehoben.
Welche Quellen für Selbstwirksamkeit werden genannt?
Die Arbeit nennt vier Quellen für Selbstwirksamkeit: eigene Erfahrungen, stellvertretende Erfahrungen (Beobachtung anderer), persuasive Botschaften (Überzeugung und Ermutigung) und physiologische Reaktionen (körperliche Zustände).
Welche Interventionsmöglichkeiten zur Steigerung der Selbstwirksamkeit werden vorgestellt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen aktiven und passiven Interventionen zur Förderung von Selbstwirksamkeit. Konkrete Beispiele für die Interventionen werden jedoch nicht detailliert genannt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit der Arbeit wird im Text nicht explizit zusammengefasst. Es wird jedoch deutlich, dass der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und gesundheitsförderlichem Verhalten im Mittelpunkt steht und die Arbeit Interventionen zur Steigerung der Selbstwirksamkeit zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens empfiehlt.
- Citation du texte
- Martina Süss (Auteur), 2022, Steigerung der Selbstwirksamkeit im Erwachsenenalter. Prädiktor für förderliches Gesundheitsverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188768