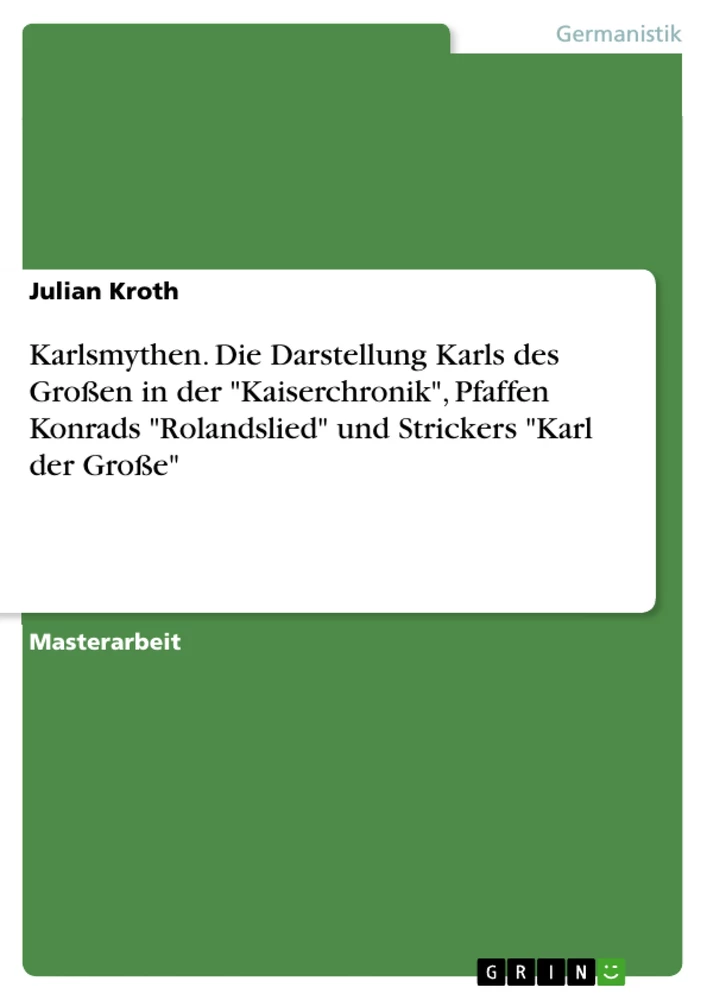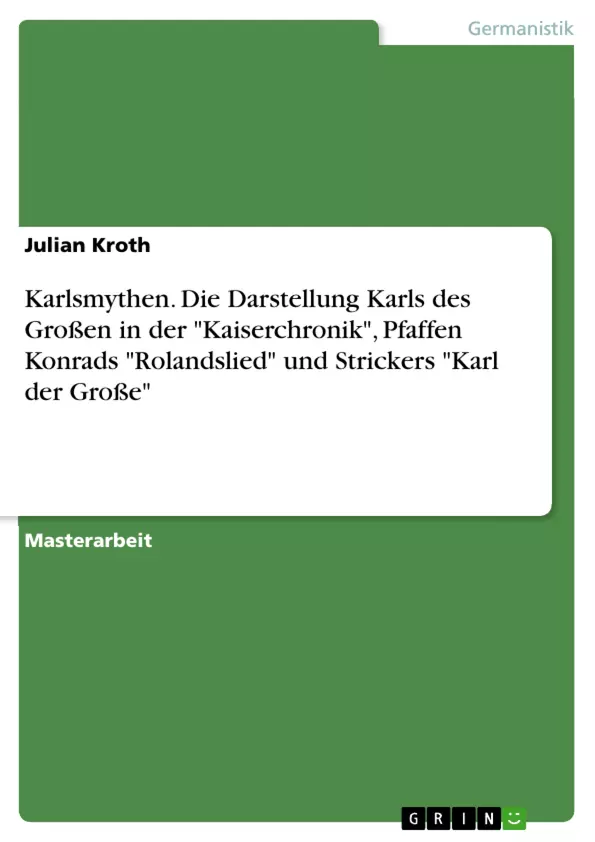Sowohl das Ausmaß der mittelalterlichen Karlsverehrung als auch die Verbreitung des Karlskultes werfen die Frage danach auf, wie ein derart ausgestalteter Karlsmythos eine solche Verbreitung erfahren konnte. In dieser Hinsicht müssen vor allem zwei Faktoren benannt werden: die Darstellung Karls in der lateinischen Literatur und die mündliche Überlieferungstradition in den Jahrhunderten nach seinem Tod. Neben dieser lateinischen Literatur über Karl den Großen entwickelte sich im europäischen Raum zudem eine vielfältige volkssprachliche Karlsliteratur. Diese existierte seit dem frühen 12. Jahrhundert neben der supranationalen Literatur, wobei sie zwar enorm vom lateinischen Schrifttum beeinflusst wurde, zugleich aber auch zumindest in Teilen unterschiedliche Karlsbilder zeichnete. Die volkssprachliche – und damit auch die deutschsprachige – Literatur des Mittelalters richtete sich zwar auch an Schriftkundige, hauptsächlich wurde sie aber als Vortrag laut vorgelesen, wodurch diese Stoffe erstmals auch einem weniger gebildeten, d.h. nicht lateinischsprachigen, Publikum zugänglich gemacht wurden. Aus dieser Tatsache ergibt sich auch das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit, welchen Beitrag die deutschsprachige Karlsliteratur zur Etablierung sowie Entwicklung des hochmittelalterlichen Karlsmythos im 12. und 13. Jahrhundert geleistet hat.
Zur Beantwortung dieser Frage sollen im Rahmen der Untersuchungen drei bedeutsame mittelhochdeutsche Werke, in denen die Figur Karls des Großen eine zentrale Stellung einnimmt, exemplarisch untersucht und miteinander verglichen werden: die "Kaiserchronik", das "Rolandslied" sowie "Karl der Große". Die zentrale These, die dieser Arbeit zugrunde liegt, ist die, dass sich die drei zu untersuchenden Werke – trotz unterschiedlicher Entstehungszeiträume und zum Teil auch Gattungen – in der Art ihrer Darstellung Karls des Großen gegenseitig beeinflusst und somit zur Entwicklung und Etablierung des zeitgenössischen (hoch-)mittelalterlichen Karlsmythos beigetragen haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Karlsbild des deutschsprachigen Kulturraums im 12. und 13. Jahrhundert
- 3. Ursprung und Verbreitung der Texte: Überlieferungssituation
- 4. Vergleichende Untersuchung der Darstellung Karls des Großen in der Kaiserchronik, dem Rolandslied und Karl der Große
- 4.1 Die Bedeutung der Person Karls des Großen für das jeweilige Werk
- 4.1.1 Die Kaiserchronik
- 4.1.2 Das Rolandslied des Pfaffen Konrad
- 4.1.3 Strickers Karl der Große
- 4.2 Karls Verhältnis zu Gott
- 4.2.1 Das Erscheinen von Engeln als Zeichen der göttlichen Unterstützung
- 4.2.2 Die wundersame Erhörung der Gebete Karls
- 4.2.3 Karl als Kreuzritter und Märtyrer
- 4.2.4 Von gotes dienestman zu sante Karle – Die Darstellung der Heiligkeit Karls
- 4.3 Das Herrschermodell Karls: Im Spannungsfeld zwischen roi souffrant und miles Christi
- 4.3.1 Kaiserchronik
- 4.3.2 Rolandslied
- 4.3.3 Karl der Groß
- 4.1 Die Bedeutung der Person Karls des Großen für das jeweilige Werk
- 5. Referenzbeziehungen: Gegenseitige Beeinflussung und intertextuelle Bezüge
- 5.1 Die Möglichkeiten mittelalterlicher „,Beeinflussung“: Intertextualität als Zugang zu Texten und ihren Vorgängern
- 5.2 Motivische Verschränkungen zwischen den Werken als Intertextualitäts-Marker
- 6. Fazit: Die Bedeutung der deutschsprachigen Karlsliteratur für die Etablierung des mittelalterlichen Karlsmythos
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung Karls des Großen in drei deutschsprachigen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts – der Kaiserchronik, dem Rolandslied des Pfaffen Konrad und Strickers Karl der Große. Ziel ist es, die jeweiligen Karlsbilder zu vergleichen und zu analysieren, wie sie die historische Figur des Frankenkaisers zum „Archetyp eines christlichen Herrschers“ stilisieren.
- Das Karlsbild in der deutschsprachigen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts
- Vergleichende Analyse der Darstellung Karls in der Kaiserchronik, dem Rolandslied und Karl der Große
- Die Rolle des Karlsmythos in der Etablierung des christlichen Herrscherideals
- Intertextuelle Beziehungen zwischen den drei Texten
- Die Bedeutung der mündlichen Überlieferungstradition für die Entwicklung des Karlsbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und beleuchtet die bleibende Bedeutung des Karlsmythos in der heutigen Zeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit der historischen und kulturellen Bedeutung Karls des Großen im deutschsprachigen Raum während des 12. und 13. Jahrhunderts. Das dritte Kapitel analysiert den Ursprung und die Verbreitung der untersuchten Texte, die Kaiserchronik, das Rolandslied des Pfaffen Konrad und Strickers Karl der Große, und beschreibt die Herausforderungen der Überlieferungssituation. Das vierte Kapitel befasst sich mit den jeweiligen Darstellungen des Karlsbildes in den drei Werken und untersucht die Bedeutung der Figur für die Handlung und die zentralen Themen, sowie das Verhältnis Karls zu Gott. Das fünfte Kapitel untersucht die intertextuellen Beziehungen zwischen den drei Werken und analysiert die Möglichkeiten der gegenseitigen Beeinflussung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung Karls des Großen in der deutschsprachigen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts, insbesondere mit der Kaiserchronik, dem Rolandslied des Pfaffen Konrad und Strickers Karl der Große. Die Arbeit analysiert das Karlsbild in diesen Texten im Kontext des christlichen Herrscherideals, der mündlichen Überlieferung und der intertextuellen Beziehungen zwischen den Werken. Die wichtigsten Themen sind die Heiligkeit Karls, sein Verhältnis zu Gott, die Legitimität seiner Herrschaft, die Rolle des Kaisers in der mittelalterlichen Gesellschaft und die Bedeutung des Karlsmythos für die europäische Kulturgeschichte.
- Citar trabajo
- Julian Kroth (Autor), 2022, Karlsmythen. Die Darstellung Karls des Großen in der "Kaiserchronik", Pfaffen Konrads "Rolandslied" und Strickers "Karl der Große", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188364