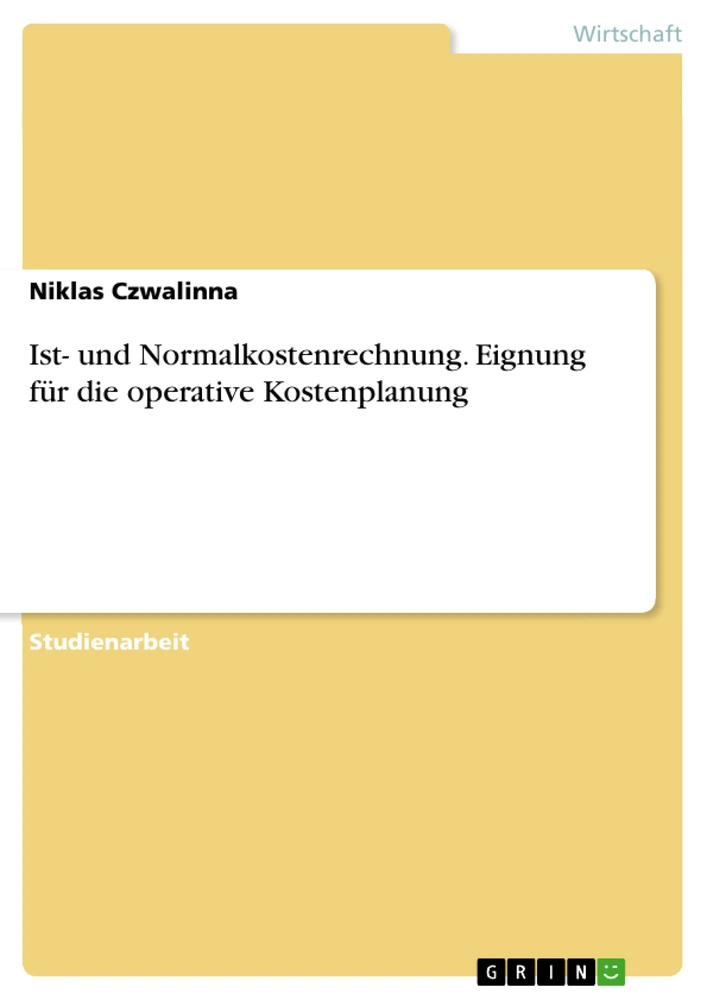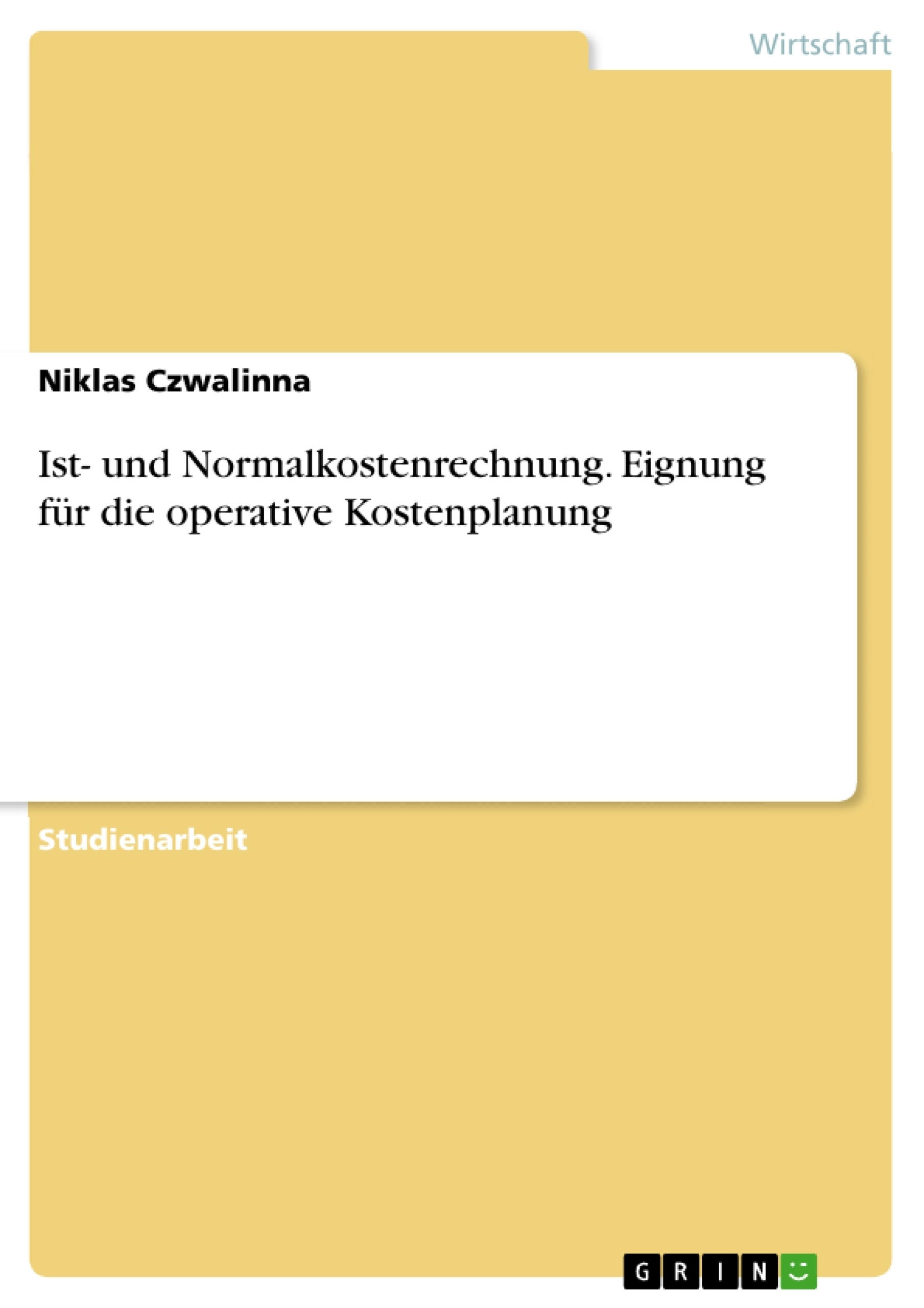Diese Arbeit untersucht, inwieweit die Ist- und Normalkostenrechnung für die operative Kostenplanung geeignet ist. Für die erfolgreiche Erfüllung der wirtschaftlichen Ziele ist es nutzbringend, die Aktivitäten eines Unternehmens zu planen. Aus diesem Grund werden in Unternehmen alle wesentlichen Aktivitäten und Bereiche geplant. Im Rahmen der Planung nimmt die Kostenplanung eine zentrale Rolle ein, da diese den Rahmen legt, ,,[…] in den sich alle anderen geplanten Maßnahmen [des Unternehmens] unerbittlich einfügen müssen“. Eine operative Kostenplanung kann auf der Basis der Daten des internen Rechnungswesens durchgeführt werden.
Hierfür stehen dem Anwender eine Vielzahl unterschiedlicher Kostenrechnungssysteme zur Verfügung. Insbesondere den Ist- und Normalkostenrechnungssystemen in der betrieblichen Praxis wird eine große Bedeutung zugeschrieben. Einführend erfolgt eine kurze Darstellung der Kostenrechnungssysteme und eine Differenzierung dieser nach Zeit und Umfang. Im Anschluss daran werden die Ist- und die Normalkostenrechnung vorgestellt. Hierbei wird zunächst auf den Aufbau und die Anwendungsmöglichkeiten dieser beide Systeme eingegangen. Darauffolgend werden einige grundlegende Nachteile erläutert, die mit einer Verwendung der Ist- oder Normalkostenrechnung einhergehen.
Anschließend erfolgt eine kritische Würdigung hinsichtlich deren Eignung für eine operative Kostenplanung. Dem grundlegenden Aufbau einer Kostenrechnung wird dadurch Rechnung getragen, dass bei der Beschreibung der Istkostenrechnung zunächst die Begrifflichkeiten Kostenarten-, Kostenstellen-, und Kostenträgerrechnung erläutert werden. Die Hausarbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Fazit. Hier werden die wesentlichen Aussagen der Hausarbeit zusammengefasst und die Problemstellung beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Wesentliche Erläuterungen zur Problemstellung
- 2. Kostenrechnungssysteme
- 2.1 Zeitbezogene Kostenrechnungssysteme
- 2.2 Umfangbezogene Kostenrechnungssysteme
- 3. Die Istkostenrechnung
- 3.1 Kostenartenrechnung
- 3.2 Kostenstellenrechnung
- 3.3 Kostenträgerrechnung
- 3.4 Potential der Istkostenrechnung
- 3.5 Kritik an der Istkostenrechnung
- 3.6 Eignung für die operative Kostenplanung
- 4. Normalkostenrechnung
- 4.1 Starre Normalkostenrechnung
- 4.2 Flexible Normalkostenrechnung
- 4.3 Potential der Normalkostenrechnung
- 4.4 Kritik an der Normalkostenrechnung
- 4.5 Eignung für die operative Kostenplanung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Ist- und Normalkostenrechnung für die operative Kostenplanung. Sie analysiert die Stärken und Schwächen beider Systeme im Detail und bewertet ihre Anwendbarkeit in der Praxis. Der Fokus liegt auf der Klärung, inwiefern diese Systeme den Anforderungen einer zukunftsorientierten Kostenplanung gerecht werden.
- Vergleich von Ist- und Normalkostenrechnung
- Analyse der Stärken und Schwächen beider Systeme
- Bewertung der Eignung für die operative Kostenplanung
- Untersuchung der jeweiligen Aufbau- und Funktionsweise
- Kritik und Potential der beiden Kostenrechnungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Kostenplanung ein und erläutert die zentrale Rolle der Kostenplanung für die Erreichung wirtschaftlicher Unternehmensziele. Es wird die Problemstellung definiert – die Bewertung der Eignung von Ist- und Normalkostenrechnung für operative Kostenplanung – und der Aufbau der Arbeit skizziert. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Verständnis des Begriffs „operative Kostenplanung“ gewidmet, die Kosten für einen Zeitraum bis zu einem Jahr im Voraus plant.
2. Kostenrechnungssysteme: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Kostenrechnungssysteme und differenziert sie nach Zeit- und Umfangsbezug. Es werden zeitbezogene Systeme wie Ist-, Normal- und Plankostenrechnung vorgestellt, wobei der Unterschied zwischen Istkostenrechnung (tatsächliche Kosten) und Normalkostenrechnung (durchschnittliche Kosten) herausgestellt wird. Der Umfangsbezug wird anhand von Voll- und Teilkostensystemen erläutert, die sich in der Art und Weise der Kostenverrechnung unterscheiden.
3. Die Istkostenrechnung: Dieses Kapitel beschreibt die Istkostenrechnung, die auf der Erfassung und Verteilung tatsächlicher Kosten basiert. Es werden die drei Stufen der Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) detailliert erläutert. Die Vor- und Nachteile der Istkostenrechnung werden diskutiert, wobei die Schwerfälligkeit des Systems und die Schwierigkeiten bei der Kostenkontrolle hervorgehoben werden. Schließlich wird die Eignung für operative Kostenplanung kritisch bewertet, wobei der eindeutige Vergangenheitsbezug und die Schwierigkeiten der Vorkalkulation hervorgehoben werden.
4. Normalkostenrechnung: Das Kapitel erklärt die Normalkostenrechnung, die im Gegensatz zur Istkostenrechnung normalisierte Größen verwendet. Die starre und flexible Normalkostenrechnung werden unterschieden, wobei die flexible Variante eine genauere Analyse von Kostenabweichungen ermöglicht. Die Vor- und Nachteile des Systems werden diskutiert, einschließlich der Vereinfachung der Kostenverrechnung und der Schwierigkeiten bei der genauen Nachkalkulation und Analyse von Kostenabweichungen. Die Eignung für operative Kostenplanung wird kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Istkostenrechnung, Normalkostenrechnung, operative Kostenplanung, Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Vollkostenrechnung, Normalisierte Kosten, Plankosten, Wirtschaftlichkeitskontrolle, Kostenabweichungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Kostenrechnung: Ist- und Normalkostenrechnung in der operativen Kostenplanung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Ist- und Normalkostenrechnung für die operative Kostenplanung. Sie analysiert detailliert die Stärken und Schwächen beider Systeme und bewertet ihre praktische Anwendbarkeit. Der Fokus liegt darauf, zu klären, inwiefern diese Systeme den Anforderungen einer zukunftsorientierten Kostenplanung gerecht werden.
Welche Kostenrechnungssysteme werden behandelt?
Die Arbeit behandelt im Wesentlichen zwei Kostenrechnungssysteme: die Istkostenrechnung und die Normalkostenrechnung. Zusätzlich wird ein Überblick über verschiedene Kostenrechnungssysteme gegeben, differenziert nach Zeit- und Umfangsbezug (z.B. zeitbezogen: Ist-, Normal-, Plankostenrechnung; Umfangsbezug: Voll- und Teilkostensysteme).
Was ist die Istkostenrechnung und welche Vor- und Nachteile hat sie?
Die Istkostenrechnung basiert auf der Erfassung und Verteilung tatsächlicher Kosten. Sie umfasst die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Vorteile liegen in der Genauigkeit der tatsächlichen Kosten. Nachteile sind die Schwerfälligkeit des Systems, Schwierigkeiten bei der Kostenkontrolle und der eindeutige Vergangenheitsbezug, was sie für die operative Kostenplanung weniger geeignet macht.
Was ist die Normalkostenrechnung und welche Vor- und Nachteile hat sie?
Die Normalkostenrechnung verwendet im Gegensatz zur Istkostenrechnung normalisierte Größen. Sie wird unterschieden in starre und flexible Normalkostenrechnung, wobei die flexible Variante eine genauere Analyse von Kostenabweichungen ermöglicht. Vorteile sind die Vereinfachung der Kostenverrechnung. Nachteile sind Schwierigkeiten bei der genauen Nachkalkulation und Analyse von Kostenabweichungen.
Wie werden Ist- und Normalkostenrechnung in der operativen Kostenplanung verglichen?
Die Arbeit vergleicht beide Systeme hinsichtlich ihrer Eignung für die operative Kostenplanung. Sie analysiert die Stärken und Schwächen beider Systeme im Detail und bewertet ihre Anwendbarkeit in der Praxis, unter Berücksichtigung des Unterschieds zwischen der Erfassung tatsächlicher Kosten (Istkostenrechnung) und der Verwendung normalisierter Größen (Normalkostenrechnung).
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Istkostenrechnung, Normalkostenrechnung, operative Kostenplanung, Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Vollkostenrechnung, normalisierte Kosten, Plankosten, Wirtschaftlichkeitskontrolle und Kostenabweichungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu verschiedenen Kostenrechnungssystemen, Kapitel zur detaillierten Beschreibung und Analyse der Ist- und Normalkostenrechnung, sowie eine Zusammenfassung. Die Einleitung definiert die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit, wobei der Begriff „operative Kostenplanung“ (Kostenplanung für einen Zeitraum bis zu einem Jahr im Voraus) erläutert wird.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Praktiker im Bereich Kostenrechnung und alle, die sich mit der operativen Kostenplanung und dem Vergleich von Ist- und Normalkostenrechnung auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Niklas Czwalinna (Autor), 2022, Ist- und Normalkostenrechnung. Eignung für die operative Kostenplanung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188077