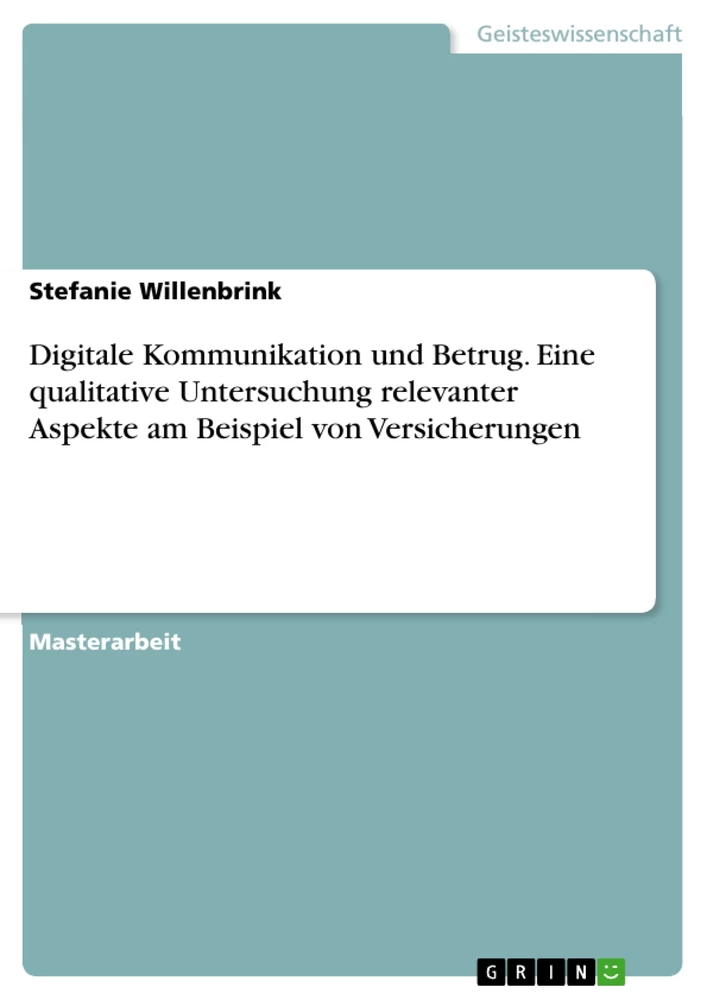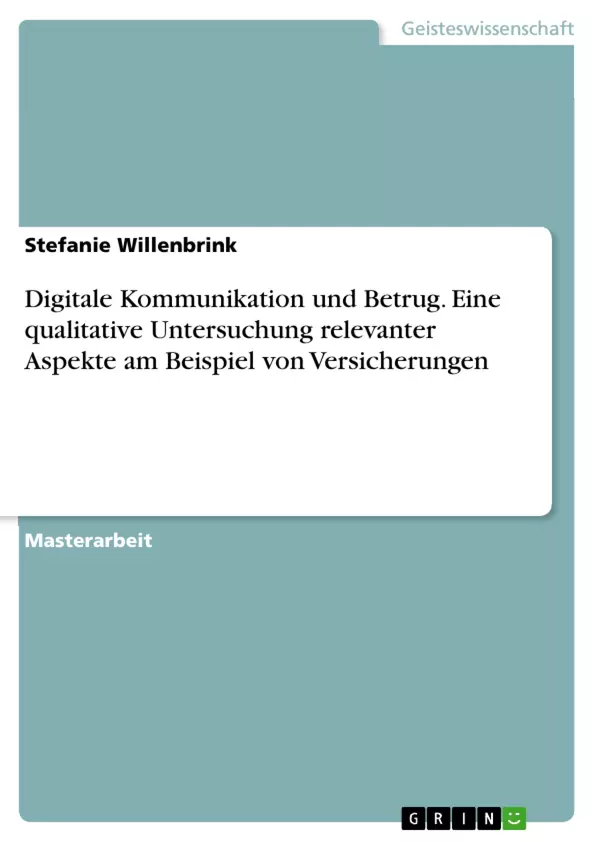Nach einfachem Diebstahl ist Betrug die am häufigsten begangene Straftat in Deutschland. Ziel dieser Arbeit ist es, kriminologische und psychologische Erkenntnisse zum Phänomen Betrug um die Aspekte der digitalen Kommunikation zu ergänzen und so einen ersten Ausblick zu wagen, welche Herausforderungen die zunehmende Digitalisierung für die Betrugsbekämpfung und Betrugsprävention erwarten lässt und wie diesen Herausforderungen adäquat begegnet werden kann.
Zunächst wird eine Einführung in gängige Kommunikationsmodelle der aktuellen Forschung gegeben, die auf die Neuordnung durch die in den letzten Jahrzehnten eingesetzte digitale Transformation angewendet werden. Weiterhin erfolgt ein psychosoziale Einordnung des Phänomens Betrug anhand bestehender Studien und Literatur zu Betrugsmustern und Betrugsmotivationen. Schließlich werden die Erkenntnisse der Kommunikationspsychologie auf das Phänomen Betrug hinsichtlich Betrugserkennung und Betrugsprävention angewendet.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen können mögliche präventive und repressive kommunikative Maßnahmen abgeleitet werden, die die Grundlage für einen Handlungsleitfaden für Betrugsbekämpfung im digitalen Zeitalter bilden können.
Die bisherige Forschung zu dem Thema hat sich maßgebliche auf kriminogene und wirtschaftliche Faktoren des Betrugs fokussiert und bietet keine Antworten auf die Frage der Relevanz des digitalen Wandels für den Betrug. Psychologische Faktoren, insbesondere Faktoren der Kommunikationspsychologie und der Nutzung digitaler Kommunikationskanäle blieben in dem Zusammenhang bisher weitestgehend unberücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Ausgangssituation und Problemstellung
- Zielsetzung
- Forschungsfragen
- Zielgruppe der Forschungsarbeit
- Methode und Aufbau der Arbeit
- Begriffsabgrenzung
- Digitale Transformation
- Face-to-Face Kommunikation (FtF)
- Medienvermittelte Kommunikation (mvK)
- Betrug
- Theoretische Grundlagen und Reflexion der bestehenden Literatur
- Face-to-Face Kommunikation
- Überblick über eine Auswahl gängiger Kommunikationsmodelle
- Integratives Kommunikationsmodell nach Hargie & Dickson (2004)
- Kommunikationsformen und ihre Mittel
- Interpersonelle Kommunikationsformen
- Verbale Kommunikationsmittel
- Nonverbale Kommunikationsmittel
- Medienvermittelte Kommunikation
- Unterschiede der medienvermittelten zur Face-to-Face Kommunikation
- Aspekte und Theorien medienvermittelten Kommunikationsverhaltens
- Medienwahl
- Interpersonales Verhalten und soziale Phänomene in der medienvermittelten Kommunikation
- Betrug
- Betrugsmodelle
- Allgemeine Aspekte der betrugshandelnden Persönlichkeit
- Typische TäterInnenprofile
- Das Fraud-Triangle und die Dunkle Triade
- Motivationsaspekte für Betrug
- Muster des Betrugs
- Face-to-Face Kommunikation
- Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen
- Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse
- Forschungsdesign, Zielgruppe und Forschungsziel
- Sampling / Stichprobenauswahl
- Erhebungsmethode
- Qualitätssicherung / Gütekriterien
- Interviewleitfaden und Aufbau des Interviews
- Datenauswertung und Kategorienbildung
- Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse
- Kategorie 1 (K1) - Angaben zur Dubiosschadenbearbeitung
- Kategorie 2 (K2) - Medienvermittelte Kommunikation
- Kategorie 3 (K3) – Digitale Medien
- Kategorie 4 (K4) - Face-to-Face Kommunikation
- Kategorie 5 (K5) – Einfluss der Gruppengröße auf die Wahl des Kommunikationswegs
- Kategorie 6 (K6) – Wandel der Betrugssachbearbeitung durch Digitalisierung
- Kategorie 7 (K7) – Formen des Betrugs
- Kategorie 8 (K8) – Persönlichkeits-Typen des Betrugs
- Kategorie 9 (K9) – Betrugsfaktoren
- Kategorie 10 (K10) – Rechtfertigungsfaktoren
- Kategorie 11 (K11) – Faktoren der Betrugsbekämpfung und Betrugsprävention
- Kategorie 12 (K12) – Grundsätzliche Einstellung zu Versicherungsbetrug
- Kategorie 13 (K13) – Grundsätzliche Einstellung zum Einfluss medienvermittelter Kommunikation auf Betrug
- Forschungsdesign, Zielgruppe und Forschungsziel
- Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die bestehende kriminologische und psychologische Forschung zum Thema Betrug um die Aspekte der digitalen Kommunikation zu erweitern. Sie untersucht, welche Herausforderungen die zunehmende Digitalisierung für die Betrugsbekämpfung und Betrugsprävention mit sich bringt und wie diesen Herausforderungen adäquat begegnet werden kann.
- Einfluss digitaler Kommunikation auf Betrug
- Herausforderungen für die Betrugsbekämpfung und Betrugsprävention im digitalen Zeitalter
- Kommunikationsverhalten im Zusammenhang mit Betrug
- Psychologische Faktoren des Betrugs
- Relevanz der digitalen Transformation für Betrug
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Ausgangssituation und Problemstellung, wobei die Zielsetzung und Forschungsfragen definiert werden. Es folgt eine Begriffsabgrenzung, in der wichtige Begriffe wie „digitale Transformation“, „Face-to-Face Kommunikation“ und „Medienvermittelte Kommunikation“ sowie „Betrug“ erläutert werden. Im Anschluss werden die theoretischen Grundlagen und die bestehende Literatur zum Thema Betrug, Kommunikation und Digitalisierung beleuchtet.
Im empirischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse einer qualitativen Studie vorgestellt, die durch leitfadengestützte Interviews mit Personen aus der Dubiosschadenbearbeitung verschiedener deutscher Versicherungsgesellschaften gewonnen wurden. Die Ergebnisse werden in verschiedene Kategorien gegliedert und analysiert, um die Relevanz der digitalen Kommunikation für Betrug, Betrugsbekämpfung und Betrugsprävention zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Betrug, digitale Kommunikation, Medienvermittelte Kommunikation, Face-to-Face Kommunikation, Betrugsbekämpfung, Betrugsprävention, Versicherungen, Dubiosschadenbearbeitung, qualitative Forschung, Leitfadengestützte Interviews und digitale Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die digitale Kommunikation das Phänomen Betrug?
Die Digitalisierung schafft neue Kanäle (medienvermittelte Kommunikation), die herkömmliche Betrugsmuster verändern und die Identifizierung von Tätern sowie die Betrugserkennung erschweren.
Was ist das "Fraud-Triangle" im Kontext dieser Arbeit?
Das Betrugsdreieck beschreibt drei Faktoren, die zu Betrug führen: Gelegenheit, Motivation (Druck) und Rechtfertigung. Die Arbeit ergänzt dies um Aspekte der "Dunklen Triade".
Welche Rolle spielt die Dubiosschadenbearbeitung bei Versicherungen?
Sie ist die zentrale Abteilung zur Untersuchung verdächtiger Versicherungsfälle. Die Arbeit nutzt Experteninterviews aus diesem Bereich, um den Wandel durch Digitalisierung zu analysieren.
Was unterscheidet medienvermittelte Kommunikation von Face-to-Face-Gesprächen beim Betrug?
In der digitalen Kommunikation fehlen oft nonverbale Signale, was Tätern die Täuschung erleichtern kann, während gleichzeitig digitale Spuren für die Prävention genutzt werden können.
Welche psychologischen Faktoren motivieren zu Versicherungsbetrug?
Neben wirtschaftlicher Not spielen oft Rechtfertigungsfaktoren (z.B. "die Versicherung ist reich") und bestimmte Persönlichkeitstypen eine entscheidende Rolle.
Wie können Versicherungen Betrug im digitalen Zeitalter besser bekämpfen?
Durch die Anwendung kommunikationspsychologischer Erkenntnisse auf digitale Kanäle und die Entwicklung neuer Handlungsleitfäden für die Betrugsprävention.
- Quote paper
- Stefanie Willenbrink (Author), 2020, Digitale Kommunikation und Betrug. Eine qualitative Untersuchung relevanter Aspekte am Beispiel von Versicherungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188068