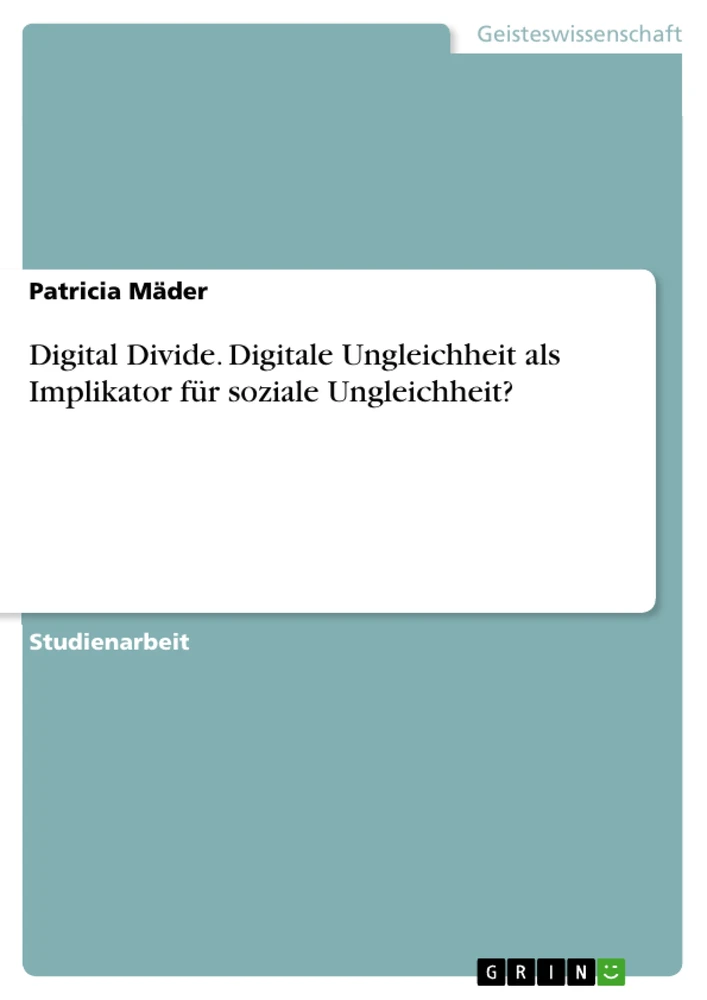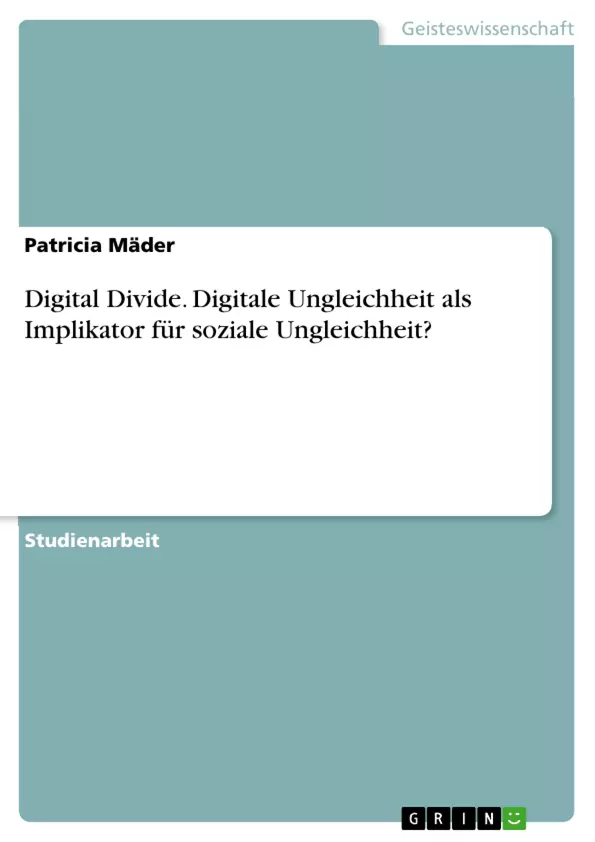Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Digital Divide und beantwortet die Frage, ob digitale Ungleichheit als Implikator für soziale Ungleichheit dient.
Um dieser Frage nachzugehen, wird im Folgenden zunächst die Perspektive einer Informations- und Wissensgesellschaft eingenommen, um aufzuzeigen, inwiefern sich eine soziale Ungleichheit diesbezüglich beschreiben lässt. Darauffolgend werden gegenwärtige Ungleichheitsentwicklungen beleuchtet und aufgezeigt, welche Rolle dem Internet dabei zugeschrieben wird.
In einem weiteren Abschnitt werden Distinktionsprozesse und die These der digitalen Spaltung weiter in die Thematik einführen, bis letztlich ein soziologisches Erklärungsmodell zur digitalen Ungleichheit aufzeigt, welche Ungleichheitsprozesse auf der Mikro- und Makroebene stattfinden.
In einem Fazit werden die Erkenntnisse zusammengetragen und in den Kontext zur sozialen Ungleichheit gesetzt, wobei hier letztendlich die Frage nach der Verschärfung dieser durch die digitale Ungleichheit zu beantworten versucht wird.
Das Internet als digitales Medium ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es fungiert in unserer modernen Gesellschaft als Quelle für Informationen, Unterhaltung in Form von Musik, Videos, Fotos usw. und macht eine soziale Vernetzung auf dafür vorgesehenen Plattformen möglich. Das Internet wird einerseits als demokratisierend sowie vernetzend gesehen und würde den Wissensstand heben, auf der anderen Seite würde es aber auch die Mächtigen stärken, zur Vereinsamung führen und dumm machen.
Was auch immer auf einen persönlich davon zutrifft - Fakt ist: das Internet nimmt erheblichen Einfluss auf das individuelle Leben und stellt den Einzelnen in den Mittelpunkt - so heißt es. Damit nimmt das Internet aber auch gleichzeitig Einfluss auf die Gesellschaft und ihre sozialen Strukturen. Die Gesellschaft ist wiederum geprägt von Ungleichheitsprozessen, die sich in bestimmten sozialen Schichtungen äußern und nur schwer aufbrechbar scheinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Ungleichheit in Theorien der Informations- und Wissensgesellschaft
- Gegenwärtige Ungleichheitsentwicklung und die Rolle des Internets
- Distinktionsprozesse und die These der digitalen Spaltung
- Soziologisches Modell zur Erklärung der digitalen Ungleichheit
- Auf der Makroebene
- Auf der Mikroebene
- Von der Mikro- auf die Makroebene
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Ungleichheit. Ziel ist es, aufzuzeigen, ob und wie der Zugang zum Internet und dessen Nutzung bestehende soziale Ungleichheiten verstärken oder möglicherweise sogar reduzieren können. Die Analyse betrachtet dabei verschiedene theoretische Perspektiven und ein soziologisches Erklärungsmodell.
- Soziale Ungleichheit in der Informations- und Wissensgesellschaft
- Die Rolle des Internets in gegenwärtigen Ungleichheitsentwicklungen
- Distinktionsprozesse und digitale Spaltung
- Soziologisches Modell der digitalen Ungleichheit (Mikro- und Makroebene)
- Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Ungleichheit. Sie argumentiert, dass der Zugang zum Internet zwar Chancen für mehr gesellschaftliche Teilhabe bietet, aber auch bestehende Ungleichheiten verschärfen könnte, abhängig vom Umgang mit dem Medium und seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Die Arbeit skizziert den methodischen Aufbau, der sich von Theorien der Informationsgesellschaft über die Analyse gegenwärtiger Ungleichheiten bis hin zu einem soziologischen Erklärungsmodell erstreckt.
Soziale Ungleichheit in Theorien der Informations- und Wissensgesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der sozialen Ungleichheit und deren Manifestation in Theorien der Informations- und Wissensgesellschaft. Es definiert soziale Ungleichheit als ungleichen Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Ressourcen und diskutiert den Wandel von der Industrie- zur postindustriellen Gesellschaft, wobei Wissen und Bildung an Bedeutung gewinnen. Der Übergang zur Netzwerkgesellschaft und die damit verbundenen Inklusions- und Exklusionsmechanismen werden als potenzielle Verstärker sozialer Ungleichheiten identifiziert. Das Kapitel betont die zentrale Rolle von Bildung als Schlüsselqualifikation im informationellen Kapitalismus und die Möglichkeit individueller Durchsetzungskraft trotz bestehender Ungleichheiten.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, digitale Ungleichheit, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Netzwerkgesellschaft, Distinktion, Inklusion, Exklusion, Internet, Mediennutzung, sozioökonomischer Status, Bildung, Makroebene, Mikroebene.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Soziale Ungleichheit im digitalen Zeitalter"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Ungleichheit. Sie fragt, ob und wie der Zugang zum Internet und dessen Nutzung bestehende soziale Ungleichheiten verstärken oder reduzieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt soziale Ungleichheit in der Informations- und Wissensgesellschaft, die Rolle des Internets in gegenwärtigen Ungleichheitsentwicklungen, Distinktionsprozesse und die digitale Spaltung, sowie ein soziologisches Modell der digitalen Ungleichheit auf Mikro- und Makroebene. Der Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Ungleichheit steht im Mittelpunkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über soziale Ungleichheit in Theorien der Informations- und Wissensgesellschaft, ein Kapitel über gegenwärtige Ungleichheitsentwicklungen und die Rolle des Internets, ein Kapitel über Distinktionsprozesse und die digitale Spaltung, ein Kapitel mit einem soziologischen Modell zur Erklärung der digitalen Ungleichheit (aufgeteilt in Makro- und Mikroebene und deren Zusammenspiel) und abschließend ein Fazit.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit nutzt einen theoretischen Ansatz, der Theorien der Informationsgesellschaft, die Analyse gegenwärtiger Ungleichheiten und ein soziologisches Erklärungsmodell kombiniert.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist der Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Ungleichheit. Es wird untersucht, ob und wie der Internetzugang und die Internetnutzung bestehende soziale Ungleichheiten beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Soziale Ungleichheit, digitale Ungleichheit, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, Netzwerkgesellschaft, Distinktion, Inklusion, Exklusion, Internet, Mediennutzung, sozioökonomischer Status, Bildung, Makroebene, Mikroebene.
Wie wird soziale Ungleichheit in dieser Arbeit definiert?
Soziale Ungleichheit wird als ungleicher Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Ressourcen definiert.
Welche Rolle spielt Bildung in diesem Kontext?
Bildung wird als Schlüsselqualifikation im informationellen Kapitalismus hervorgehoben, die trotz bestehender Ungleichheiten individuelle Durchsetzungskraft ermöglichen kann.
Wie wird das soziologische Modell der digitalen Ungleichheit aufgebaut?
Das soziologische Modell analysiert die digitale Ungleichheit sowohl auf der Makroebene (gesellschaftliche Strukturen) als auch auf der Mikroebene (individuelles Handeln) und untersucht deren Wechselwirkungen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Diese Frage kann erst nach Lektüre des vollständigen Textes beantwortet werden. Die Zusammenfassung beinhaltet nur eine Einleitung in die Thematik.)
- Citar trabajo
- Patricia Mäder (Autor), 2018, Digital Divide. Digitale Ungleichheit als Implikator für soziale Ungleichheit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1187633