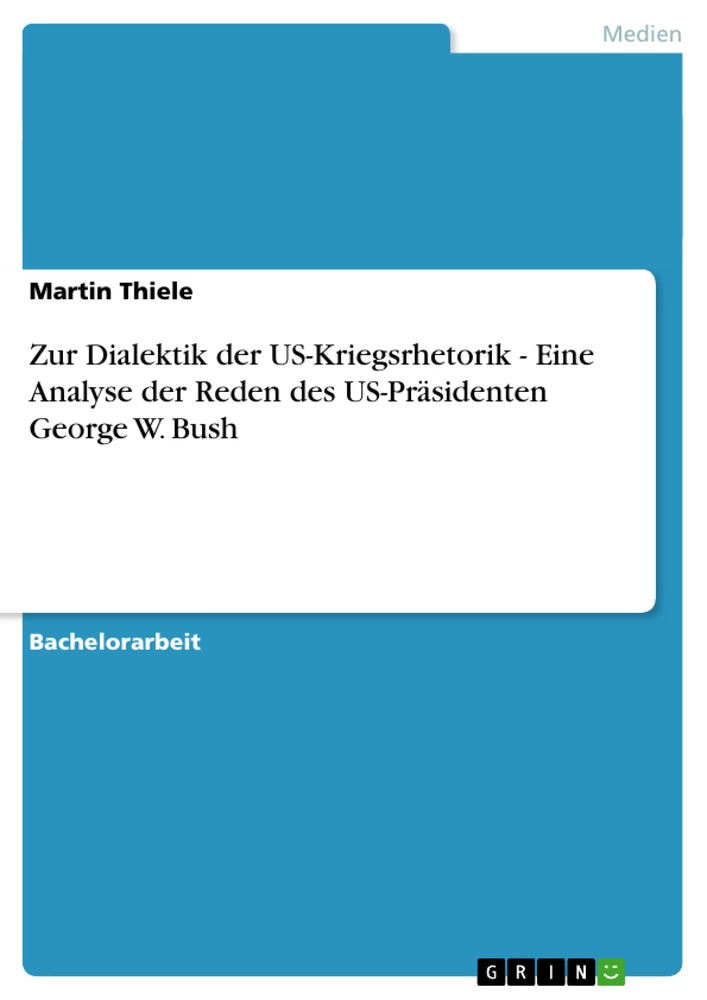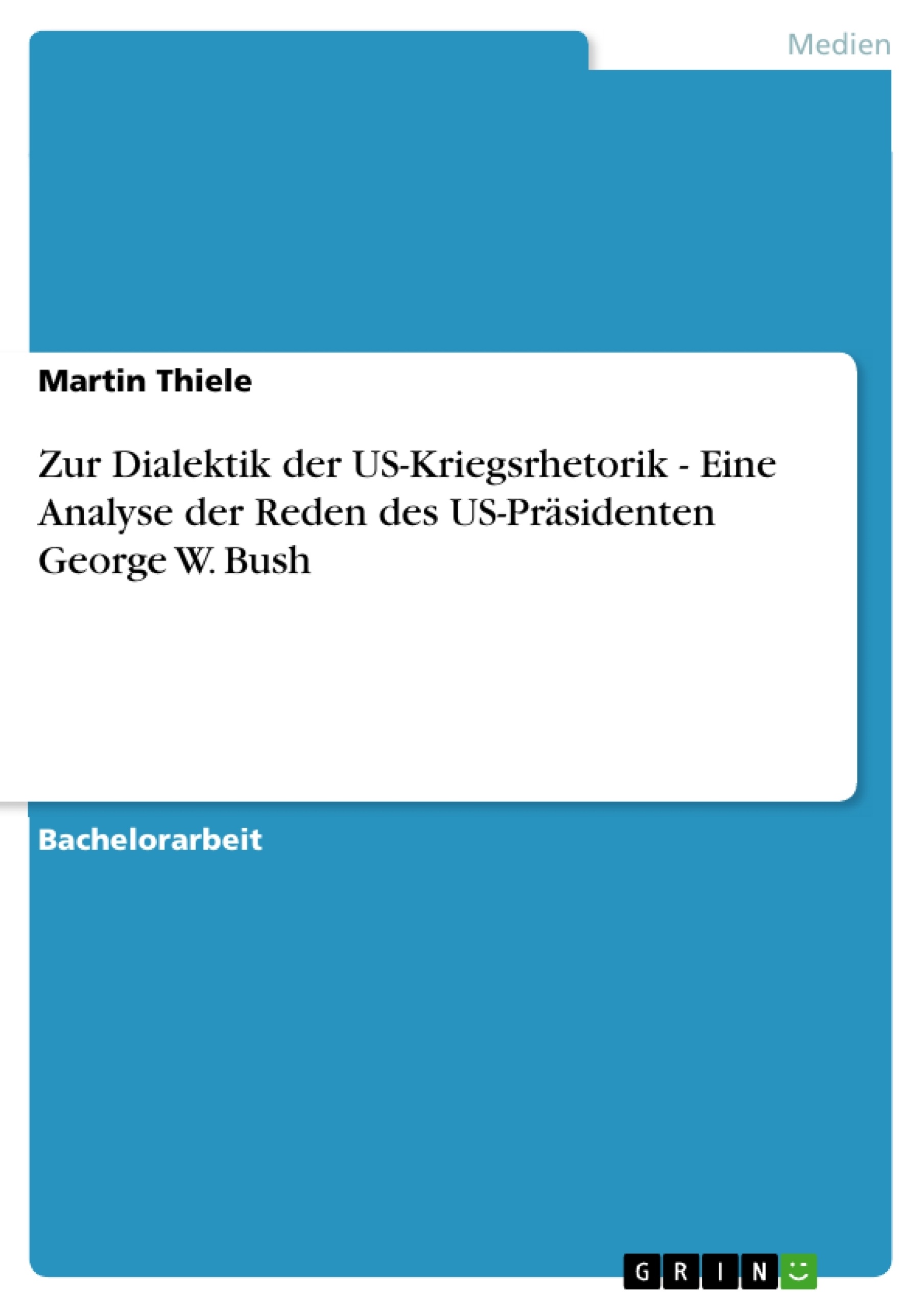Aus den patriotischen Reden nach dem 11. September 2001 wurden
schnell und heimlich Kriegsreden. In diesen sind vor allem drei
sprachliche und argumentative Zielsetzungen zu erkennen, die „(1)
Kriegsgründe konstruieren bzw. Kriegsziele definieren sowie (2)
verbindliche Selbst- und (3) Feindbild[er] vermitteln sollen“. Dialektik
bezeichnet hierbei den geschickten sprachlichen Umgang mit Thesen und
Antithesen. Dabei werden durch die verbale Aneignung und Erzeugung
gewisser Mustern aus Religion oder Mythos, Gedankenkonzepte, die
womöglich in sich widersprüchlich sein könnten, gezielt und
zweckorientiert für den eigenen Gewinn vereinnahmt und verbreitet.
Die US-Kriegsrhetorik, die den ‚war on terror’ vermittelt und unter
anderem zur Legitimation des Irakkriegs eingesetzt wurde, möchte ich zum
Untersuchungsgegenstand der folgenden Arbeit machen. Hierzu beziehe ich
mich ausschließlich auf die Reden des US-Präsidenten George W. Bush.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegung
- Einteilung der Arbeit
- Abgrenzung
- Schaffung einer Gemeinschaftsseele
- Eigenheiten und Nutzen einer Masse
- Verteidigungsfall der USA?
- Kampf gegen Ideologien
- Bedeutung der Medien
- Exkurs: Propaganda
- Religiöse Motive in der Rhetorik
- Das Konzept der „Zivilreligion“ in den USA
- Oberbefehlshaber, Prophet, Priester, Held & Führer
- Das Gute
- Das Böse
- Der Mythos in der US-Kriegsrhetorik
- Das Heldenabenteuer
- Hollywoodeske Muster der Heldenreise
- Instrumentalisierung hollywoodesker Muster
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Dialektik in der US-Kriegsrhetorik von George W. Bush, insbesondere in dessen Reden zwischen 2001 und 2004. Ziel ist es, die sprachlichen Strategien zu untersuchen, mit denen Bush Kriegsgründe konstruierte, Ziele definierte und Selbst- sowie Feindbilder vermittelte. Die Analyse konzentriert sich auf die rhetorischen Mittel, die zur Schaffung einer ideologischen Masse und zur Legitimation der Kriege in Afghanistan und im Irak eingesetzt wurden.
- Propaganda und die Konstruktion einer ideologischen Masse
- Religiöse und mythische Muster in der Kriegsrhetorik
- Instrumentalisierung von Hollywood-Mythen und der Heldenreise
- Dialektischer Umgang mit Thesen und Antithesen
- Die besondere Rolle des US-Präsidenten als ideologischer Akteur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert den Kontext der Arbeit, ausgehend von den Anschlägen vom 11. September 2001 und den darauf folgenden Kriegen in Afghanistan und im Irak. Sie hebt die Widersprüchlichkeiten im westlichen Kriegsdiskurs hervor und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Analyse der rhetorischen Strategien in den Reden von George W. Bush zur Legitimation dieser Kriege. Besondere Aufmerksamkeit wird der Nutzung von Propaganda, religiösen Motiven und mythischen Mustern geschenkt. Die Arbeit grenzt ihren Fokus auf die Reden Bushs zwischen 2001 und 2004 ein und verweist auf ausgeklammerte Themenkomplexe wie den Nahostkonflikt und die visuelle Rhetorik der Reden.
Schaffung einer Gemeinschaftsseele: Dieses Kapitel untersucht, wie Bushs Reden dazu beitrugen, eine Gemeinschaftsseele zu schaffen, die den „Krieg gegen den Terror“ vorbehaltlos unterstützte. Es analysiert die rhetorischen Strategien zur Mobilisierung der Bevölkerung und die Darstellung der USA als Opfer, die Notwendigkeit des Kampfes gegen Ideologien und die Rolle der Medien in der Verbreitung der Botschaft. Ein Exkurs zu Propaganda beleuchtet die historischen und theoretischen Grundlagen dieser Methoden. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie durch sprachliche Mittel eine nationale und internationale Unterstützung für die Kriegspolitik geschaffen werden sollte.
Religiöse Motive in der Rhetorik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle religiöser Motive in Bushs Kriegsrhetorik. Es untersucht das Konzept der „Zivilreligion“ in den USA und analysiert, wie Bush seine Rolle als Oberbefehlshaber mit religiösen Bildern und Begriffen verband. Die Darstellung von Gut und Böse wird im Kontext religiöser Dichotomien untersucht, um zu zeigen, wie diese zur Vereinfachung des Konflikts und zur Legitimation des Krieges beitrugen. Es wird dargelegt wie die Rhetorik eine klare moralische Ordnung schaffte und somit eine breite Zustimmung erreichte.
Der Mythos in der US-Kriegsrhetorik: Dieses Kapitel analysiert den Einsatz von Mythen in Bushs Reden. Es untersucht die Verwendung des Heldenabenteuers als Metapher für den „Krieg gegen den Terror“ und die Instrumentalisierung hollywoodesker Muster der Heldenreise. Der Fokus liegt darauf, aufzuzeigen, wie diese rhetorischen Mittel dazu dienten, den Krieg als moralisch gerechtfertigt und als notwendiges Unterfangen zur Rettung der Welt darzustellen und die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen.
Schlüsselwörter
US-Kriegsrhetorik, George W. Bush, Propaganda, Gemeinschaftsseele, Religiöse Motive, Zivilreligion, Mythos, Heldenreise, Hollywood, Dialektik, „Krieg gegen den Terror“, Legitimation, Rhetorik, Persuasion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der US-Kriegsrhetorik von George W. Bush
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die US-Kriegsrhetorik von George W. Bush zwischen 2001 und 2004, insbesondere die sprachlichen Strategien zur Konstruktion von Kriegsgründen, Zieldefinitionen und der Vermittlung von Selbst- und Feindbildern. Der Fokus liegt auf der Legitimation der Kriege in Afghanistan und im Irak.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die rhetorischen Mittel zur Schaffung einer ideologischen Masse, die Rolle von Propaganda, religiösen und mythischen Mustern (inkl. der Heldenreise und Hollywood-Mythen), den dialektischen Umgang mit Thesen und Antithesen und die besondere Rolle des US-Präsidenten als ideologischer Akteur. Die Analyse konzentriert sich auf die Reden Bushs und berücksichtigt dabei die Nutzung religiöser Motive, das Konzept der „Zivilreligion“ in den USA und die Instrumentalisierung hollywoodesker Muster.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die den Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage erläutert. Weitere Kapitel befassen sich mit der Schaffung einer Gemeinschaftsseele, religiösen Motiven in der Rhetorik, dem Mythos in der US-Kriegsrhetorik und einem abschließenden Fazit. Die Einleitung hebt die Widersprüchlichkeiten im westlichen Kriegsdiskurs hervor und grenzt den Fokus der Analyse auf die Reden Bushs zwischen 2001 und 2004 ein. Die einzelnen Kapitel analysieren detailliert die jeweiligen rhetorischen Strategien.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine rhetorische Analyse der Reden von George W. Bush. Es werden sprachliche Strategien, die Verwendung von Propaganda, religiösen und mythischen Motiven sowie die Instrumentalisierung von Hollywood-Mythen untersucht, um aufzuzeigen, wie Bush die Kriegspolitik legitimierte und die öffentliche Unterstützung mobilisierte. Die Analyse konzentriert sich auf die Dialektik in der Rhetorik und die Konstruktion von Selbst- und Feindbildern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: US-Kriegsrhetorik, George W. Bush, Propaganda, Gemeinschaftsseele, Religiöse Motive, Zivilreligion, Mythos, Heldenreise, Hollywood, Dialektik, „Krieg gegen den Terror“, Legitimation, Rhetorik, Persuasion.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die Zusammenfassung des Fazits fehlt im gegebenen Text. Diese Frage kann daher nicht beantwortet werden.)
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in der folgenden Reihenfolge strukturiert: Einleitung, Schaffung einer Gemeinschaftsseele, Religiöse Motive in der Rhetorik, Der Mythos in der US-Kriegsrhetorik und Fazit. Die Einleitung enthält eine Vorüberlegung, eine Einteilung der Arbeit und eine Abgrenzung. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Analyse der jeweiligen Themen.
- Citation du texte
- Martin Thiele (Auteur), 2008, Zur Dialektik der US-Kriegsrhetorik - Eine Analyse der Reden des US-Präsidenten George W. Bush, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118690