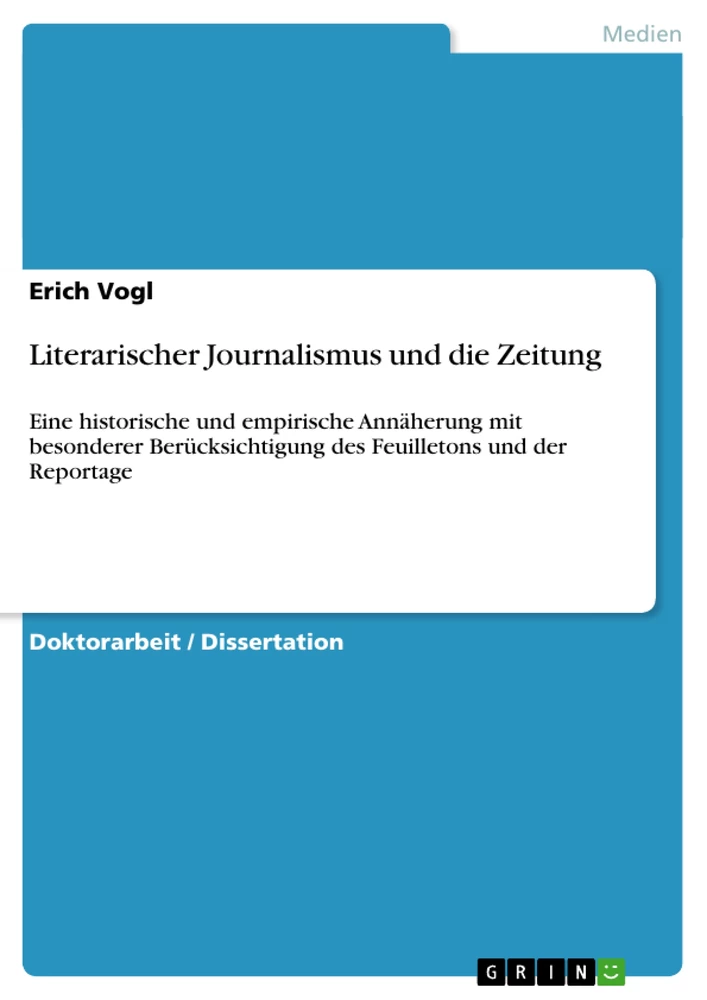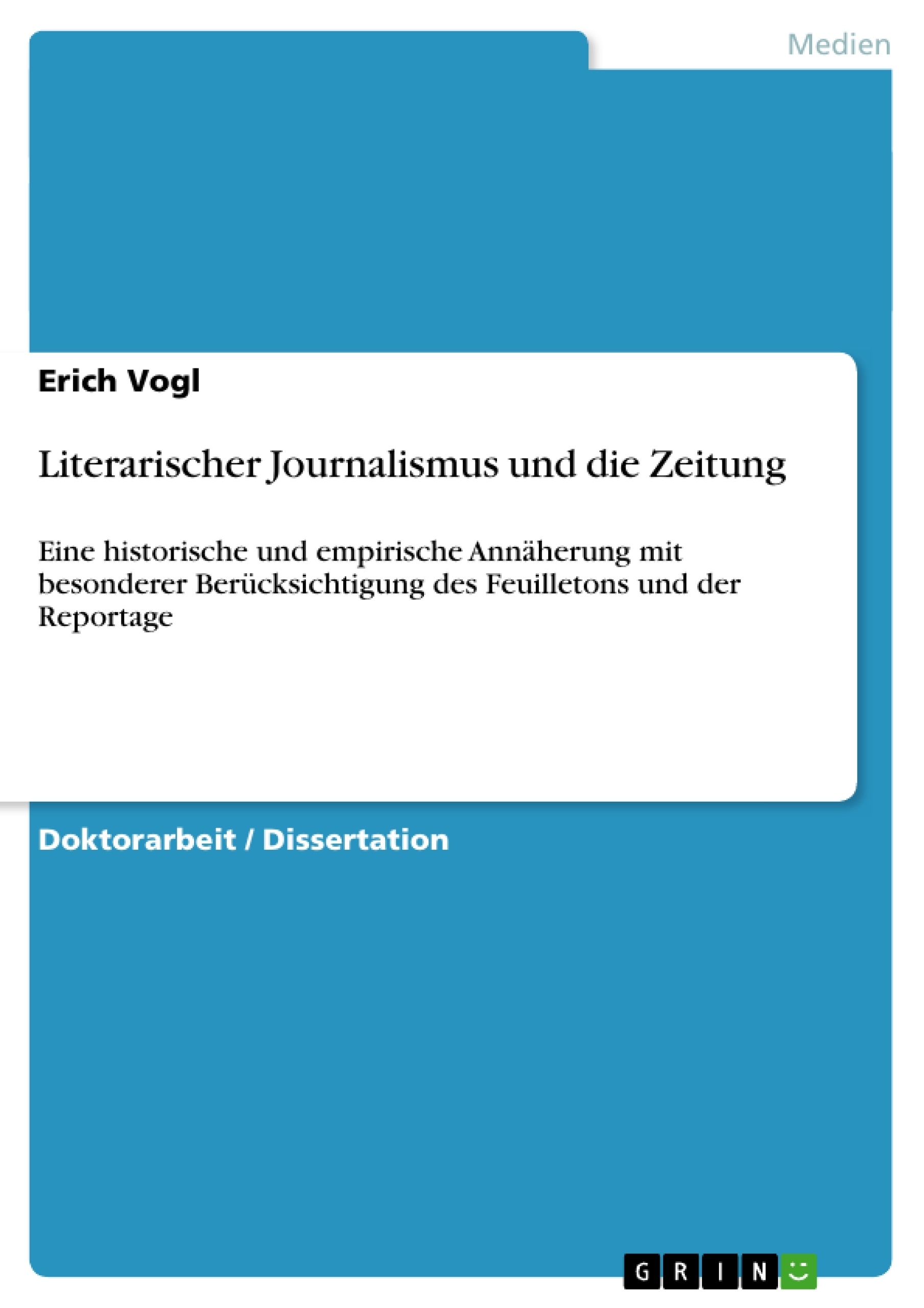„Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit, nichts ist exotischer als unsere Umwelt, nichts ist phantasievoller als die Sachlichkeit.“ Dieses Zitat von Egon Erwin Kisch, zu finden als einleitendes Prinzip des erstmals im Jahr 1925 erschienenen „Rasenden Reporter“, kann als Fundament einer komplexen Thematik angesehen werden, lässt sich doch aus ihm bei genauerer Betrachtung eine Fülle an kommunikationswissenschaftlich relevanten Fragestellungen ableiten. Die Wahrheit, die Wirklichkeit in all ihrer (journalistischen) Subjektivität, als objektiver Widerspruch in sich quasi, ist ein Reibebaum des Journalismus, einer Kulturleistung, deren Facetten vor Vielfalt und nicht gelösten Problemen nur so strotzen.
Die „Wirklichkeit“ soll daher auch zu Beginn dieser Arbeit als ein Ausgangspunkt gelten, als provokant gezeichnete erste Hürde auf einem langen Weg zum wissenschaftlichen Ziel dieses Versuches, einen kleinen Teil des Journalismus näher zu beleuchten, zu deuten, und der Kommunikationswissenschaft einen – wenn vielleicht auch nur kleinen – Schritt vorwärts zu helfen.
Ein Schritt, mit dem die Türe zum Komplex „literarischer Journalismus“ erreicht werden soll, um einen Beitrag zur Erklärung eines Phänomens zu leisten, das seit Jahrzehnten die Wissenschaft beschäftigt, wenngleich sich (vor allem) die Kommunikationswissenschaft in der Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Literatur und Journalismus bislang auffallend dezent im Hintergrund aufgehalten hat. Das Forschungsfeld wurde fast ausschließlich anderen Disziplinen überlassen, vor allem der Literaturwissenschaft. Dabei darf – eigentlich sollte sie dies längst getan haben – auch die Kommunikationswissenschaft mit Recht die Untersuchung „literarischer Qualität“ für sich reklamieren.
Nicht zuletzt sind es die zeitlosen und anerkannten Werke von Journalisten und Grenzgängern wie Kisch, die eine intensive Auseinandersetzung der Kommunikationswissenschaft mit literarischen Leistungen rechtfertigen. Egon Erwin Kisch, dem Klassiker unter den – zumindest deutschsprachigen – Reportern, wird auf den folgenden Seiten, wenn es darum geht, Entwicklungstendenzen nachzuzeichnen, daher auch großes Gewicht beigemessen, da er als Meilenstein der Reportage, und damit auch des literarischen Journalismus gelten muss, an dem kein Weg vorbei führt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Kommunikationswissenschaftliche Relevanz
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Grundlagen
- 2.1 Zur Begriffsklärung
- 2.1.1 Literatur
- 2.1.2 Werk und Kanon
- 2.1.3 Literarischer Journalismus
- 2.2 Theoretische Annäherung
- 2.2.1 Kommunikationswissenschaftliche Grundlage
- 2.2.2 Literaturwissenschaftliche Grundlage
- 2.2.3 Journalistische Qualität und Mängel in der Qualitätsdiskussion
- 2.2.4 Grundprobleme literarischer Wertung
- 2.2.5 Möglichkeiten der Wertung
- 2.2.6 Sprache und Stil
- 2.2.7 Zerbrechliche Regeln
- 2.3 Fragen und Thesen
- 2.4 Analyseeinheiten
- 2.4.1 Untersuchungsobjekte
- 2.4.2 Kategorien
- 2.4.3 Zusammenfassung
- 3 Kommunikationspraxis
- 3.1 Wege zum literarischen Journalismus
- 3.1.1 Antike Spuren
- 3.1.2 Die Reisekunst
- 3.1.3 Übergänge und soziale Fragen
- 3.1.4 Meilensteine des literarischen Journalismus
- 3.1.5 „Der Tag“, Forum für Literarisches
- 3.2 Wissenschaftliche Quelle Journalisten-Preis
- 3.2.1 Die Untersuchung
- 3.3 Die Reportage, das zentrale Element
- 3.3.1 Begriffliche Annäherung
- 3.3.2 Merkmalsfindung
- 3.3.3 Die Untersuchung
- 3.3.4 Das Feature, ein naher Verwandter
- 3.4 Der Essay
- 3.4.1 Die Untersuchung
- 3.5 Die Glosse, der Farbtupfer
- 3.5.1 Die Untersuchung
- 3.6 Die Kunst-Kritik
- 3.6.1 Die Untersuchung
- 3.7 Das Feuilleton, der vernachlässigte Ort des Literarischen
- 3.7.1 Begriffsklärung
- 3.7.2 Das Wiener Feuilleton um 1900, eine historische Bestandsaufnahme
- 3.7.3 Das deutschsprachige Feuilleton der Gegenwart
- 3.7.4 Conclusio der Feuilletons-Debatte
- 3.8 Gesamtbild der Tageszeitungen
- 3.8.1 „Die Presse“
- 3.8.2 Die „Süddeutsche Zeitung“
- 3.8.3 Rückbesinnung im Zeitalter des World Wide Web?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den literarischen Journalismus, ein Phänomen, das an der Schnittstelle von Literatur und Journalismus liegt und bisher von der Kommunikationswissenschaft wenig beachtet wurde. Ziel ist es, einen Beitrag zur Klärung dieses komplexen Verhältnisses zu leisten und das Forschungsfeld für die Kommunikationswissenschaft zu erschließen. Die Arbeit analysiert die kommunikationswissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Perspektive auf den literarischen Journalismus, untersucht verschiedene journalistische Formen und ihre literarischen Elemente und beleuchtet die historische Entwicklung dieses Genres.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des literarischen Journalismus
- Theoretische Grundlagen der Analyse literarischer Qualität im Journalismus
- Empirische Untersuchung verschiedener journalistischer Formen (Reportage, Essay, Glosse, Feuilleton)
- Historische Entwicklung des literarischen Journalismus
- Der literarische Journalismus im Kontext der aktuellen Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des literarischen Journalismus ein und begründet die Relevanz der Forschungsarbeit. Sie stellt die Forschungsfrage auf und skizziert den methodischen Ansatz. Das Zitat von Egon Erwin Kisch dient als Ausgangspunkt, um die Spannung zwischen Objektivität und Subjektivität im Journalismus und die Bedeutung der „Wirklichkeit“ für die journalistische Arbeit zu beleuchten. Die Arbeit argumentiert für eine stärkere Einbeziehung des literarischen Journalismus in die kommunikationswissenschaftliche Forschung und hebt die Bedeutung historischer Autoren wie Kisch hervor.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es klärt den Begriff des literarischen Journalismus, differenziert zwischen Literatur und Journalismus, beleuchtet die kommunikationswissenschaftlichen und literaturwissenschaftlichen Perspektiven und diskutiert die Bewertungskriterien für literarische Qualität im Journalismus. Es untersucht die Herausforderungen der literarischen Wertung und die Rolle von Sprache und Stil im literarischen Journalismus. Schließlich werden die Analyseeinheiten der Arbeit definiert.
3 Kommunikationspraxis: Dieses Kapitel untersucht die Kommunikationspraxis des literarischen Journalismus. Es analysiert verschiedene journalistische Formen wie Reportage, Essay, Glosse, Kunstkritik und Feuilleton hinsichtlich ihrer literarischen Elemente und ihres Beitrags zum literarischen Journalismus. Es wird die historische Entwicklung dieser Formen nachgezeichnet und deren gegenwärtige Rolle in der Medienlandschaft beleuchtet. Die Analyse berücksichtigt auch Beispiele aus namhaften Zeitungen wie „Die Presse“ und der „Süddeutschen Zeitung“.
Schlüsselwörter
Literarischer Journalismus, Kommunikationswissenschaft, Literaturwissenschaft, Journalistische Qualität, Reportage, Essay, Glosse, Feuilleton, Kunstkritik, Medienlandschaft, Egon Erwin Kisch, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Eine Untersuchung des Literarischen Journalismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den literarischen Journalismus – ein Bereich an der Schnittstelle von Literatur und Journalismus, der in der Kommunikationswissenschaft bisher wenig Beachtung gefunden hat. Ziel ist die Klärung des komplexen Verhältnisses zwischen Literatur und Journalismus und die Erschließung dieses Forschungsfeldes für die Kommunikationswissenschaft.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert den literarischen Journalismus aus kommunikationswissenschaftlicher und literaturwissenschaftlicher Perspektive. Sie untersucht verschiedene journalistische Formen (Reportage, Essay, Glosse, Feuilleton, Kunstkritik) auf ihre literarischen Elemente und beleuchtet die historische Entwicklung dieses Genres. Ein weiterer Fokus liegt auf der Rolle des literarischen Journalismus in der heutigen Medienlandschaft.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf kommunikationswissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Theorien. Es werden Begrifflichkeiten geklärt (z.B. literarischer Journalismus, Werk, Kanon), Bewertungskriterien für literarische Qualität im Journalismus diskutiert und die Herausforderungen der literarischen Wertung beleuchtet. Die Rolle von Sprache und Stil im literarischen Journalismus wird ebenfalls untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche und Analyse verschiedener journalistischer Formen. Es werden konkrete Beispiele aus namhaften Zeitungen wie "Die Presse" und der "Süddeutschen Zeitung" analysiert. Die Arbeit definiert klar ihre Analyseeinheiten (Untersuchungsobjekte und Kategorien).
Welche journalistischen Formen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert verschiedene journalistische Formen, darunter die Reportage, den Essay, die Glosse, die Kunstkritik und das Feuilleton. Für jede Form wird eine Begriffsbestimmung vorgenommen, ihre Merkmale analysiert und ihre historische Entwicklung nachgezeichnet. Die Untersuchung umfasst auch die aktuelle Rolle dieser Formen in der Medienlandschaft.
Welche historische Entwicklung wird beleuchtet?
Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung des literarischen Journalismus, beginnend mit antiken Spuren über die Reisekunst bis hin zu Meilensteinen und der Entwicklung des Feuilletons (am Beispiel Wiens um 1900). Der Einfluss des World Wide Web auf den literarischen Journalismus wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt Egon Erwin Kisch in der Arbeit?
Egon Erwin Kisch dient als Beispiel für die Spannung zwischen Objektivität und Subjektivität im Journalismus. Seine Arbeit wird als Ausgangspunkt für die Diskussion über die Bedeutung der „Wirklichkeit“ im journalistischen Kontext genutzt, und er wird als wichtiger historischer Autor im Bereich des literarischen Journalismus hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literarischer Journalismus, Kommunikationswissenschaft, Literaturwissenschaft, Journalistische Qualität, Reportage, Essay, Glosse, Feuilleton, Kunstkritik, Medienlandschaft, Egon Erwin Kisch, historische Entwicklung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage und die Vorgehensweise beschreibt; ein Kapitel zu den Grundlagen, das die theoretischen Rahmenbedingungen festlegt; und ein Kapitel zur Kommunikationspraxis, das die empirischen Analysen der verschiedenen journalistischen Formen enthält.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Kommunikationswissenschaft und Literaturwissenschaft, Journalisten, sowie alle Interessierten an der Schnittstelle von Literatur und Journalismus. Sie trägt zur Erweiterung des Forschungsfeldes des literarischen Journalismus bei und bietet neue Perspektiven auf die Rolle der Literatur im Journalismus.
- Quote paper
- Dr. Erich Vogl (Author), 2004, Literarischer Journalismus und die Zeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118478