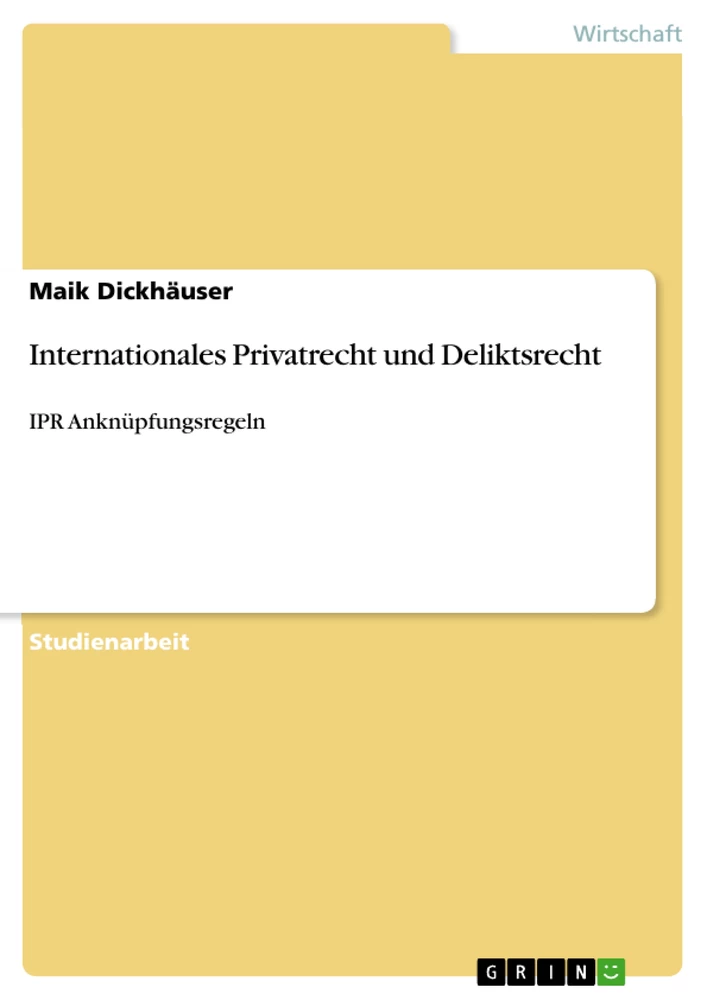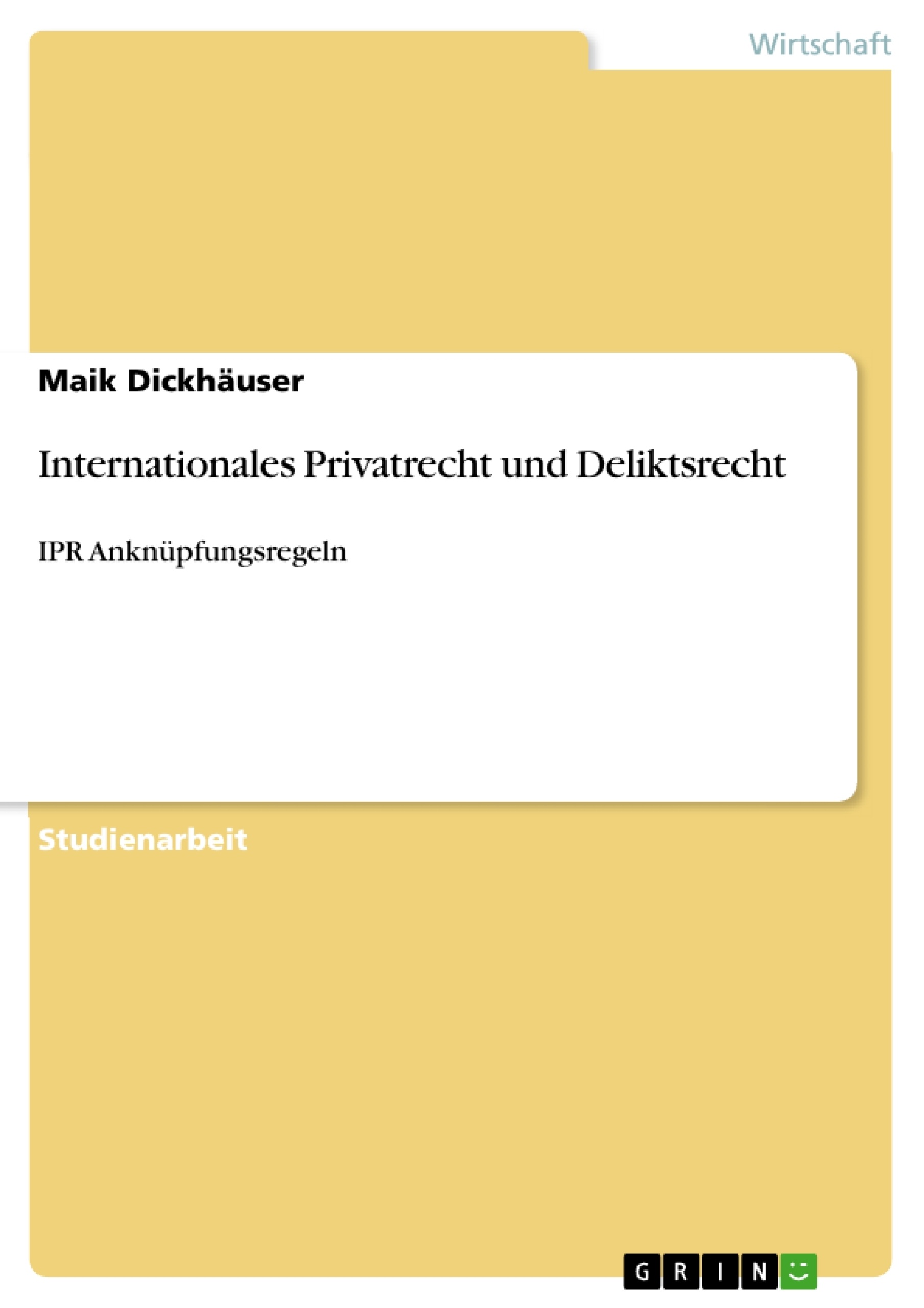Ziel dieser Arbeit ist es dem Leser einen Überblick, über die Anknüpfungsregeln im Deliktsrecht des deutschen IPR, sowie auch über die zentralen Haftungstatbestände im deutschen Deliktsrecht zu verschaffen. Aufgrund des Titels und wegen der besseren Übersichtlichkeit bietet es sich an, diese Seminararbeit in zwei Teile zu gliedern. Im ersten Teil wird das internationale deutsche Deliktsrecht im EGBGB betrachtet, denn bei einem Fall mit Auslandsbezug stellt sich immer erst die Frage welches Recht überhaupt zur Anwendung kommt. Dafür wird erst einmal der Stand der Anknüpfungsregelungen für das internationale deutsche Deliktsrecht bis zum heutigen Tag aufgezeigt. Dieser Status quo ist von einem langen Entwicklungsprozess geprägt, besonders interessant sind dabei die Änderungen nach der letzten großen IPR Reform von 1999. Darüber hinaus soll ein kurzer Ausblick auf die wichtigsten Änderungen im internationalen deutschen Deliktsrecht gegeben werden, die ab dem 11.01.2009 durch die sog. Rom II Verordnung in Kraft treten. Im zweiten Teil werden dann die nationalen Regelungen für das Deliktsrecht im BGB betrachtet. Nach einigen Ausführungen zum Gegenstand und Begriff des Deliktsrechts, schließt sich die Betrachtung eines allgemeinen Aufbaus einer deliktischen Haftungsnorm an. Danach werden die zentralen Grundtatbestände der Verschuldenshaftung also die §§ 823 (1) + (2) und § 826 näher erläutert, da sie die größte Bedeutung im deutschen Deliktsrecht haben. Aufgrund der Vielzahl der Einzeltatbestände im deutschen Deliktsrecht wird nur auf den Fall der Gefährdungshaftung und der Haftung für Dritte näher eingehen, da diese noch von größerer Bedeutung sind. Dem angeschlossen folgen dann die Regelungen zum Schadensersatz, als Rechtsfolge der Haftung aus unerlaubter Handlung. Nach einer allgemeinen Schadensdefinition werden die Schadensarten und die verschiedenen Möglichkeiten des Schadensersatzes aufgezeigt. Nachfolgend wird kurz der Umfang der Schadensersatzleistungen und des Schmerzensgelds präzisiert. Zum Schluss folgen noch einige zusammenfassende Bemerkungen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung: Eingliederung in den Gesamtkontext
- B. Erster Teil: Deliktsrecht im deutschen Internationalen Privatrecht
- I. Vorbemerkungen
- II. Anwendungsbereich
- III. Zweck der Norm
- IV. Prüfungssystematik
- V. Die Tatortregel nach Art. 40 EGBGB
- 1. Bestimmung des Handlungsorts
- 2. Bestimmungsrecht des Geschädigten
- 3. Bestimmung des Erfolgsortes
- 4. Schadensort
- 5. Staatsfreie und exterritoriale Gebiete
- 6. Sonderanknüpfung nach Art. 40 (2) EGBGB
- 7. Ordre-public-Klausel nach Art. 40 (3) EGBGB
- VI. Art. 41 EGBGB: Engere Verbindung zu einem anderen Staat
- VII. Art. 42 EGBGB: Möglichkeit der Rechtswahl
- VIII. Besonderheiten der Anknüpfung bei speziellen Deliktstypen
- IX. Wichtige Neuregelungen nach der ROM-II Verordnung
- C. Zweiter Teil: Nationale Regelungen zum Deliktsrecht im BGB
- I. Gegenstand des Deliktsrechts
- II. Schutzbereich des Deliktsrechts im BGB
- III. Aufbau einer deliktischen Haftungsnorm
- 1. Tatbestand
- 2. Rechtswidrigkeit
- 3. Schuld
- IV. Grundtatbestände des Deliktsrechts
- V. Besondere Einzeltatbestände des Deliktsrechts
- 1. Haftung für Dritte nach § 831 BGB
- 2. Gefährdungshaftung
- VI. Rechtsfolgen
- 1. Haftungsausfüllender Tatbestand
- 2. Art und Umfang der Schadensersatzleistungen
- D. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bietet einen Überblick über die Anknüpfungsregeln im Deliktsrecht des deutschen internationalen Privatrechts (IPR) und die zentralen Haftungstatbestände im deutschen Deliktsrecht. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Anknüpfungsregelungen im internationalen deutschen Deliktsrecht bis heute, einschließlich der Änderungen nach der IPR-Reform von 1999 und einem Ausblick auf die Rom II Verordnung. Der zweite Teil behandelt die nationalen Regelungen im BGB, den Aufbau deliktischer Haftungsnorm und wichtige Grundtatbestände.
- Anknüpfungsregeln im internationalen deutschen Deliktsrecht
- Entwicklung des internationalen Deliktsrechts
- Nationale Regelungen zum Deliktsrecht im BGB
- Aufbau deliktischer Haftungsnorm
- Wichtige Grundtatbestände der Verschuldenshaftung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Eingliederung in den Gesamtkontext: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: einen Überblick über die Anknüpfungsregeln im Deliktsrecht des deutschen IPR und die zentralen Haftungstatbestände im deutschen Deliktsrecht zu geben. Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: den internationalen Aspekt im EGBGB und die nationalen Regelungen im BGB. Die Einleitung skizziert den Inhalt der beiden Teile, wobei der Fokus auf der Entwicklung der Anknüpfungsregeln und den wichtigsten Grundtatbeständen im BGB liegt.
B. Erster Teil: Deliktsrecht im deutschen Internationalen Privatrecht: Dieser Teil befasst sich mit dem internationalen Privatrecht im Kontext des Deliktsrechts. Er analysiert die Kollisionsnormen des EGBGB, insbesondere Art. 40 bis 42, die die Anknüpfung des anwendbaren Rechts bei unerlaubten Handlungen regeln. Es wird der Unterschied zwischen den Kollisionsnormen für vertragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse herausgearbeitet und die Autonomie des deutschen Rechts in diesem Bereich betont. Der Teil behandelt die Tatortregel, die Rechtswahlmöglichkeit und relevante Sonderregeln, sowie die bevorstehenden Änderungen durch die Rom II-Verordnung.
C. Zweiter Teil: Nationale Regelungen zum Deliktsrecht im BGB: Dieser Teil konzentriert sich auf die nationalen Regelungen des Deliktsrechts im BGB. Er beschreibt den Gegenstand und Schutzbereich des Deliktsrechts und analysiert den Aufbau einer deliktischen Haftungsnorm (Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld). Es werden die zentralen Grundtatbestände der Verschuldenshaftung (§§ 823 Abs. 1 und 2, § 826 BGB) erläutert. Zusätzlich werden besondere Einzeltatbestände wie die Gefährdungshaftung und die Haftung für Dritte behandelt. Abschließend werden die Rechtsfolgen, insbesondere der Schadensersatz und dessen Arten und Umfang, betrachtet.
Schlüsselwörter
Internationales Privatrecht, Deliktsrecht, EGBGB, BGB, Anknüpfungsregeln, Haftung, Verschuldenshaftung, §§ 823, 826 BGB, Gefährdungshaftung, Schadensersatz, Rom II-Verordnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Deliktsrecht im deutschen und internationalen Kontext
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Deliktsrecht, sowohl im deutschen internationalen Privatrecht (IPR) als auch im nationalen Recht (BGB). Es behandelt die Anknüpfungsregeln im internationalen Deliktsrecht, die Entwicklung dieser Regeln, die zentralen Haftungstatbestände im BGB und den Aufbau deliktischer Haftungsnorm.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Anknüpfungsregeln im internationalen deutschen Deliktsrecht (EGBGB, insbesondere Art. 40-42), die Entwicklung des internationalen Deliktsrechts, nationale Regelungen zum Deliktsrecht im BGB, den Aufbau einer deliktischen Haftungsnorm (Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld), wichtige Grundtatbestände der Verschuldenshaftung (§§ 823 Abs. 1 und 2, § 826 BGB), besondere Einzeltatbestände wie Gefährdungshaftung und Haftung für Dritte, sowie die Rechtsfolgen (Schadensersatz). Die Rom II-Verordnung wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in zwei Hauptteile gegliedert: Der erste Teil konzentriert sich auf das Deliktsrecht im deutschen internationalen Privatrecht (IPR) und analysiert die relevanten Kollisionsnormen des EGBGB. Der zweite Teil behandelt die nationalen Regelungen des Deliktsrechts im BGB, einschließlich des Aufbaus deliktischer Haftungsnorm und wichtiger Grundtatbestände. Es enthält außerdem eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rechtsquellen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt hauptsächlich das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), insbesondere Artikel 40 bis 42, welche die Anknüpfung des anwendbaren Rechts bei unerlaubten Handlungen regeln, und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere die §§ 823 Abs. 1 und 2, § 826 und die Regelungen zur Gefährdungshaftung und Haftung für Dritte. Die Rom II-Verordnung wird ebenfalls erwähnt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Internationales Privatrecht, Deliktsrecht, EGBGB, BGB, Anknüpfungsregeln, Haftung, Verschuldenshaftung, §§ 823, 826 BGB, Gefährdungshaftung, Schadensersatz, Rom II-Verordnung.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, einen Überblick über die Anknüpfungsregeln im Deliktsrecht des deutschen internationalen Privatrechts und die zentralen Haftungstatbestände im deutschen Deliktsrecht zu geben. Es soll ein Verständnis für die internationalen und nationalen Regelungen im Deliktsrecht vermitteln.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende der Rechtswissenschaften, Wissenschaftler, die sich mit Deliktsrecht befassen, sowie für Juristen, die im Bereich des internationalen Privatrechts oder des Deliktsrechts tätig sind. Es eignet sich auch für alle, die sich einen Überblick über das deutsche Deliktsrecht verschaffen möchten.
- Quote paper
- Maik Dickhäuser (Author), 2008, Internationales Privatrecht und Deliktsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118438