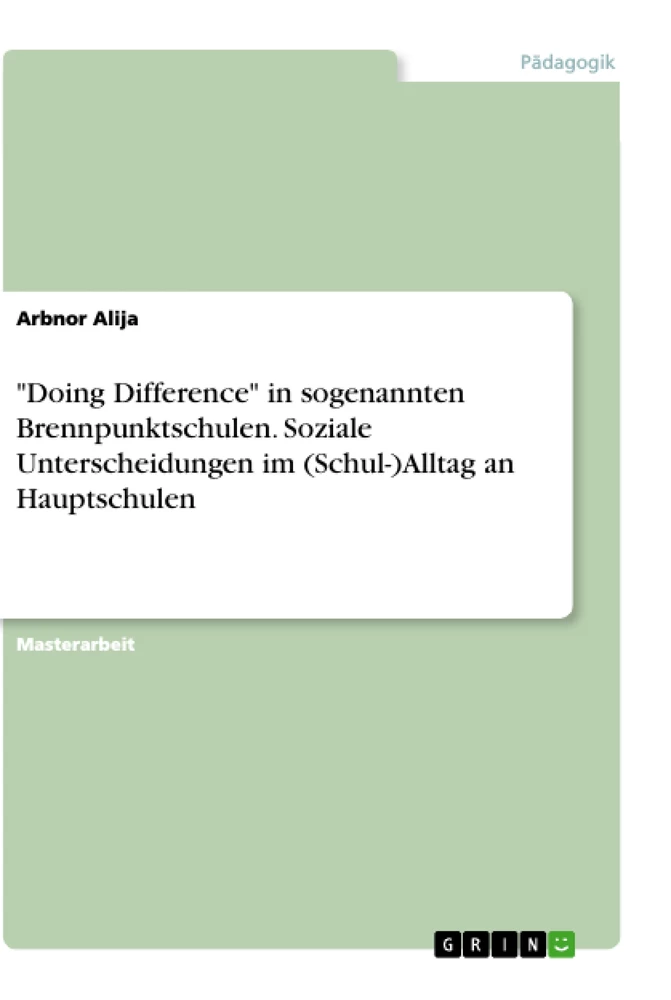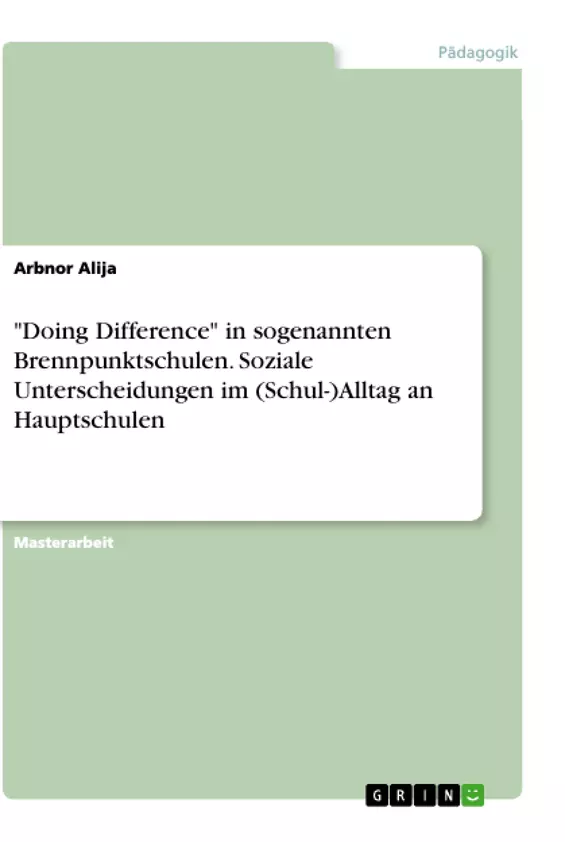Der Anspruch der vorliegenden Arbeit ist es, die Blickwinkel von Hauptschülerinnen aus sogenannten "Brennpunktschulen" in Nordrhein-Westfalen in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, ob und von welchen sozialen Unterscheidungsprozessen diese Gruppe sowohl institutionell als auch gesellschaftlich betroffen ist.
Dazu wird im Folgenden zuerst ein Bezug hergestellt zu Pierre Bourdieu und seiner Theorie zum Kapital, Habitus und sozialen Raum, die in dieser Arbeit vor allem für die jeweilige Situation und Position der Hauptschülerinnen in der Schule bzw. in der Gesellschaft eine wichtige Rolle einnehmen werden. Danach wird das Schulsystem der Bundesrepublik mit den verschiedenen Forschungssträngen bezüglich institutioneller Diskriminierung thematisiert, ehe genauer auf die Gruppe der Hauptschülerinnen eingegangen wird. Daraufhin wird es eine begriffliche Annäherung zu den sogenannten
"Brennpunktschulen" bzw. "Brennpunktvierteln" geben und das Thema der Bildung und der dazugehörigen Angebote in diesen Quartieren ausgeführt.
Im nächsten Schritt wird der intersektionalitätsansatz inklusive seiner Differenzkategorien vorgestellt, da dieser die Grundlage zur Analyse in der vorliegenden Arbeit bildet. Im sechsten Kapitel wird der Stand der wissenschaftlichen Forschung bezüglich sogenannter "Brennpunktschulen" und der intersektionalität in Deutschland vorgestellt, ehe im Anschluss die forschungsmethodologische Herangehensweise in dieser Arbeit vorgestellt wird. Zum Schluss erfolgt die Analyse und Auswertung des Datenmaterials, bevor im letzten Teil die Zusammenfassung und der Ergebnisse und das Fazit folgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pierre Bourdieu
- Kapitalbegriff nach Bourdieu
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Habitusbegriff
- Sozialer Raum
- Kapitalbegriff nach Bourdieu
- Das Schulsystem in der Bundesrepublik Deutschland
- Institutionelle Diskriminierung
- HauptschülerInnen
- „Brennpunktschulen“
- Begriffliche Annäherung
- Bildung in sogenannten „Brennpunktvierteln“
- Intersektionalitätsansatz
- Begriffliche Annäherung
- Differenzkategorien und „Doing Difference“
- „Doing Gender“
- „Doing Race“ bzw. „Doing Ethnicity“
- „Doing Class“
- „Doing Difference“
- Stand der wissenschaftlichen Forschung
- Forschungsstand bezüglich sogenannter Brennpunktschulen
- Intersektionalitätsforschung
- Methodologische Herangehensweise
- Wissenschaftliche Methoden zur Erkenntnisgewinnung
- Qualitative Forschung
- Forschungsfragen
- Methode der Datenerhebung
- Forschungsfeld und Zielgruppe
- Transkription und Auswertungsmethode
- Interviewanalyse
- Bewusstsein über die negative Bewertung der Hauptschule
- Ambivalenz der Gefühle gegenüber des eigenen Stadtteils
- Erfahrungen mit verschiedenen Differenzkategorien
- Bedeutung der sozialen Unterscheidungen
- Zusammenfassung und Fazit
- Reflexion des Forschungsprozesses
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung sozialer Unterscheidungen im Schulalltag von HauptschülerInnen in sogenannten Brennpunktschulen. Dabei geht es um die Frage, wie soziale Ungleichheit im Kontext der Schule und in der Gesellschaft widergespiegelt wird und welche Auswirkungen sie auf die Lebenswelt von Jugendlichen hat.
- Soziale Ungleichheit in Brennpunktschulen
- Der Einfluss von sozialer Herkunft auf Bildungserfolg
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen im Schulalltag
- Die Bedeutung von kulturellem und sozialem Kapital
- Der Intersektionalitätsansatz als Analysemethode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem ein und zeigt die Bedeutung von Bildungschancen für eine funktionierende Demokratie auf. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Konzepte Pierre Bourdieus vorgestellt, darunter der Kapitalbegriff, der Habitus und der soziale Raum. Kapitel drei beleuchtet das deutsche Schulsystem und die Herausforderungen, die mit der Diskriminierung von HauptschülerInnen verbunden sind. Im vierten Kapitel werden Brennpunktschulen als Orte besonderer sozialer Herausforderungen näher beleuchtet. Kapitel fünf behandelt den Intersektionalitätsansatz und die Bedeutung von „Doing Difference“ als Ausdruck der Verschränkung verschiedener Differenzkategorien. Das sechste Kapitel bietet einen Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Brennpunktschulen und Intersektionalitätsforschung.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Brennpunktschulen, HauptschülerInnen, Intersektionalitätsansatz, „Doing Difference“, Kapitalformen, Habitus, sozialer Raum, Bildungserfolg, Diskriminierung, Stereotype, Vorurteile.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Doing Difference“ im Schulkontext?
Es beschreibt die soziale Konstruktion von Unterschieden (wie Klasse, Herkunft oder Geschlecht) durch tägliche Interaktionen und institutionelle Prozesse in der Schule.
Was versteht Bourdieu unter „kulturellem Kapital“?
Es umfasst Bildungstitel, Wissen und kulturelle Güter, die innerhalb einer Gesellschaft als wertvoll gelten und den Bildungserfolg maßgeblich beeinflussen.
Was zeichnet eine „Brennpunktschule“ aus?
Diese Schulen befinden sich oft in sozial benachteiligten Vierteln und sind mit Herausforderungen wie hoher Arbeitslosigkeit im Umfeld und mangelnden Bildungsressourcen konfrontiert.
Was ist der Intersektionalitätsansatz?
Ein Analysemodell, das untersucht, wie verschiedene Diskriminierungsformen (z. B. Rassismus und Klassismus) zusammenwirken und sich gegenseitig verstärken.
Wie erleben Hauptschüler institutionelle Diskriminierung?
Oft durch negative Etikettierung, geringere Erwartungshaltungen seitens der Gesellschaft und strukturelle Hürden beim Übergang in weiterführende Bildungswege.
- Quote paper
- Arbnor Alija (Author), 2021, "Doing Difference" in sogenannten Brennpunktschulen. Soziale Unterscheidungen im (Schul-)Alltag an Hauptschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1183085