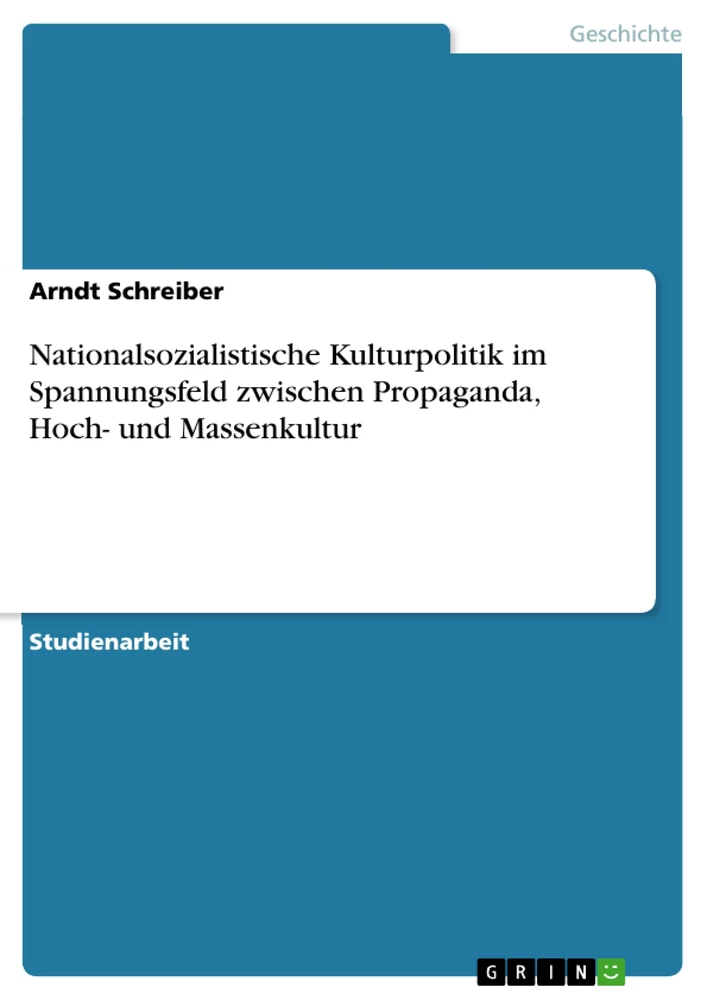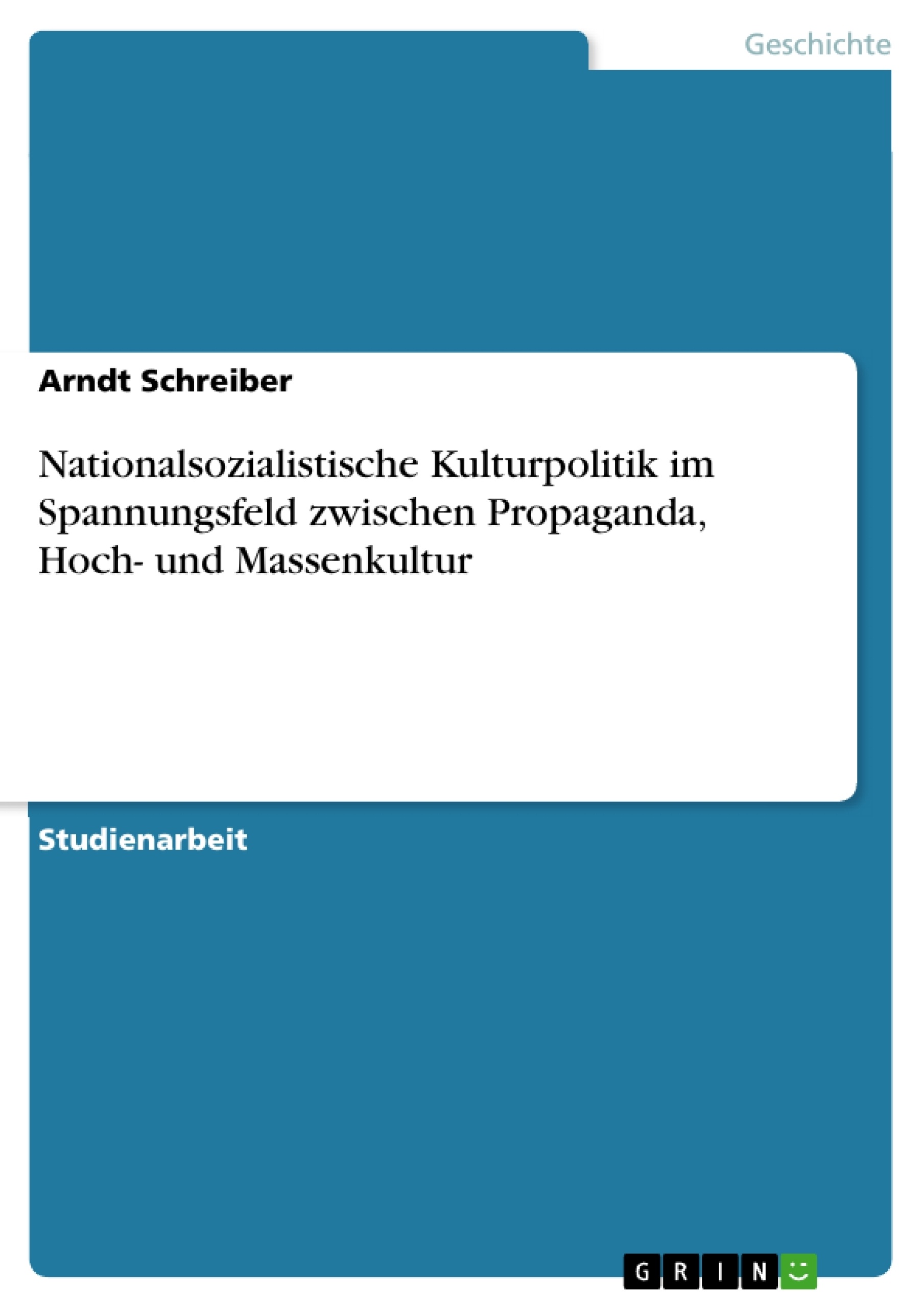Massenkultur ist - historisch betrachtet - ein recht junges Phänomen. Seine Wurzeln reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, durchsetzen konnte es sich jedoch erst mit der Herausbildung unserer modernen Massengesellschaft, deren Entwicklung in Deutschland etwa nach 1890 einsetzte. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg erfreuten sich Unterhaltungslektüre, Illustrierte, Boulevardtheater, artistische Darbietungen und Tanzrevuen auf Grund verbesserter Bildungsmöglichkeiten und steigender Realeinkommen wachsenden Zuspruchs. In der Zwischenkriegszeit erhielten die Massenkünste durch Lichtspiele, Schallplatte und Schausport einen kräftigen Entwicklungsschub. Rhythmusbetonte Tanz- und leichte Unterhaltungsmusik, vor allem aber der Film boten vielen Zeitgenossen Zuflucht in eine idealisierte Traumwelt, welche sie wenigstens kurzzeitig die wirtschaftlich wie politisch prekäre Realität vergessen ließ. Solch ungewohnt ungebremste Vergnügungssucht rief freilich rasch und zahlreich Kritiker auf den Plan. Unter "Müßiggang ist aller Laster Anfang" könnte man die nicht abreißen wollende Flut belehrender Ermahnungen bildungsbürgerlicher Kreise an "die Massen" bereits zu einem Zeitpunkt zusammenfassen, an dem sich eine Massenkultur im modernen Sinne eigentlich noch gar nicht herausgebildet hatte. Groschenhefte und Gassenhauer galten den "Gebildeten" nicht nur als permanente Angriffe auf ihren klassisch-humanistisch geschulten "guten Geschmack", sondern stellten darüber hinaus vor allem das bis dahin sinnstiftend wirkende Deutungsmonopol der Bildungsschichten infrage. Eindringlich warnten diese daher vor der Gefahr eines allgemeinen "kulturellen Niederganges". Umfangreiche und aufsehenerregende Kampagnen gegen "Schmutz und Schund" konnten ihnen zwar weitgehend die Beherrschung der öffentlichen Meinung sichern, den weiteren Aufstieg der Massenkünste vermochten sie damit jedoch nicht aufzuhalten. Daher knüpfte die überwältigende Mehrheit des zudem von sozialem Abstieg bedrohten deutschen Bildungsbürgertums große Hoffnungen an die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler.
Doch unterbrach die "Machtergreifung" der Nationalsozialisten tatsächlich die bisherige Entwicklung der modernen Massenkultur so einschneidend, wie es die offizielle NS-Rhetorik nahe legte? Und welche Folgen hatte die "nationale Revolution" eigentlich für das Verhältnis von Höhen- und Massenkünsten im Dritten Reich? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das kulturpolitische Programm der Nationalsozialisten
- 1.1. Kulturbolschewismus und heroische Schönheit
- 1.2. Thing-Spiel, Klassik oder nordischer Expressionismus?
- 1.3. Vom Aschenputtel zum Herrschaftsinstrument
- 2. Erfolge und Scheitern der NS-Kulturpolitik im Spannungsfeld
- 2.1. Bayreuth und Bunter Abend
- 2.2. Der Kanal zum Gehirn der Masse
- 2.3. Helden, Heimat, Hollywood
- 3. Schlussbetrachtungen zum neuen Verhältnis von Hoch- und Massenkultur im Dritten Reich
- 4. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Kulturpolitik der Nationalsozialisten und untersucht ihr Verhältnis zu Hoch- und Massenkultur im Dritten Reich. Sie beleuchtet die Frage, inwiefern die NS-Kulturpolitik das bestehende Spannungsfeld zwischen elitärer Kunst und massenorientierter Unterhaltung beeinflusste und welche Rolle Propaganda und die neue „Leitkultur“ dabei spielten.
- Die Entwicklung des kulturpolitischen Programms der Nationalsozialisten und dessen Ziele
- Der Einfluss der NS-Kulturpolitik auf die Bereiche Freizeitpolitik, Rundfunk und Film
- Die Auswirkungen der NS-Kulturpolitik auf das Verhältnis von Hoch- und Massenkultur
- Die Rolle von Propaganda in der NS-Kulturpolitik
- Das Konzept der „Leitkultur“ im Dritten Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die historische Entwicklung der Massenkultur dar, die im 19. Jahrhundert ihren Ursprung hat. Die Arbeit befasst sich mit den kritischen Stimmen zur Massenkultur und den Erwartungen der Bildungsbürger an die NS-Kulturpolitik. Kapitel 1 behandelt das kulturpolitische Programm der Nationalsozialisten, das durch die Konkurrenz verschiedener ideologischer Gruppierungen gekennzeichnet war. Dieses Programm bestand jedoch in der Forderung nach dem Primat der Politik gegenüber der Kunst und in der Definition eines Feindbildes – all dessen, was als „artfremd“ der deutschen Kultur nicht „wesenseigen“ war. Kapitel 2 untersucht das Verhältnis von Hoch- und Massenkultur in drei wichtigen Bereichen der NS-Kulturpolitik: die Freizeitpolitik der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, die Programmgestaltung des Rundfunks und die Filmpolitik Joseph Goebbels.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Nationalsozialistische Kulturpolitik, Propaganda, Hochkultur, Massenkultur, Leitkultur, Propaganda, Rundfunk, Film, Freizeitpolitik, „Kraft durch Freude“, „Kulturbolschewismus“, heroische Schönheit, Kunst im Dritten Reich, Sozialgeschichte, Geschichte der Medien, Kulturanalyse.
- Quote paper
- Arndt Schreiber (Author), 2003, Nationalsozialistische Kulturpolitik im Spannungsfeld zwischen Propaganda, Hoch- und Massenkultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11828