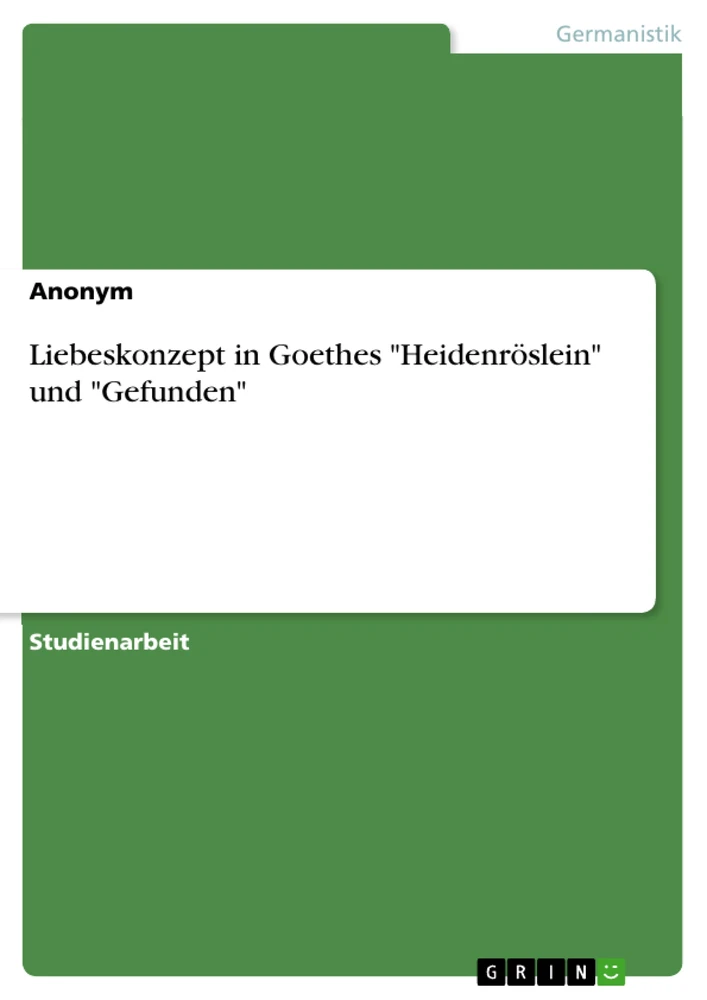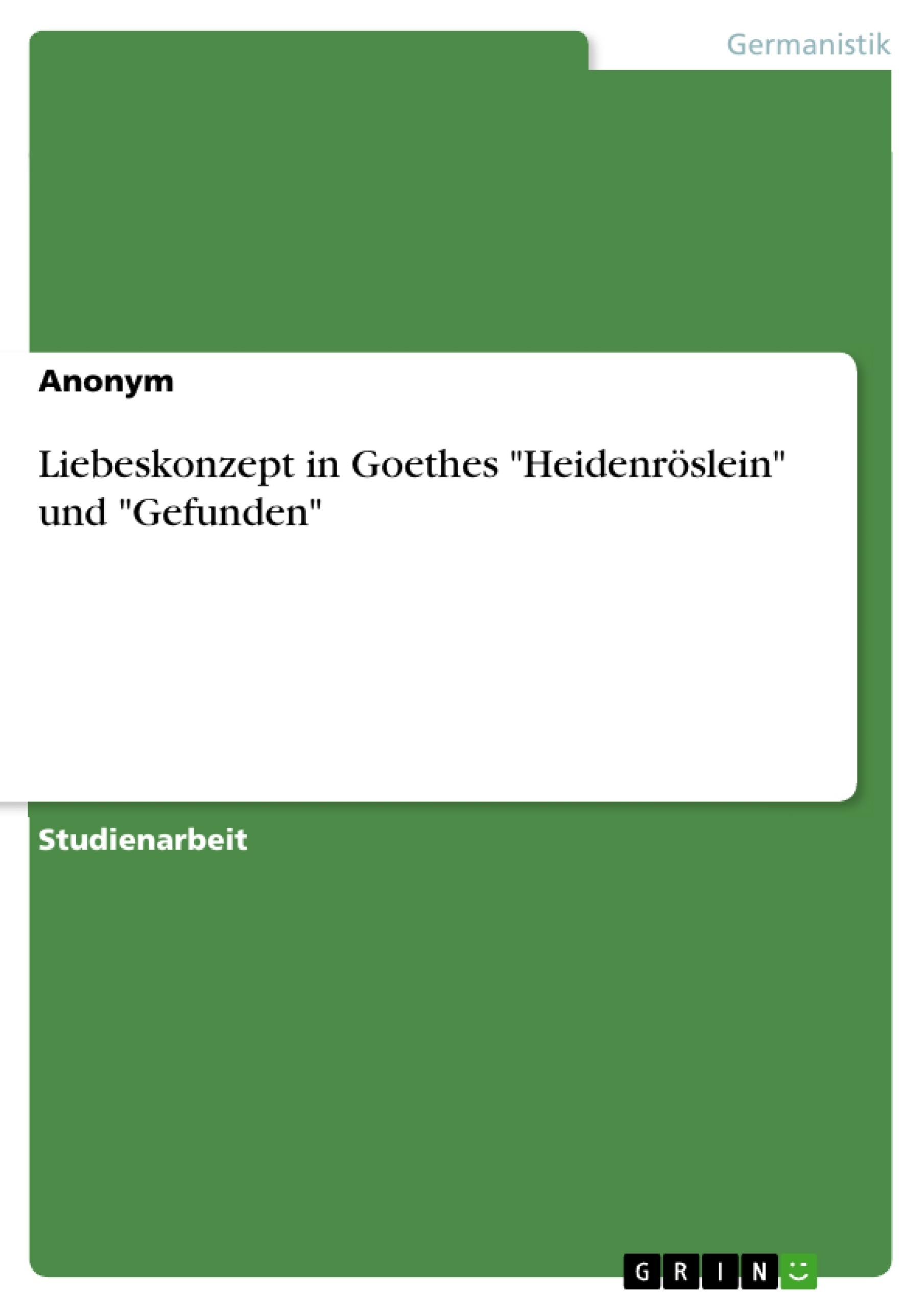Johann Wolfgang von Goethe, 1749 in Frankfurt am Main geboren und 1832 in Weimar gestorben, gilt bis heute als einer der bedeutendsten deutschen Dichter. Zu den bevorzugten Sujets seiner Lyrik zählen Natur und Liebe, die sich nicht selten miteinander verbinden und eine eindeutige Einteilung in Natur- und Liebesgedichte erschweren. Zwei solcher vermeintlichen Naturgedichte, die auf den ersten Blick von sich gegen das Gebrochenwerden wehrenden Blumen handeln, aber als eine durchaus
sexuell gefärbte Begegnung zwischen Mann und Frau ausgelegt werden können, sind das „Heidenröslein“ (1771) und „Gefunden“ (1813).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung des „Heidenröslein“
- 2.1. Das „Heidenröslein“ als Akzeptanz sexueller Gewalt an Frauen?
- 2.2. Das „Heidenröslein“ als Mahnung?
- 2.3. Zusammenfassende Bewertung
- 3. Die Entstehung von „Gefunden“
- 3.1. „Gefunden“ als Exempel von Behutsamkeit und Verantwortungsübernahme
- 4. Gegenüberstellung der Gedichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Liebeskonzepte in Goethes Gedichten „Heidenröslein“ und „Gefunden“. Im Fokus steht die Analyse der Entstehungsgeschichte beider Gedichte und deren Interpretation im Kontext der jeweiligen Zeit. Besonders wird die kontroverse Deutung des „Heidenröslein“ als Darstellung sexueller Gewalt beleuchtet. Die Gegenüberstellung beider Gedichte soll schließlich unterschiedliche Liebeskonzepte verdeutlichen, die durch die Verwendung der Blumenmetaphorik ausgedrückt werden.
- Entstehungsgeschichte und Interpretation von Goethes „Heidenröslein“
- Analyse der kontroversen Deutung des „Heidenröslein“ als Darstellung sexueller Gewalt
- Entstehungsgeschichte und Interpretation von Goethes „Gefunden“
- Vergleich der Liebeskonzepte in beiden Gedichten
- Die Rolle der Blumenmetaphorik in der Darstellung von Liebe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden Gedichte „Heidenröslein“ und „Gefunden“ als zentrale Untersuchungsobjekte vor. Sie benennt die kontroverse Interpretation des „Heidenröslein“ als Darstellung sexueller Gewalt und kündigt die Gegenüberstellung beider Gedichte an, um unterschiedliche Liebeskonzepte zu erforschen. Die Einleitung legt den Fokus auf die Analyse der Entstehungsgeschichte und Interpretation der Gedichte im Kontext ihrer Zeit.
2. Die Entstehung des „Heidenröslein“: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Gedichts „Heidenröslein“, inklusive der Debatte um seine mögliche Inspiration durch Volkslieder und die Beziehung Goethes zu Friederike Brion. Es wird die Frage nach dem Einfluss elsässischer Volkslieder und der möglichen Anlehnung an ein Werk von Richardson diskutiert. Der Einfluss von Herder und die Frage der Urheberschaft werden ebenfalls kritisch betrachtet, wobei verschiedene Theorien und Interpretationen der Quellenlage gegenübergestellt werden. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse der Gedichtinterpretationen.
3. Die Entstehung von „Gefunden“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entstehung des Gedichts „Gefunden“ und dessen Kontext. Es fehlt jedoch im gegebenen Text eine detailliertere Beschreibung der Entstehung von „Gefunden“. Daher kann hier nur eine generelle Aussage getroffen werden: Dieser Abschnitt würde im vollständigen Text die Hintergründe zur Entstehung des zweiten Gedichts, seine Entstehungszeit und mögliche Einflüsse detailliert beschreiben und analysieren.
Schlüsselwörter
Goethe, Heidenröslein, Gefunden, Liebeskonzepte, Blumenmetaphorik, sexuelle Gewalt, Volkslied, Interpretation, Entstehungsgeschichte, Herder, Richardson.
Goethe: „Heidenröslein“ und „Gefunden“ - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Liebeskonzepte in Goethes Gedichten „Heidenröslein“ und „Gefunden“. Im Mittelpunkt stehen die Entstehungsgeschichte beider Gedichte und ihre Interpretation im Kontext ihrer jeweiligen Zeit. Ein besonderer Fokus liegt auf der kontroversen Deutung des „Heidenröslein“ als Darstellung sexueller Gewalt. Die Gegenüberstellung beider Gedichte soll unterschiedliche Liebeskonzepte verdeutlichen, die durch die Blumenmetaphorik ausgedrückt werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und Interpretation von Goethes „Heidenröslein“ und „Gefunden“, die Analyse der kontroversen Deutung des „Heidenröslein“ als Darstellung sexueller Gewalt, den Vergleich der Liebeskonzepte in beiden Gedichten und die Rolle der Blumenmetaphorik in der Darstellung von Liebe. Die Untersuchung bezieht sich auf den Einfluss von Volksliedern, die mögliche Anlehnung an Richardson, den Einfluss von Herder und die Frage der Urheberschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung des „Heidenröslein“ (inkl. Unterkapiteln zur Deutung als Akzeptanz sexueller Gewalt und als Mahnung sowie einer zusammenfassenden Bewertung), ein Kapitel zur Entstehung von „Gefunden“ und ein Kapitel zur Gegenüberstellung der beiden Gedichte. Die Einleitung stellt die Thematik und die kontroverse Interpretation des „Heidenröslein“ vor. Das Kapitel zum „Heidenröslein“ beleuchtet die Entstehung und die Debatte um seine mögliche Inspiration durch Volkslieder und die Beziehung Goethes zu Friederike Brion. Das Kapitel zu „Gefunden“ konzentriert sich auf dessen Entstehung und Kontext, wobei im vorliegenden Auszug eine detailliertere Beschreibung fehlt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Goethe, Heidenröslein, Gefunden, Liebeskonzepte, Blumenmetaphorik, sexuelle Gewalt, Volkslied, Interpretation, Entstehungsgeschichte, Herder, Richardson.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Liebeskonzepte in Goethes „Heidenröslein“ und „Gefunden“ zu untersuchen und die unterschiedlichen Interpretationen, insbesondere die kontroverse Deutung des „Heidenröslein“, zu analysieren. Durch den Vergleich der Gedichte sollen die verschiedenen Liebeskonzepte, die durch die Verwendung der Blumenmetaphorik ausgedrückt werden, verdeutlicht werden.
Welche Quellen werden verwendet?
Der vorliegende Text nennt explizit die möglichen Einflüsse von Volksliedern, Richardson und Herder. Eine detailliertere Auflistung der verwendeten Quellen fehlt jedoch im vorliegenden Auszug.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Liebeskonzept in Goethes "Heidenröslein" und "Gefunden", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1182543