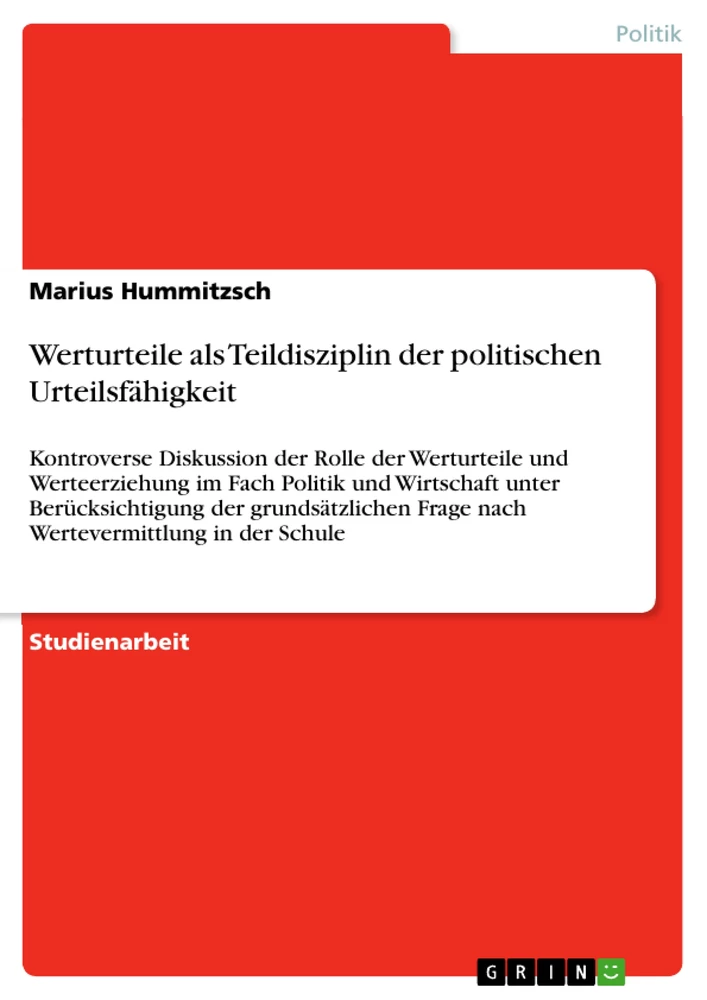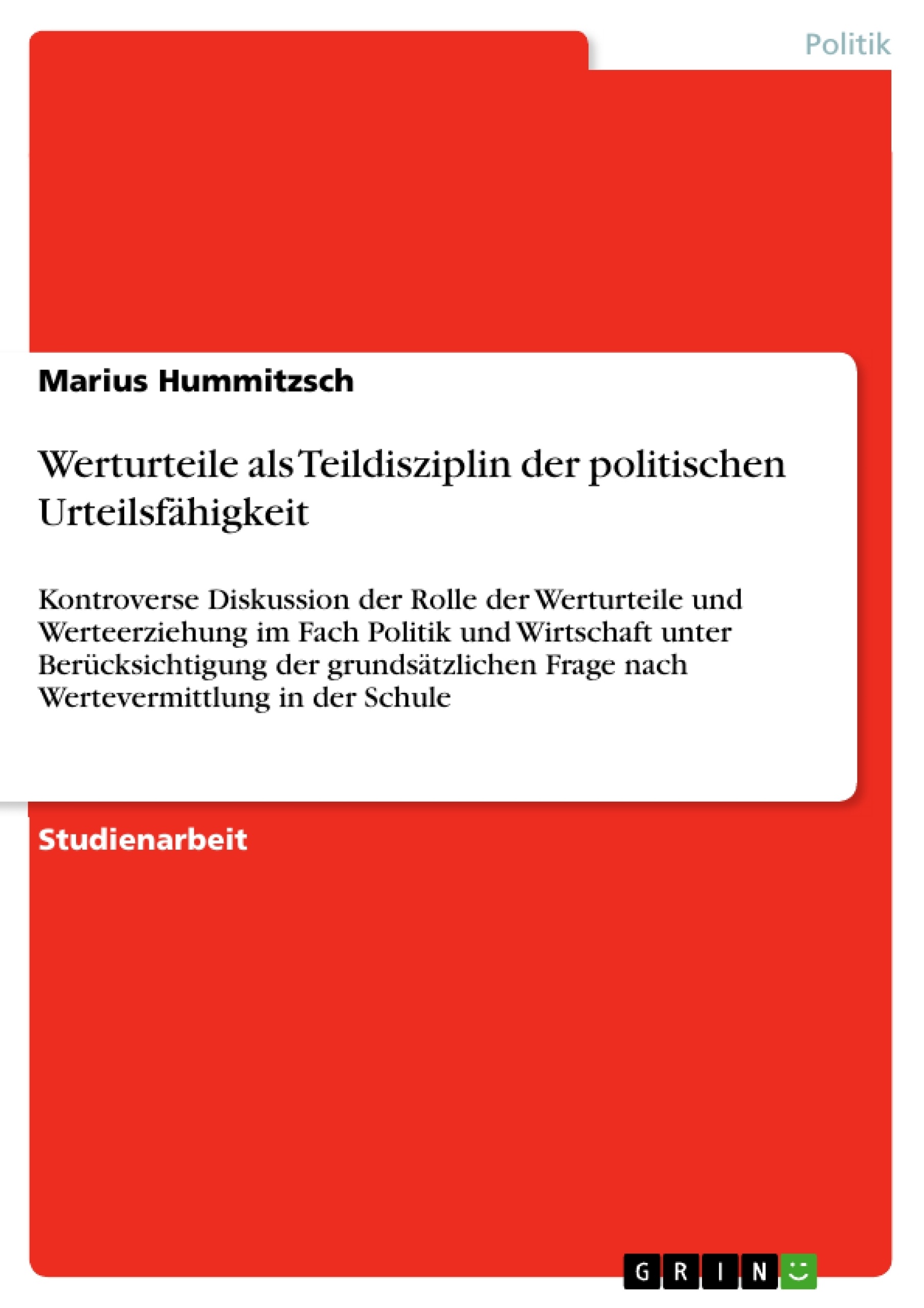Was kann die Schule für eine intensivere Wertevermittlung leisten? Oder soll die Schule
überhaupt einen Anteil erbringen? Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in ganz Deutschland eine
intensive Debatte darum, wie man dem sogenannten „Werteverlust“ entgegentreten kann.
Dabei gibt es nicht wenige Stimmen, die eine intensivere Werteerziehung in der Schule als
zwingend notwendig erachten und dabei gerade die auf Werte-Bildung spezialisierten Fächer
wie Ethik und Religion aber eben auch Politik und Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Doch
welchen Beitrag kann (und soll) die Schule und die Fächer eigentlich leisten?
Aufgabe dieser Arbeit soll es sein zu untersuchen, welche Rolle dabei insbesondere dem
Unterrichtsfach Politik und Wirtschaft zukommt. Dabei möchte ich mit Hilfe kontroverser
Diskussionen der Politikdidaktik eben die Möglichkeiten aber eben auch die Grenzen des
Politikunterrichts bezüglich der Vermittlung von Werten aufzeigen. Da es schier unmöglich
ist den Aspekt der Wertevermittlung vollständig auf den Politikunterricht zu beschränken,
wird die Position der sozialen Institution Schule-im Zuge der Debatte- Gegenstand dieser
Arbeit sein.
Den 2. Schwerpunkt neben der Wertevermittlung stellt die Herausbildung von sachgerechten
Werturteilen bei den Schülern als Teildisziplin der politischen Urteilsfähigkeit dar. Im
Gegensatz zum Problem der Vermittlung von Werten stellt sich hier die Frage einer
grundsätzlichen Diskussion über die Berechtigung im Politikunterricht nicht, da eben diese
Herausbildung fester Bestandteil des Politikunterrichts ist.1 Daher soll hier der Fokus auf der
Frage nach einer schülergerechten Realisierung dieses Kompetenzzuwachses liegen.
Sicher kann eine Arbeit in diesem Rahmen nicht alle Bereiche dieses sehr komplexen
Themenfeldes abdecken, doch zumindest dem Anspruch genügen, grundlegende Positionen
widerzuspiegeln und die engen thematischen Verflechtungen von Wertevermittlung und
Herausbildung von Kompetenzen im Umgang mit Werturteilen zu verdeutlichen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wertevermittlung als Aufgabe der Schule?
- Möglichkeiten und Grenzen der Wertevermittlung im Unterricht und deren Konsequenzen für die Werte-Bildung
- Wertevermittlung als demokratische Verpflichtung
- Der schmale Grad zur Indoktrination
- Modelle der Werte-Erziehung im Politikunterricht
- Werturteile als Teilprinzip der politischen Urteilsfähigkeit
- Berücksichtigung im GPJE-Entwurf
- Darstellung der quantitativen und qualitativen Verwendung
- Herausbildung von Werturteilen im Fach Politik und Wirtschaft
- Konzeptuelle Ansätze zur Verwirklichung im Unterricht
- Modell nach Lawrence Kohlberg
- Alternative Modellvorschläge
- Evaluation von Werturteilen
- Konzeptuelle Ansätze zur Verwirklichung im Unterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Faches Politik und Wirtschaft in Bezug auf Wertevermittlung und die Herausbildung von Werturteilen bei Schülern. Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen des Politikunterrichts in der Wertevermittlung und diskutiert kontroverse Positionen der Politikdidaktik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der schülergerechten Umsetzung des Kompetenzzuwachses im Umgang mit Werturteilen.
- Die Verantwortung der Schule und des Politikunterrichts für Wertevermittlung
- Möglichkeiten und Grenzen der Wertevermittlung im Politikunterricht
- Die Herausbildung von Werturteilen als Teil der politischen Urteilsfähigkeit
- Konzeptuelle Ansätze zur Vermittlung von Werten im Unterricht
- Die Bedeutung von Werturteilen für die politische Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Debatte um Wertevermittlung in der Schule ein und benennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Rolle des Faches Politik und Wirtschaft in diesem Kontext. Sie hebt die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen der Wertevermittlung im Politikunterricht hervor und betont die enge Verflechtung von Wertevermittlung und der Herausbildung von Kompetenzen im Umgang mit Werturteilen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Kontroversen der Politikdidaktik und strebt nach einer Darstellung grundlegender Positionen.
Wertevermittlung als Aufgabe der Schule?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob die Schule überhaupt für Wertevermittlung verantwortlich ist. Es diskutiert die Argumente von Böckenförde zum freiheitlichen Staat und seinen Voraussetzungen, den Einflussverlust traditioneller Institutionen wie der Familie und die zunehmende Bedeutung der Schule als Sozialisationsinstanz. Die kontroverse Diskussion um die Werteerziehung in der Schule wird anhand der Positionen von Sander und Giesecke beleuchtet, wobei die Schwierigkeit einer Werteselektion und der mögliche Wertepluralismus thematisiert werden. Abschließend wird argumentiert, dass die Schule und der Unterricht sich der Verantwortung für Wertevermittlung nicht entziehen können, da ein wertfreier Unterricht nicht existiert und ein Basiskonsens über demokratische Grundwerte besteht.
Möglichkeiten und Grenzen der Wertevermittlung im Unterricht und deren Konsequenzen für die Werte-Bildung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Politikunterrichts bei der Wertevermittlung. Es wird deutlich, dass der Politikunterricht zwar eine Verantwortung trägt, aber aufgrund der geringen Stundenzahl und der Konkurrenz mit anderen Fächern nicht allein für die Wertevermittlung zuständig sein kann. Die unterschiedlichen Positionen von Schiele, Sutor und Reinhard bezüglich der Aufgabenverteilung zwischen Politik-, Ethik- und Religionsunterricht werden diskutiert. Trotz der Grenzen wird betont, dass der Politikunterricht aufgrund seiner Bedeutung für die politische Bildung einen wichtigen Beitrag leisten kann und darf.
Schlüsselwörter
Wertevermittlung, politische Bildung, Politikunterricht, Werturteile, politische Urteilsfähigkeit, Werteerziehung, Schule, Demokratie, Modellvorschläge, Kohlberg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wertevermittlung im Politikunterricht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Faches Politik und Wirtschaft in Bezug auf Wertevermittlung und die Herausbildung von Werturteilen bei Schülern. Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen des Politikunterrichts in diesem Bereich und diskutiert kontroverse Positionen der Politikdidaktik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der schülergerechten Umsetzung des Kompetenzzuwachses im Umgang mit Werturteilen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verantwortung der Schule für Wertevermittlung, die Möglichkeiten und Grenzen der Wertevermittlung im Politikunterricht, die Herausbildung von Werturteilen als Teil der politischen Urteilsfähigkeit, konzeptuelle Ansätze zur Vermittlung von Werten im Unterricht und die Bedeutung von Werturteilen für die politische Bildung. Es werden verschiedene Modelle, u.a. nach Lawrence Kohlberg, diskutiert.
Ist die Schule verantwortlich für Wertevermittlung?
Die Arbeit argumentiert, dass die Schule sich der Verantwortung für Wertevermittlung nicht entziehen kann, da ein wertfreier Unterricht nicht existiert und ein Basiskonsens über demokratische Grundwerte besteht. Die Diskussion bezieht Argumente von Böckenförde, Sander und Giesecke zum freiheitlichen Staat, dem Einflussverlust traditioneller Institutionen und dem Wertepluralismus mit ein.
Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen in der Wertevermittlung im Politikunterricht?
Der Politikunterricht trägt zwar Verantwortung für Wertevermittlung, ist aber aufgrund der geringen Stundenzahl und der Konkurrenz mit anderen Fächern nicht allein zuständig. Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Positionen zur Aufgabenverteilung zwischen Politik-, Ethik- und Religionsunterricht (Schiele, Sutor, Reinhard) und betont den dennoch wichtigen Beitrag des Politikunterrichts zur politischen Bildung.
Wie wird die Herausbildung von Werturteilen im Politikunterricht behandelt?
Die Arbeit untersucht die Herausbildung von Werturteilen als Teil der politischen Urteilsfähigkeit. Sie analysiert konzeptuelle Ansätze zur Vermittlung von Werten im Unterricht und diskutiert die Bedeutung von Werturteilen für die politische Bildung. Dabei werden verschiedene Modelle und deren Umsetzung im Unterricht betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wertevermittlung, politische Bildung, Politikunterricht, Werturteile, politische Urteilsfähigkeit, Werteerziehung, Schule, Demokratie, Modellvorschläge, Kohlberg.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Wertevermittlung als Aufgabe der Schule, Möglichkeiten und Grenzen der Wertevermittlung im Unterricht und deren Konsequenzen für die Werte-Bildung, Werturteile als Teilprinzip der politischen Urteilsfähigkeit, die Herausbildung von Werturteilen im Fach Politik und Wirtschaft, und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Wie wird die Umsetzung von Werturteilsbildung im Unterricht dargestellt?
Die Arbeit geht auf konzeptuelle Ansätze zur Verwirklichung im Unterricht ein, inklusive des Modells nach Lawrence Kohlberg und alternativer Modellvorschläge. Die Evaluation von Werturteilen wird ebenfalls thematisiert.
- Quote paper
- Marius Hummitzsch (Author), 2008, Werturteile als Teildisziplin der politischen Urteilsfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117469