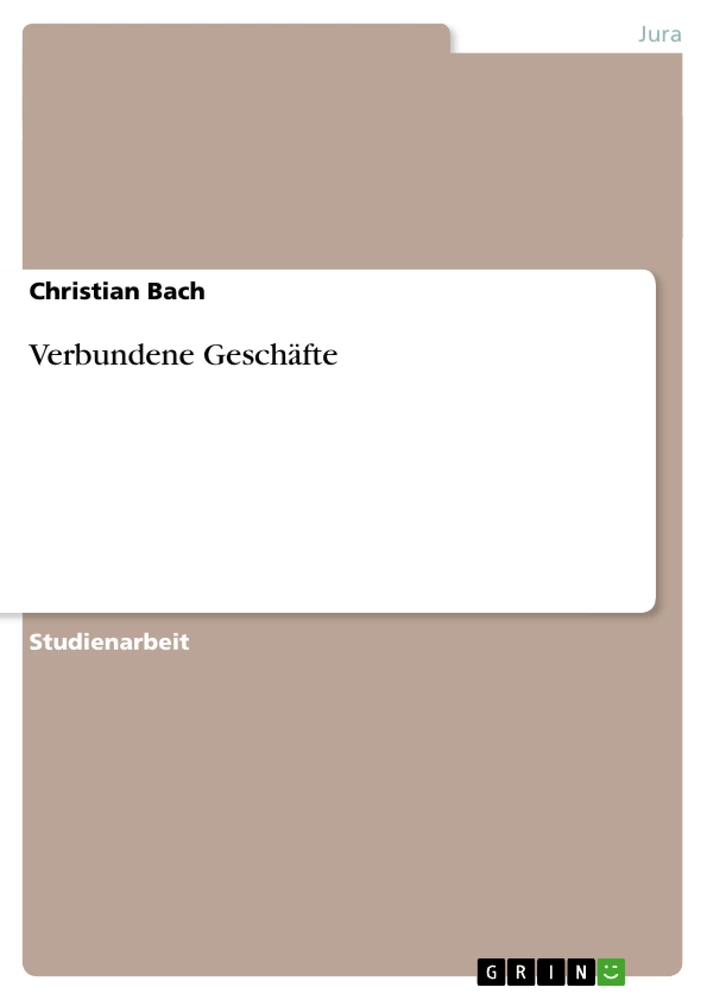In der vorliegenden Arbeit werde ich mich mit verbundenen Geschäften befassen und den Konsequenzen, die sich für die verschiedenen Parteien ergeben. Die Fragestellungen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen, sind: Was sind verbundene Geschäfte und was sind die Konsequenzen, die sich für Verbraucher, Unternehmer und Darlehensgeber ergeben?
Um diese Frage zu beantworten, gehe ich zunächst auf den Begriff der verbundenen Geschäfte (=Verträge) ein und erkläre diesen anhand des Paragraphen 358 (BGB). Ausgehend von der Definition werde ich die beiden Möglichkeiten des Widerrufs (Widerruf des Kredit- bzw. Liefervertrages) untersuchen. Dabei sollen Parallelen und Unterschiede aufgezeigt werden, die sich aus den unterschiedlichen Widerrufsmöglichkeiten der Verträge ergeben.
Anschließend werde ich die rechtlichen Folgen, die sich für die einzelnen Parteien ergeben, erläutern. Hierbei ist es besonders interessant, die unterschiedlichen Ansprüche beim Widerruf zu betrachten.
Abschließend werde ich auf ein aktuelles Thema eingehen, das den sogenannten Handel mit „Schrottimmobilien“ betrifft. Dabei werde ich auf die Veränderung von § 358 Abs III (3) eingehen, welcher unter anderem regelt, ob verbundene Geschäfte bei einer Immobilienfinanzierung vorliegen oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbundene Geschäfte - Definition
- Verknüpfung der beiden Verträge
- Wirtschaftliche Einheit des Vertrages
- Widerruf eines Liefervertrages
- Widerruf eines Kreditvertrages
- Rechtsfolgen
- Konkurrenz mit einem Widerrufsrecht für den Liefervertrag
- Erweiterte Belehrung (nach §358 Abs. V)
- Immobiliendarlehensverträge
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verbundene Geschäfte im Sinne des BGB § 358, insbesondere die Konsequenzen des Widerrufs für Verbraucher, Unternehmer und Darlehensgeber. Es werden die Voraussetzungen für das Vorliegen verbundener Geschäfte analysiert und die rechtlichen Folgen des Widerrufs sowohl des Liefer- als auch des Kreditvertrages beleuchtet.
- Definition und Voraussetzungen verbundener Geschäfte
- Widerrufsrecht beim Liefervertrag im Kontext verbundener Geschäfte
- Widerrufsrecht beim Kreditvertrag im Kontext verbundener Geschäfte
- Rechtsfolgen des Widerrufs für die beteiligten Parteien
- Spezifische Aspekte bei Immobiliendarlehensverträgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht verbundene Geschäfte und deren Konsequenzen für die beteiligten Parteien. Die zentralen Fragen betreffen die Definition verbundener Geschäfte und die sich daraus ergebenden Folgen für Verbraucher, Unternehmer und Darlehensgeber. Die Arbeit analysiert den Begriff der verbundenen Geschäfte anhand von § 358 BGB und untersucht die Widerrufsmöglichkeiten bei Kredit- und Lieferverträgen, um Parallelen und Unterschiede aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf den unterschiedlichen Ansprüchen beim Widerruf und aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit "Schrottimmobilien" und der Änderung von § 358 Abs. III (3).
Verbundene Geschäfte - Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der verbundenen Geschäfte, wie er vom Bundesgerichtshof entwickelt wurde. Es beschreibt das typische Dreipersonenverhältnis (Verbraucher, Verkäufer/Dienstleister, Kreditgeber) und erläutert die Voraussetzungen: den Zusammenhang zwischen Liefer- und Kreditvertrag sowie die wirtschaftliche Einheit beider Verträge. Die Verknüpfung der Verträge wird detailliert analysiert, einschließlich der Frage, ob eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung notwendig ist. Der Abschnitt behandelt auch Sonderfälle, wie den Abschluss eines Kredits nach einem Bargeschäft und die Verwendung von Universalkreditkarten. Die wirtschaftliche Einheit wird definiert und anhand verschiedener Kriterien (z.B. Verfügungsfreiheit über das Darlehen, Vertragsgestaltung, Zusammenarbeit von Unternehmer und Kreditgeber) erläutert.
Widerruf eines Liefervertrages: Dieses Kapitel behandelt den Widerruf eines Liefervertrages im Kontext verbundener Geschäfte. Es erläutert, dass der Widerruf eines Liefervertrags, der eine wirtschaftliche Einheit mit einem Verbraucherdarlehensvertrag bildet, automatisch auch den Widerruf des Kreditvertrags nach sich zieht. Die Bedeutung der wirtschaftlichen Einheit zwischen Liefer- und Kreditvertrag wird nochmals hervorgehoben. Es wird darauf eingegangen, dass die Art der Finanzierung (integriert oder separat) für den Widerruf irrelevant ist, ebenso wie die Höhe des mit dem Darlehen finanzierten Anteils am Kaufpreis.
Schlüsselwörter
Verbundene Geschäfte, Verbraucherdarlehensvertrag, Liefervertrag, Widerrufsrecht, § 358 BGB, Wirtschaftliche Einheit, Rechtsfolgen, Immobiliendarlehensvertrag, Verbraucherkredit.
Häufig gestellte Fragen zu: Verbundene Geschäfte und Widerrufsrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht verbundene Geschäfte im Sinne des BGB § 358, insbesondere die Konsequenzen des Widerrufs für Verbraucher, Unternehmer und Darlehensgeber. Analysiert werden die Voraussetzungen für das Vorliegen verbundener Geschäfte und die rechtlichen Folgen des Widerrufs von Liefer- und Kreditverträgen.
Was sind verbundene Geschäfte im Sinne dieser Arbeit?
Verbundene Geschäfte bezeichnen im Kontext dieser Arbeit ein typisches Dreipersonenverhältnis (Verbraucher, Verkäufer/Dienstleister, Kreditgeber). Es besteht ein Zusammenhang zwischen Liefer- und Kreditvertrag, der durch eine wirtschaftliche Einheit gekennzeichnet ist. Die Verknüpfung kann explizit schriftlich vereinbart sein, ist aber nicht zwingend erforderlich. Auch Sonderfälle wie Kredite nach Bargeschäften oder die Verwendung von Universalkreditkarten werden berücksichtigt.
Welche Voraussetzungen müssen für verbundene Geschäfte erfüllt sein?
Die zentralen Voraussetzungen sind der Zusammenhang zwischen Liefer- und Kreditvertrag und die wirtschaftliche Einheit beider Verträge. Die wirtschaftliche Einheit wird anhand verschiedener Kriterien wie der Verfügungsfreiheit über das Darlehen, der Vertragsgestaltung und der Zusammenarbeit von Unternehmer und Kreditgeber definiert.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Widerruf eines Liefervertrages im Kontext verbundener Geschäfte?
Der Widerruf eines Liefervertrages, der eine wirtschaftliche Einheit mit einem Verbraucherdarlehensvertrag bildet, zieht automatisch den Widerruf des Kreditvertrages nach sich. Die Art der Finanzierung (integriert oder separat) und die Höhe des mit dem Darlehen finanzierten Anteils am Kaufpreis sind für den Widerruf irrelevant.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Voraussetzungen verbundener Geschäfte, das Widerrufsrecht bei Liefer- und Kreditverträgen im Kontext verbundener Geschäfte, die Rechtsfolgen des Widerrufs für die beteiligten Parteien und spezifische Aspekte bei Immobiliendarlehensverträgen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den unterschiedlichen Ansprüchen beim Widerruf und aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit "Schrottimmobilien" und der Änderung von § 358 Abs. III (3).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Verbundene Geschäfte, Verbraucherdarlehensvertrag, Liefervertrag, Widerrufsrecht, § 358 BGB, Wirtschaftliche Einheit, Rechtsfolgen, Immobiliendarlehensvertrag, Verbraucherkredit.
Wie wird der Begriff der wirtschaftlichen Einheit definiert?
Die wirtschaftliche Einheit wird anhand verschiedener Kriterien erläutert, z.B. Verfügungsfreiheit über das Darlehen, Vertragsgestaltung und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und Kreditgeber. Es wird detailliert untersucht, ob eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung notwendig ist, um die wirtschaftliche Einheit zu begründen.
Welche Rolle spielt die Art der Finanzierung (integriert oder separat) beim Widerruf?
Die Art der Finanzierung (integriert oder separat) ist für den Widerruf des Liefer- und Kreditvertrages irrelevant. Dies gilt ebenso für die Höhe des mit dem Darlehen finanzierten Anteils am Kaufpreis.
Gibt es Besonderheiten bei Immobiliendarlehensverträgen?
Die Arbeit thematisiert spezifische Aspekte im Zusammenhang mit Immobiliendarlehensverträgen, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen um "Schrottimmobilien" und die Änderung von § 358 Abs. III (3).
- Quote paper
- Christian Bach (Author), 2008, Verbundene Geschäfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/117446