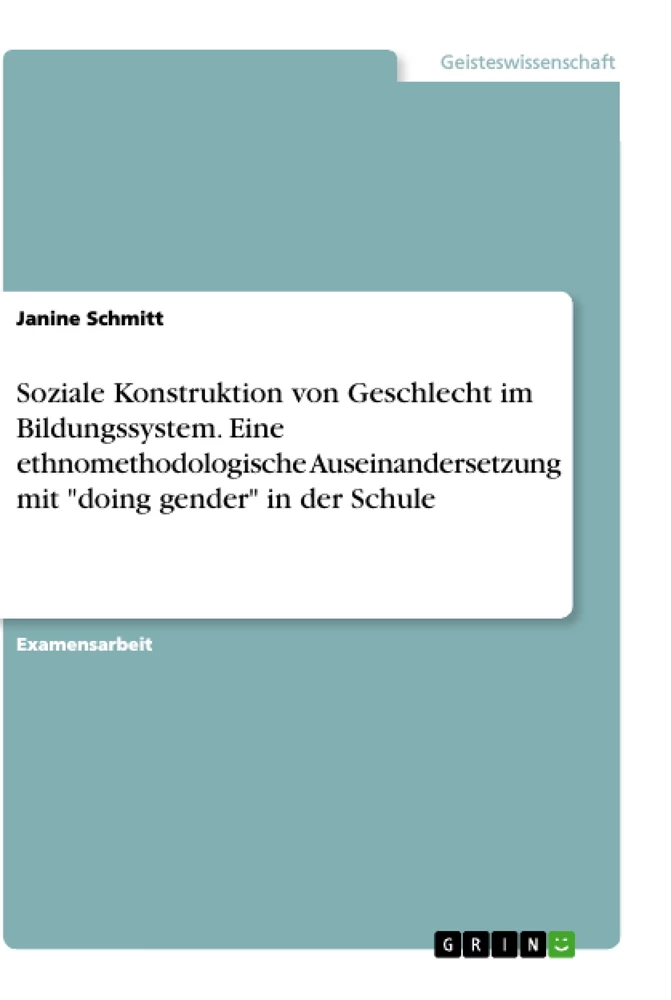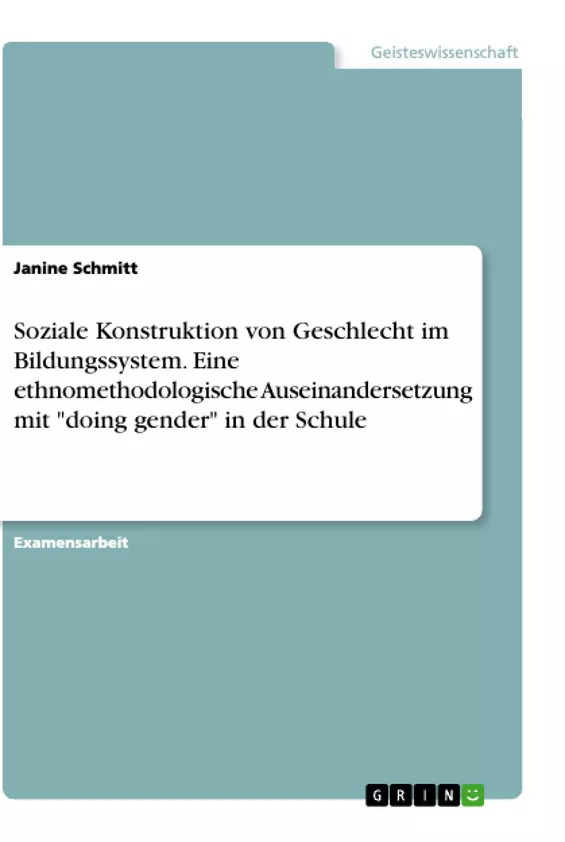Die Vorstellung von Geschlecht scheint in der deutschen Gesellschaft nicht nur allgegenwärtig, sondern vielmehr noch binär und unveränderlich. Geschlecht gewann jedoch besonders in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und wird auch im gesellschaftlichen Kontext auf unterschiedliche Art und Weise verhandelt. Besonders relevant scheint die Forschung, die sich mit Geschlecht auseinandersetzt deshalb, da es in der heutigen Gesellschaft als Kategorie verstanden wird, durch die sich Menschen definieren lassen. Die Soziologie beschäftigt sich innerhalb der Genderforschung schon seit den 1960er Jahren mit einem tiefergreifenden Verständnis von Geschlecht, das die Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellt und die gesellschaftliche Werte- und Normordnung, verfestigt durch vergeschlechtliche Rollenmodelle, kritisch untersucht.
Innerhalb dieses Forschungsansatzes gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen mit verschiedenen Zielvorstellungen. Problematisch scheint die Thematisierung der gesellschaftlichen Geschlechtsvorstellung deshalb, weil sie gemäß der soziologischen Forschung nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft repräsentiert und dazu führt, dass Ungleichheiten auftreten, die bisher primär nicht in ihrem Entstehungskontext, sondern lediglich in ihren Auswirkungen hinterfragt wurden.
PISA Studien verhandeln diesbezüglich die Unterschiede von Schülerinnen und Schülern als geschlechtsspezifische Gegebenheiten, welche es lediglich durch Förderprogramme auszugleichen gilt. Ethno-methodologische Studien verkörpern hingegen die Auffassung, dass Geschlecht als soziales Konstrukt begriffen werden muss, um Verhaltensweisen und Denkstrukturen der Gesellschaftsmitglieder in ihrer Wirkungsweise nach- vollziehen und offenlegen zu können. Es gilt folglich anhand der Darstellung des soziologischen Interesses an Geschlecht und dessen Deutungsrahmen zu klären, wie die Institution Schule dies herstellt und auf welche Weise sie es (auch unbewusst) reproduziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlecht als soziale Kategorie
- Begriffsklärung von „sex“, „sex category“, „gender“ und „doing gender“
- Sozialwissenschaftliche Perspektive auf gender in der Schule im historischen Kontext
- Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität
- Der Wandel von Monoedukation zu Koedukation
- Heimlicher Lehrplan
- Ethnomethodologischer Ansatz
- Konstruktion der sozialen Wirklichkeit
- Leitidee des ethnomethodologischen Ansatzes in Bezug auf ,,doing gender“
- ,,Doing gender\" in der Schule als ethnomethodologischer Untersuchungsgegenstand
- ,,Doing gender\" in der Schule als ethnomethodologischer Untersuchungsgegenstand
- Der Fall,,Agnes\" als Beispiel für „,doing gender\" in der Ethnomethodologie
- Konstruktion von Geschlecht auf struktureller Ebene
- Feminisierung des Bildungswesens
- Hegemoniale Männlichkeit als Teil der Schule
- Konstruktion von Geschlecht auf interaktiver Ebene
- Stereotypenbildung in der Schule
- Studien zu „doing gender\" im Unterrichtsgespräch
- Generisches Maskulinum im Kontext Schule
- Konstruktion von Geschlecht auf thematischer Ebene
- Relevanz von Geschlecht im Lehrplan des Landes Hessens
- Relevanz von Geschlecht im sozialwissenschaftlichen Lehrplan des Landes Hessens
- Praxisexkurs: Lehrwerkanalyse von „,Mensch und Politik\" der Sekundarstufe 1 des Landes Hessens im Fach Politik und Wirtschaft
- Ethnomethodologische Auseinandersetzung mit der thematischen Konzeption von „doing gender“ in der Schule
- Reflexion der ethnomethodologischen Untersuchung in Bezug auf die vom Lehrplan gestellten obligatorischen Inhalte
- Der Fall,,Agnes\" als Beispiel für „,doing gender\" in der Ethnomethodologie
- Möglichkeiten des „, undoing gender\" in der Schule
- Studie zu,,Genderbeauftragten“
- Relevanz von gendergerechter Sprache im Unterricht
- Genderkompetenz für Lehrkräfte
- Dramatisierung von Geschlecht
- Entdramatisierung von Geschlecht
- Reflexive Koedukation als Kompromiss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich mit der sozialen Konstruktion von Geschlecht im Bildungskontext. Sie untersucht den Prozess des „doing gender“ in der Schule und beleuchtet dessen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Geschlechtsvorstellung.
- Die Arbeit analysiert die Entstehung und Reproduktion von Geschlechtsstereotypen im schulischen Alltag.
- Sie untersucht den Einfluss des "heimlichen Lehrplans" auf die Konstruktion von Geschlecht in der Schule.
- Die Arbeit beleuchtet die Relevanz von Geschlecht im Lehrplan des Landes Hessen.
- Sie analysiert die Möglichkeiten des "undoing gender" in der Schule, z.B. durch gendergerechte Sprache und Genderkompetenz für Lehrkräfte.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich einer Einleitung in die Thematik und führt die Relevanz der Geschlechterforschung im Kontext der gesellschaftlichen Werte- und Normordnung aus. Das zweite Kapitel behandelt die soziale Konstruktion von Geschlecht und erläutert die zentralen Begriffe „sex“, „sex category“, „gender“ und „doing gender“. Die Geschichte der Geschlechterforschung in der Schule und die Entwicklung von Monoedukation zu Koedukation werden ebenfalls beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der ethnomethodologischen Perspektive und erklärt die Leitidee des Ansatzes in Bezug auf „doing gender“ und die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit. Das vierte Kapitel fokussiert auf „doing gender“ in der Schule und analysiert die Konstruktion von Geschlecht auf struktureller, interaktiver und thematischer Ebene. Es beleuchtet die Relevanz von Geschlecht im Lehrplan und befasst sich mit dem Fall „Agnes“ als Beispiel für die ethnomethodologische Analyse. Das fünfte Kapitel beleuchtet Möglichkeiten des „undoing gender“ in der Schule, wie z.B. den Einsatz von Genderbeauftragten, die Relevanz von gendergerechter Sprache und die Förderung von Genderkompetenz für Lehrkräfte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie „doing gender“, „Geschlecht als soziale Kategorie“, „Ethnomethodologie“, „heimlicher Lehrplan“ und „Genderkompetenz“. Sie untersucht die Konstruktion von Geschlecht im Bildungskontext und die Auswirkungen von Geschlechtsstereotypen auf die gesellschaftliche Werte- und Normordnung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „doing gender“ in der Schule?
„Doing gender“ beschreibt die soziale Konstruktion von Geschlecht durch alltägliche Interaktionen und Verhaltensweisen, durch die Geschlechterrollen in der Schule ständig neu produziert werden.
Was ist der „heimliche Lehrplan“?
Der heimliche Lehrplan umfasst unbewusste Botschaften und Erwartungen von Lehrkräften, die zur Festigung von Geschlechtsstereotypen beitragen, ohne offiziell im Lehrplan zu stehen.
Wie kann „undoing gender“ in der Schule gelingen?
Möglichkeiten sind der Einsatz von Genderbeauftragten, die Verwendung gendergerechter Sprache und die Förderung der Genderkompetenz bei Lehrkräften zur Entdramatisierung von Geschlecht.
Welche Rolle spielt die Ethnomethodologie in dieser Arbeit?
Die Ethnomethodologie wird genutzt, um die sozialen Praktiken und Denkstrukturen zu untersuchen, mit denen Mitglieder der Schulgemeinschaft Geschlecht als soziale Wirklichkeit herstellen.
Was wird am Beispiel des Falls „Agnes“ verdeutlicht?
Der Fall „Agnes“ dient als klassisches ethnomethodologisches Beispiel für die aktive Herstellung einer geschlechtlichen Identität und die damit verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen.
- Arbeit zitieren
- Janine Schmitt (Autor:in), 2021, Soziale Konstruktion von Geschlecht im Bildungssystem. Eine ethnomethodologische Auseinandersetzung mit "doing gender" in der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1170852