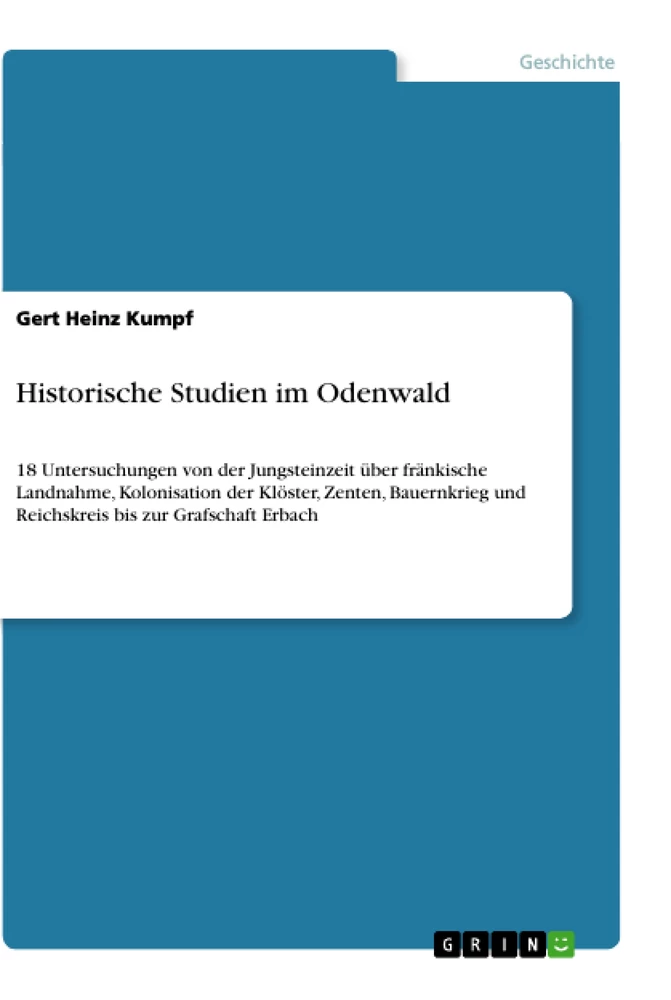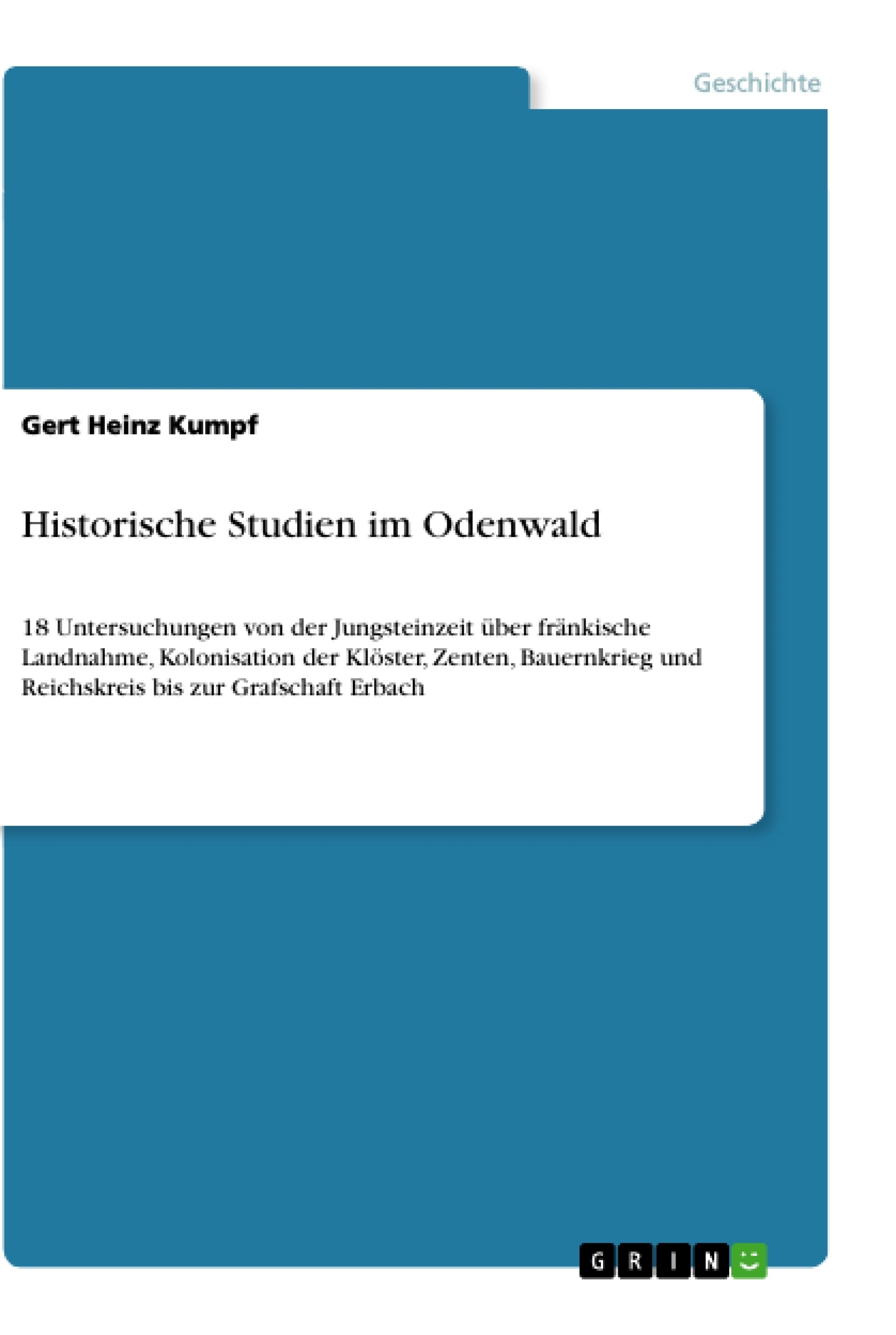Den Kern der vorliegenden historischen Studien bilden einerseits die früh- und hochmittelalterliche Besiedlung des Odenwaldes und andererseits die Herausbildung und Entwicklung von Herrschaftsstrukturen bis zum Untergang des alten Reiches 1806. In 18 einzelnen Untersuchungen schlägt der Autor einen Bogen von den Bauern der Jungsteinzeit bis zum Ende der Grafschaft Erbach.
Das Fachbuch umfasst 225 Seiten mit 31 Abbildungen.
Der prägnanten geographischen Individualität des Odenwaldes entsprechen einige historische Besonderheiten, die weniger im Bewusstsein sind.
Zum Beispiel ist der Odenwald trotz der römischen Besatzung erst von den Franken flächendeckend besiedelt worden; vier Benediktinerklöster, die Klöster Lorsch, Amorbach, Fulda und Mosbach nahmen die früh- und hochmittelalterlichen Rodungsarbeiten im Waldgebirge vor; Einhard, der Biograf Karls des Großen, war der erste Besitzer der alten Stadt Michelstadt; die Schenken von Erbach waren Vögte des Klosters Lorsch und standen im Dienst der Kurpfalz in Heidelberg; die heute vergessene Zentverwaltung war eine frühe Gerichts- und Verwaltungsstruktur; im Bauernkrieg 1525 nahm der Erbacher Schenk eine milde, vermittelnde Rolle ein; die kurz danach entstandene Grafschaft Erbach wurde Teil des Fränkischen Reichskreises; beim Wiener Kongress 1814 versuchte der Erbacher Graf, seine durch die napoleonischen Wirren verlorene Grafschaft in der Mitte des Odenwaldes wiederherzustellen.
Entgegen der Fortdauer der fürstlichen Aufteilungen im Odenwald, die den Odenwald nur als Randgebiete dreier Bundesländer existieren lassen, plädiert der Autor für eine geschichtsbewusstere Haltung. Sein Fazit: „Der Odenwald hat seit 1806 keinen historischen Mittelpunkt mehr; bis dahin waren es die Grafschaft Erbach, die Herrschaft Breuberg (=Graf von Wertheim) und die Benediktinerabtei Amorbach.“ (S. 199)
Die historischen Untersuchungen werden durch geographische Forschungsmethoden ergänzt; zu nennen sind Siedlungsgeographie, Ortsnamenforschung, Agrargeographie, Karteninterpretation und die praktische Exkursion.
Das vorliegende Buch fasst alle historischen Arbeiten des Autors zum Odenwald in einer erweiterten Neuauflage zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- 1 Erste Besiedlungsspuren im Rhein-Main-Gebiet
- 1.1 Bandkeramische Bauern der Jungsteinzeit
- 1.2 Kelten und Wanderung der Kimbern
- 1.3 Römer und Alemannen
- 2 Landnahme der Franken im Odenwaldraum
- 2.1 Fränkische Besiedlung ab 496 n. Chr.
- 2.2 Fränkische Gaue und Gaugrafen
- 2.3 Fränkische Königshöfe und Martinskirchen
- 3 Waldmarken des Odenwaldes
- 3.1 Einrichtung der Waldmarken
- 3.2 Waldmark Heppenheim und Mark Michelstadt
- 4 Organisation der Odenwald-Besiedlung
- 4.1 Siedlungsträger und Rodungsperioden
- 4.2 Benediktinischer Geist und Siedler
- 4.3 Villikationen und Waldhufendörfer
- 5 Kolonisation des Benediktinerklosters Lorsch
- 5.1 Kloster Lorsch im Vorderen Odenwald
- 5.2 Gang in den Buntsandstein-Odenwald
- 6 Kolonisation des Benediktinerklosters Amorbach
- 6.1 Kloster Amorbach im Hinteren Odenwald
- 6.2 Zugewinn der oberen Zent Mudau
- 7 Siedlungsträger im nördlichen Odenwald
- 7.1 Gründungen des Benediktinerklosters Fulda
- 7.2 Andere Herren im nördlichen Odenwald
- 8 Siedlungsträger im südlichen Odenwald
- 8.1 Eine Gründung des Bistums Worms
- 8.2 Weltliche Träger im Neckartal-Odenwald
- 8.3 Gründungen des Benediktinerklosters Mosbach
- 9 Beispiel einer Villikation: Beerfelden
- 9.1 Geographische Lage und Namensdeutung
- 9.2 Wo war der Fronhof Beerfeldens?
- 9.3 Martinskirche und Pastorei
- 9.4 Blockgewannflur, Huben, Allmende
- 9.5 Leibeigenschaft, Zehnter und Fronakkord
- 9.6 Tuchmacherei und Sozialstruktur 1691
- 10 Beispiele angelegter Waldhufendörfer
- 10.1 Ältestes Waldhufendorf: Zotzenbach
- 10.2 Waldhufendorf im Buntsandstein: Airlenbach
- 10.3 Plansiedlung im Amorbacher Raum: Boxbrunn
- 11 Herrschaftsanfänge im Odenwald
- 11.1 Fränkischer Königshof, Sankt Michael
- 11.2 Einhard erhält die Mark Michelstadt
- 12 Die Schenken von Erbach
- 12.1 Ihre Herkunft; Klostervögte von Lorsch
- 12.2 Burg Erbach und Burgmannen-Siedlung
- 13 Die Zentverwaltung im Odenwald
- 13.1 Die Zent: Begriff und Forschungsgegenstand
- 13.2 Zentgraf und Gerichtsmänner
- 13.3 Aufgabe Wehrverfassung
- 13.4 Aufgabe Zentgericht
- 13.5 Vier weitere Aufgaben der Zent
- 13.6 Spuren alter Zenten in Odenwald und Ostfranken
- 14 Der Bauernkrieg im Odenwald
- 14.1 Schenk Eberhard XIII. im Bauernkrieg 1525
- 14.2 Ein Gerichtstag im Schlosshof zu Erbach
- 14.3 Eberhards Bedeutung und Andenken
- 15 Die Entstehung der Grafschaft Erbach
- 15.1 Der Erwerb des Grafentitels 1532
- 15.2 Die Reformation in der Grafschaft
- 16 Der Odenwald im Fränkischen Reichskreis
- 16.1 Die Gründung des Fränkischen Reichskreises
- 16.2 Das Fränkische Reichsgrafenkollegium
- 16.3 Sonderstellung des Ritterkantons Odenwald
- 16.4 Herrschaften um 1550; weitere Entwicklung
- 16.5 Der Odenwald vor der Französischen Revolution
- 17 Napoleon gestaltet den Odenwald um
- 17.1 Reichsdeputationshauptschluss 1803
- 17.2 Rheinbundakte und Auflösung des Reiches 1806
- 17.3 Besitzergreifung der Grafschaft durch Hessen
- 18 Reaktion der Odenwälder auf die neuen Herren
- 18.1 Widerstand der Bevölkerung
- 18.2 Beschwerde der Erbacher Grafen wider Hessen
- 18.3 Versuch die Grafschaft Erbach wiederherzustellen
- 18.4 Warum der Odenwald ein Teil Frankens bleibt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Odenwaldes von der frühen Besiedlung bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches. Die Hauptziele sind die Darstellung der früh- und hochmittelalterlichen Besiedlung sowie die Entwicklung der Herrschaftsstrukturen in der Region. Die geographischen Methoden ergänzen die historischen Quellen.
- Frühmittelalterliche Besiedlung des Odenwaldes
- Rolle der Benediktinerklöster bei der Kolonisation
- Entwicklung von Herrschaftsstrukturen im Odenwald
- Die Zentverwaltung als Beispiel mittelalterlicher Selbstverwaltung
- Der Bauernkrieg und die Rolle des Erbacher Grafen
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Einführung: Diese Einleitung bietet einen Überblick über die geographischen und historischen Besonderheiten des Odenwaldes, die im weiteren Verlauf der Studie detailliert untersucht werden. Sie hebt die einzigartige Besiedlungsgeschichte, die Rolle der Klöster, die Zentverwaltung, den Bauernkrieg und das Schicksal der Grafschaft Erbach hervor und stellt die 18 Einzeluntersuchungen vor, die von der Jungsteinzeit bis zur napoleonischen Ära reichen.
1 Erste Besiedlungsspuren im Rhein-Main-Gebiet: Dieses Kapitel untersucht die frühen Besiedlungsspuren im Odenwald und seinem Umfeld, beginnend mit den bandkeramischen Bauern der Jungsteinzeit, über die Kelten und die Kimbern bis hin zu den Römern und Alemannen. Es wird deutlich, dass der Odenwald selbst erst spät, nach der römischen Herrschaft, von den Franken besiedelt wurde.
2 Landnahme der Franken im Odenwaldraum: Dieses Kapitel beschreibt die fränkische Landnahme im Odenwaldraum ab 496 n. Chr. und die anschließende Einteilung des Landes in Gaue und die Rolle der Gaugrafen. Es analysiert die Entstehung des Wortes "Gau" und seine Bedeutung im Kontext der frühen fränkischen Besiedlung. Weiterhin werden fränkische Königshöfe und die Verbreitung von Martinskirchen diskutiert.
3 Waldmarken des Odenwaldes: Das Kapitel erläutert die Einteilung des Odenwaldes in Waldmarken im 8. Jahrhundert und die Übertragung dieser Marken an Klöster zur Besiedlung. Es konzentriert sich auf die Waldmarken Heppenheim und Michelstadt, und beschreibt die Bedeutung der Grenzbereinigung von 795 n. Chr. auf dem Kahlberg.
4 Organisation der Odenwald-Besiedlung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Organisation der Odenwald-Besiedlung, den wichtigsten Siedlungsträgern (Klöster und weltliche Herren) und den Rodungsperioden. Es untersucht den „benediktinischen Geist“ und die Rolle der unfreien Siedler sowie die Entstehung des Villikationssystems und der Waldhufendörfer.
5 Kolonisation des Benediktinerklosters Lorsch: Das Kapitel beschreibt die Kolonisationstätigkeit des Klosters Lorsch, beginnend mit der Schenkung der Waldmark Heppenheim durch Karl den Großen. Es analysiert die verschiedenen Siedlungsvorstöße des Klosters in den Vorderen und Buntsandstein-Odenwald und die Bedeutung des Lorscher Codex als Quelle.
6 Kolonisation des Benediktinerklosters Amorbach: Dieses Kapitel widmet sich der Kolonisation des Hinteren Odenwaldes durch das Kloster Amorbach. Es beleuchtet die Geschichte des Klosters, die Herausbildung der Zent Amorbach und die unterschiedliche Siedlungsform im Vergleich zum Kloster Lorsch.
7 Siedlungsträger im nördlichen Odenwald: Das Kapitel untersucht die Rolle des Klosters Fulda und anderer weltlicher Herren bei der Besiedlung des nördlichen Odenwaldes. Es analysiert die fuldaischen Besitzungen, die Herrschaft Breuberg und die Siedlungsformen in diesem Bereich.
8 Siedlungsträger im südlichen Odenwald: Dieses Kapitel behandelt die komplexe Besiedlungsgeschichte des südlichen Odenwaldes, die Rolle des Bistums Worms und der verschiedenen weltlichen Herren, sowie die Kolonisationstätigkeit des Klosters Mosbach. Es wird die Siedlungsaktivität am Neckar analysiert und die Grenzen der Gaue diskutiert.
9 Beispiel einer Villikation: Beerfelden: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der Villikation Beerfelden als Beispiel für die Organisation der Odenwald-Besiedlung. Es untersucht die geographische Lage, die Namensdeutung, den Fronhof, die Martinskirche und die Pastorei, die Flurformen (Blockgewannflur und Waldhufenflur), die Leibeigenschaft, den Zehnten und die Frondienste sowie die Entwicklung der Tuchmacherei und der Sozialstruktur.
10 Beispiele angelegter Waldhufendörfer: Anhand der Beispiele Zotzenbach (als ältestes Waldhufendorf), Airlenbach (im Buntsandstein) und Boxbrunn (als Plansiedlung) werden die verschiedenen Formen der Waldhufensiedlungen im Odenwald veranschaulicht und analysiert. Es werden die Unterschiede in der Anlage und der Flurstruktur beleuchtet.
11 Herrschaftsanfänge im Odenwald: Das Kapitel befasst sich mit den Anfängen der Herrschaft im Odenwald, von den Kelten und Römern bis hin zu den Franken. Es konzentriert sich auf den fränkischen Königshof in Michelstadt und die Rolle Einhards bei der Entwicklung der Mark Michelstadt.
12 Die Schenken von Erbach: Dieses Kapitel untersucht die Herkunft, den Aufstieg und die Rolle der Schenken von Erbach als Klostervögte von Lorsch und als eigenständige Territorialherren. Es analysiert die Bedeutung der Burg Erbach und die Entstehung der Burgmannensiedlung.
13 Die Zentverwaltung im Odenwald: Dieses Kapitel analysiert die Zentverwaltung im Odenwald, ihre Entstehung, ihren Aufbau und ihre Funktionen. Es beleuchtet die Rolle des Zentgrafen und der Gerichtsmänner sowie die Aufgaben der Zent im Bereich der Wehrverfassung, der Rechtsprechung, der öffentlichen Ordnung, der Brandbekämpfung und der Vermögensverwaltung. Es wird auch auf die Spuren der Zenten in Ostfranken eingegangen.
14 Der Bauernkrieg im Odenwald: Das Kapitel untersucht die Rolle des Erbacher Schenken im Bauernkrieg von 1525, seine militärische Beteiligung und sein gemäßigtes Vorgehen gegenüber den aufständischen Bauern. Es analysiert den Gerichtstag im Schlosshof zu Erbach und Eberhards Bedeutung und Andenken.
15 Die Entstehung der Grafschaft Erbach: Dieses Kapitel beschreibt die Erhebung der Erbacher Schenken in den Grafenstand 1532 und die Bedeutung dieses Ereignisses im Kontext der Rolle Eberhards XIII. im Bauernkrieg. Es wird auch die Einführung der Reformation in der Grafschaft Erbach behandelt.
16 Der Odenwald im Fränkischen Reichskreis: Das Kapitel untersucht die Zugehörigkeit des Odenwaldes zum Fränkischen Reichskreis seit 1500 und die Bedeutung dieses Verbundes für die Region. Es analysiert das Fränkische Reichsgrafenkollegium, den Ritterkanton Odenwald und die politischen Verhältnisse im Odenwald um 1550.
17 Napoleon gestaltet den Odenwald um: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen der napoleonischen Herrschaft auf den Odenwald, den Reichsdeputationshauptschluss von 1803, die Rheinbundakte von 1806 und die Eingliederung der Grafschaft Erbach in das Großherzogtum Hessen-Darmstadt.
18 Reaktion der Odenwälder auf die neuen Herren: Das Kapitel beschreibt den Widerstand der Odenwälder Bevölkerung gegen die hessische Herrschaft und die Bemühungen des Erbacher Grafenhauses um die Wiederherstellung der Grafschaft beim Wiener Kongress. Es wird die dauerhafte Aufteilung des Odenwaldes unter drei Bundesstaaten und die fränkische kulturelle Identität der Region beleuchtet.
Schlüsselwörter
Odenwald, Besiedlungsgeschichte, Franken, Benediktinerklöster, Kolonisation, Waldhufendorf, Zent, Zentgraf, Bauernkrieg, Grafschaft Erbach, Fränkischer Reichskreis, Napoleon, Mediatisierung, Ortsnamenforschung, Siedlungsgeographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Besiedlungsgeschichte des Odenwaldes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Geschichte des Odenwaldes, von der frühen Besiedlung bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches. Der Fokus liegt auf der früh- und hochmittelalterlichen Besiedlung sowie der Entwicklung der Herrschaftsstrukturen in der Region. Geographische Methoden ergänzen die historischen Quellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine breite Palette an Themen, darunter die frühmittelalterliche Besiedlung des Odenwaldes, die Rolle der Benediktinerklöster bei der Kolonisation, die Entwicklung von Herrschaftsstrukturen (insbesondere die Zentverwaltung), den Bauernkrieg und die Rolle des Erbacher Grafen, sowie die Auswirkungen der napoleonischen Herrschaft und die Mediatisierung der Grafschaft Erbach. Die Untersuchung reicht von der Jungsteinzeit bis in die napoleonische Ära.
Welche Epochen werden abgedeckt?
Die Arbeit deckt einen Zeitraum von der Jungsteinzeit (Bandkeramik) bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches und der napoleonischen Zeit ab. Die einzelnen Kapitel befassen sich mit verschiedenen Phasen der Besiedlung und Entwicklung des Odenwaldes.
Welche Rolle spielten die Benediktinerklöster?
Die Benediktinerklöster, insbesondere Lorsch und Amorbach, spielten eine entscheidende Rolle bei der Kolonisation des Odenwaldes. Die Arbeit untersucht deren Kolonisationstätigkeit, die Gründung von Siedlungen und die Organisation des besiedelten Gebietes.
Wie war der Odenwald organisiert?
Die Organisation des Odenwaldes wird anhand verschiedener Aspekte untersucht: die Einteilung in Gaue, die Zentverwaltung mit ihren Funktionen und Aufgaben (Wehrverfassung, Rechtsprechung etc.), die Entstehung von Waldmarken und die verschiedenen Siedlungsformen (Waldhufendörfer, Villikationen).
Was war der Bauernkrieg und welche Rolle spielte der Erbacher Graf?
Der Bauernkrieg von 1525 wird im Kontext des Odenwaldes behandelt, insbesondere die Rolle des Erbacher Grafen Eberhard XIII. und sein Umgang mit dem Aufstand. Die Arbeit untersucht die Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Region.
Welche Auswirkungen hatte Napoleon auf den Odenwald?
Die napoleonische Zeit brachte gravierende Veränderungen mit sich: der Reichsdeputationshauptschluss von 1803, die Auflösung des Reiches 1806 und die Eingliederung der Grafschaft Erbach in das Großherzogtum Hessen-Darmstadt werden analysiert. Die Reaktionen der Bevölkerung und die Bemühungen um die Wiederherstellung der Grafschaft werden ebenfalls behandelt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Kombination aus historischen Quellen und geographischen Methoden. Der Lorscher Codex wird beispielsweise als Quelle genannt. Weitere Quellen sind im Detail in der Arbeit selbst zu finden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in 18 Kapitel, die chronologisch und thematisch die Besiedlungs- und Herrschaftsgeschichte des Odenwaldes abdecken. Eine detaillierte Übersicht findet sich im Inhaltsverzeichnis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung und einer Übersicht über die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitelübersichten, die jeweils einen Überblick über den Inhalt der einzelnen Kapitel geben. Die Arbeit endet mit einer Liste von Schlüsselwörtern.
- Quote paper
- M.A. Gert Heinz Kumpf (Author), Historische Studien im Odenwald, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1169772