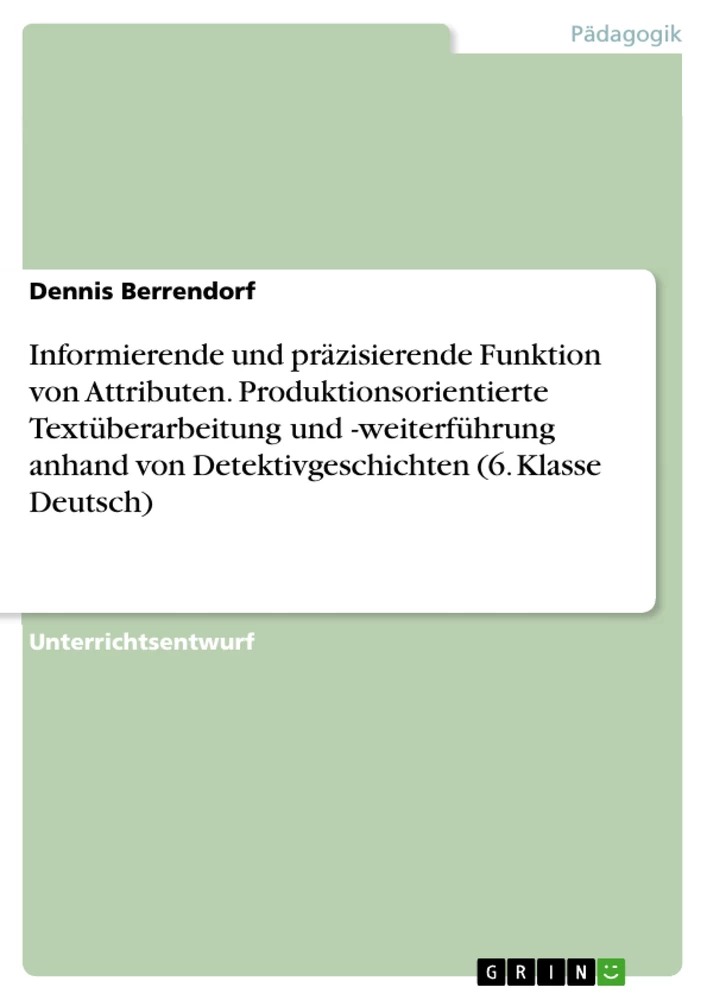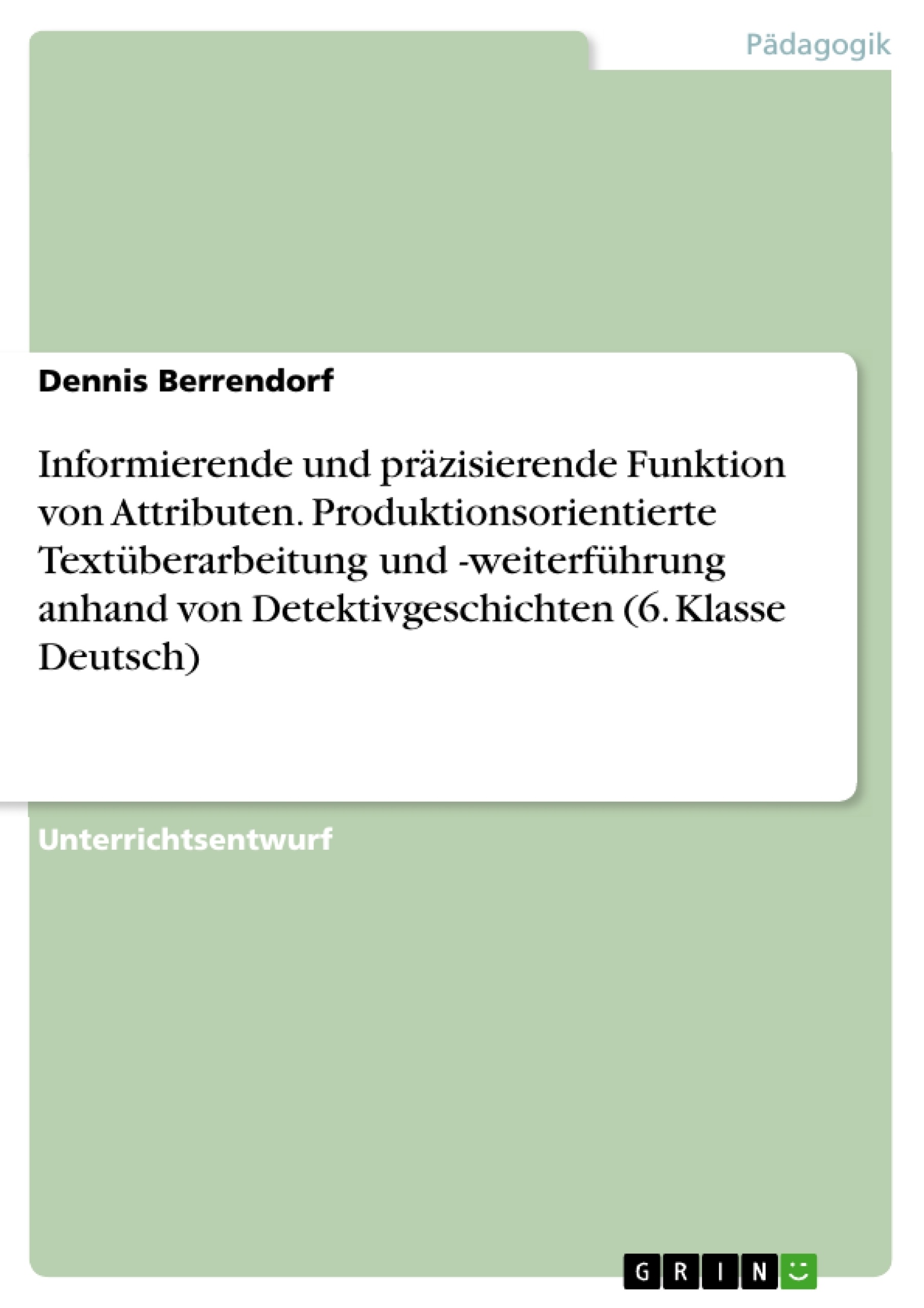In der Deutschstunde dieses Unterrichtsentwurfs für die 6te Klasse einer Gesamtschule sollen die SuS ihre Kompetenzen im Bereich "Sprachliche Formen und Strukturen in ihren Funktionen" sowie im Bereich "Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien" erweitern, indem sie fehlende Attribute in einer Detektivgeschichte als stilistische Schwachstelle identifizieren, produktionsorientiert überarbeiten und die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Problemfrage beurteilen. Die SuS erfassen den Inhalt der Geschichte und beschreiben ihn zusammen mit ihrem Arbeitspartner unter Zuhilfenahme der Erschließungsfragen. Sie entdecken problemhaltige Stellen hinsichtlich der stilistischen Wirkung des Textes, indem sie aspektgeleitet untersuchen und sich dabei ihres Wissens über die Funktion von Attributen bedienen.
In einem binnendifferenzierten Lernarrangement mit verschiedenen Niveaustufen überarbeiten die SuS den Text oder gestalten eine Fortsetzung der Geschichte unter Berücksichtigung von grammatisch-stilistischen Kriterien. Die SuS geben ein erstes Feedback unter Berücksichtigung von Kriterien und den Feedback-Regeln, indem sie die entstandenen Lernprodukte im Hinblick auf ihre grammatisch-stilistische und kreative Qualität beurteilen. Sie begründen die Problemfrage, indem sie für die stilistisch wertvolle Funktion von Attributen durch einen Vergleich der Lernprodukte im Hinblick auf die Ausgangsgeschichte argumentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Tabellarischer Aufbau des Unterrichtsvorhabens
- Didaktisch-methodische Überlegungen zu den längerfristigen Unterrichtszusammenhängen
- Angaben zu den Lernzielen bzw. Kompetenzen der Stunde
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur Unterrichtsstunde
- Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler
- Sachanalyse
- Didaktische Überlegungen
- Begründung der wesentlichen methodischen Entscheidungen
- Tabellarischer Verlaufsplan der Unterrichtsstunde
- Quellen- und Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Arbeit dokumentiert eine unterrichtspraktische Prüfung zum Thema "Wie kann die Geschichte präziser dargestellt werden?". Ziel ist die funktionale Anwendung der informierenden und präzisierenden Funktion von Attributen im Rahmen einer produktionsorientierten Textüberarbeitung und -weiterführung. Die Arbeit analysiert die didaktisch-methodischen Überlegungen und den Verlauf einer Unterrichtsstunde in einer Inklusionsklasse.
- Analyse der Lernausgangslage einer Inklusionsklasse
- Funktionale Anwendung von Attributen zur Präzisierung von Texten
- Produktionsorientierter Umgang mit Texten und Medien
- Kooperative Textüberarbeitung
- Stilistische Wirkung von Satzgliedabfolgen
Zusammenfassung der Kapitel
Tabellarischer Aufbau des Unterrichtsvorhabens: Dieser Abschnitt präsentiert einen detaillierten Stundenplan über mehrere Wochen, der den Verlauf der Unterrichtsreihe "Satzglieder und ihre Funktionen" zeigt. Jedes Datum beinhaltet ein spezifisches Stundenthema, das sich schrittweise von der induktiven Erarbeitung von Satzgliedern bis hin zur kooperativen Textüberarbeitung und abschließenden Klassenarbeit erstreckt. Die Themen bauen aufeinander auf und demonstrieren einen didaktischen Ansatz, der die Schüler schrittweise an komplexere grammatikalische und stilistische Aspekte heranführt.
Didaktisch-methodische Überlegungen zu den längerfristigen Unterrichtszusammenhängen: Dieser Teil beschreibt detailliert die Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler, unter Berücksichtigung der individuellen Förderbedarfe in der Inklusionsklasse. Es werden die spezifischen Lernvoraussetzungen und Herausforderungen der einzelnen Schüler mit Förderbedarf (Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung) dargestellt und die gewählten methodischen Anpassungen erläutert. Der Abschnitt analysiert weiter die grammatischen Phänomene (Satzglieder, Adverbiale Bestimmungen, Attribute), die im Unterricht behandelt werden, und erklärt den integrativen Grammatikunterrichtsansatz.
Angaben zu den Lernzielen bzw. Kompetenzen der Stunde: Dieser Abschnitt spezifiziert die Lernziele und Kompetenzen, die die Schüler im Laufe der Unterrichtsreihe erwerben sollen. Es werden die zu erreichenden Kompetenzen nach dem Kernlehrplan für Deutsch in Nordrhein-Westfalen benannt, beispielsweise die korrekte Bezeichnung von Satzgliedern, die Analyse stilistischer Wirkungen und die produktionsorientierte Textüberarbeitung. Die Lernziele sind an den Kompetenzen des Kernlehrplans ausgerichtet und beschreiben die angestrebten Fähigkeiten der Schüler im Umgang mit Grammatik und Stil.
Didaktisch-methodische Überlegungen zur Unterrichtsstunde: Dieser Abschnitt bietet eine tiefgehende Analyse der Unterrichtsstunde. Er gliedert sich in die Lernausgangslage, die Sachanalyse, die didaktischen Überlegungen und die Begründung methodischer Entscheidungen. Die Sachanalyse beschreibt die grammatischen Phänomene (Attribute und ihre Funktion) und die didaktischen Überlegungen begründen den gewählten methodischen Ansatz, der auf einem integrativen Grammatikunterricht basiert. Die Begründung der methodischen Entscheidungen liefert eine detaillierte Erklärung der gewählten Vorgehensweise und deren didaktische Fundierung.
Häufig gestellte Fragen zur unterrichtspraktischen Prüfung: "Wie kann die Geschichte präziser dargestellt werden?"
Was ist der Gegenstand dieser schriftlichen Arbeit?
Die Arbeit dokumentiert eine unterrichtspraktische Prüfung zum Thema "Wie kann die Geschichte präziser dargestellt werden?". Sie fokussiert auf die funktionale Anwendung von Attributen zur Textpräzisierung in einer produktionsorientierten Textüberarbeitung und -weiterführung innerhalb einer Inklusionsklasse.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die didaktisch-methodischen Überlegungen und den Ablauf einer Unterrichtsstunde. Sie umfasst die Analyse der Lernausgangslage der Inklusionsklasse, die funktionale Anwendung von Attributen zur Textpräzisierung, den produktionsorientierten Umgang mit Texten und Medien, die kooperative Textüberarbeitung und die stilistische Wirkung von Satzgliedabfolgen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, die einen detaillierten Stundenplan (über mehrere Wochen), didaktisch-methodische Überlegungen zu den längerfristigen Unterrichtszusammenhängen, die Lernziele und Kompetenzen der Stunde, sowie eine tiefgehende Analyse der Unterrichtsstunde selbst beinhalten. Zusätzlich enthält sie einen tabellarischen Verlaufsplan, ein Quellen- und Abbildungsverzeichnis und einen Anhang.
Was wird im Kapitel "Tabellarischer Aufbau des Unterrichtsvorhabens" beschrieben?
Dieses Kapitel präsentiert einen detaillierten Stundenplan über mehrere Wochen, der den Verlauf der Unterrichtsreihe "Satzglieder und ihre Funktionen" zeigt. Es beinhaltet die schrittweise Auseinandersetzung mit Satzgliedern, bis hin zur kooperativen Textüberarbeitung und einer abschließenden Klassenarbeit.
Was beinhaltet der Abschnitt "Didaktisch-methodische Überlegungen zu den längerfristigen Unterrichtszusammenhängen"?
Dieser Teil beschreibt detailliert die Lernausgangslage der Schüler, inklusive der individuellen Förderbedarfe in der Inklusionsklasse. Er erläutert die Lernvoraussetzungen und Herausforderungen der Schüler mit Förderbedarf und die gewählten methodischen Anpassungen. Weiterhin analysiert er die behandelten grammatischen Phänomene (Satzglieder, Adverbiale Bestimmungen, Attribute) und den integrativen Grammatikunterrichtsansatz.
Welche Lernziele und Kompetenzen werden im Kapitel "Angaben zu den Lernzielen bzw. Kompetenzen der Stunde" spezifiziert?
Dieser Abschnitt spezifiziert die Lernziele und Kompetenzen, die die Schüler erwerben sollen. Es werden Kompetenzen nach dem Kernlehrplan für Deutsch in Nordrhein-Westfalen benannt, wie die korrekte Bezeichnung von Satzgliedern, die Analyse stilistischer Wirkungen und die produktionsorientierte Textüberarbeitung. Die Lernziele sind an den Kompetenzen des Kernlehrplans ausgerichtet.
Wie ist das Kapitel "Didaktisch-methodische Überlegungen zur Unterrichtsstunde" aufgebaut?
Dieser Abschnitt bietet eine tiefgehende Analyse der Unterrichtsstunde, gegliedert in Lernausgangslage, Sachanalyse, didaktische Überlegungen und die Begründung methodischer Entscheidungen. Die Sachanalyse beschreibt die grammatischen Phänomene (Attribute und ihre Funktion), und die didaktischen Überlegungen begründen den gewählten methodischen Ansatz (integrativer Grammatikunterricht). Die Begründung der methodischen Entscheidungen liefert eine detaillierte Erklärung der gewählten Vorgehensweise und deren didaktische Fundierung.
- Citar trabajo
- Dennis Berrendorf (Autor), 2018, Informierende und präzisierende Funktion von Attributen. Produktionsorientierte Textüberarbeitung und -weiterführung anhand von Detektivgeschichten (6. Klasse Deutsch), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1168691