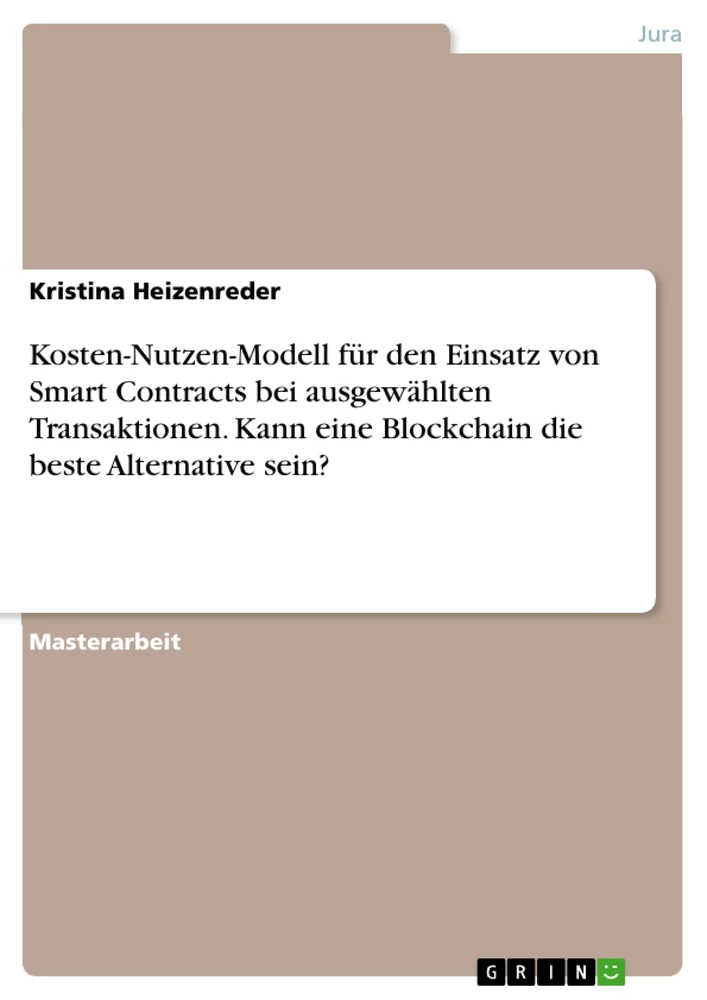Das Ziel dieser Arbeit ist, ein Kosten-Nutzen-Modell (KNM) zu erstellen, dass Nutzer dieses Modells verpflichtet, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen, bevor sie Smart Contracts einsetzen. Da Smart Contracts vor allem im Finanzsektor ein großes Einsatzpotenzial haben, konzentrieren sich die nachfolgenden Ausführungen dieser Arbeit ausschließlich auf diesen Bereich.
Eines der primären Ziele von Satoshi Nakamoto war es, mit der Inbetriebnahme der Blockchain, eine Technologie zu präsentieren, die das Vertrauen in zentrale Finanzinstitute infolge deren Eliminierung entbehrlich machen sollte. Schaffen sollte das die Blockchain-Technologie durch ihre Dezentralität und Unveränderbarkeit.
Doch die vorliegende Arbeit dreht sich nicht um die mögliche Revolutionierung des Finanzsystems, sondern um diejenige von herkömmlichen Verträgen und der herkömmlichen Vertragsausführung. Die Rede ist von Smart Contracts und ihrem Vordenker Nicholas Szabo. Szabo hatte bereits 1994 ähnliche Visionen wie Satoshi Nakamoto. Mit Smart Contracts wollte Nick Szabo ein computergestütztes Transaktionsprotokoll schaffen, das die automatisierte Ausführung von Vertragsbedingungen garantiert.
21 Jahre später, im Jahr 2015, scheint sich Nick Szabos Vision mit der Veröffentlichung der Ethereum-Blockchain und ihrer unbegrenzten Verarbeitungsmöglichkeiten zu erfüllen. Mittlerweile können die komplexesten Smart Contracts programmiert und ausgeführt werden. Doch noch immer scheint es keine Sicherheit zu geben, wie Smart Contracts und einige ihrer Komponenten rechtlich einzuordnen sind. So werden einzelne Fragestellungen bereits in Literatur und Praxis diskutiert. In die deutsche Rechtsordnung sind Smart Contracts allerdings noch nicht vollständig eingezogen.
Dennoch haben sich Smart Contracts in Konsortien, Unternehmen oder der Wissenschaft etabliert und zu einem regelrechten Hype entwickelt, vor allem in der Finanzindustrie, die vom disruptiven Charakter der Smart Contracts wohl am stärksten betroffen sein wird. Auffallend ist jedoch, dass nur ein Bruchteil der Pilotprojekte von Konsortien, Unternehmen uvm. auch produktiv realisiert und eingesetzt werden. Gründe dafür sind beispielsweise, dass Kosten und zeitlicher Aufwand unterschätzt werden oder die ausgewählten Prozesse für den Einsatz von Smart Contracts ungeeignet sind. Bei einigen Projekten fehlt sogar die Zielsetzung, welcher Nutzen mit dem Einsatz von Smart Contracts erreicht werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand und Problemstellung
- Zielsetzung und Erkenntnisinteresse
- Methodiken
- Literaturarbeit
- Experteninterviews
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Blockchain-Technologie
- Begriffsdefinition
- Distributed-Ledger-Technologie
- Funktionsweise einer Blockchain
- Typologie
- Smart Contracts
- Begriffsdefinition
- Funktionsweise eines Smart Contracts in Ethereum
- Fazit
- Potenzial und Grenzen von Smart Contracts
- Anwendungspotenzial von Smart Contracts
- Wertpapierabwicklung
- Kreditvergabe
- Weitere Anwendungspotenziale
- Technische Grenzen der Blockchain-Technologie
- Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit
- Anbindung der Blockchain an IT-Systeme
- Off-Chain-Daten und Sicherheit in der Blockchain
- Fehlender Standard
- Lösungsvorschlag
- Rechtliche Grenzen von Smart Contracts
- Vertragsschluss mit Smart Contracts
- Vertragsabwicklung mit Smart Contracts
- Fazit
- Nutzung des Kosten-Nutzen-Modells
- Kosten-Nutzen-Modell (KNM)
- Definition des Problems
- Auswahl von Alternativen
- Erstellung eines Zielsystems
- Gliederung und Gewichtung der Kriterien
- Bewertung der Alternativen
- Nutzenbewertung
- Sensitivitätsanalyse
- Kritische Würdigung des Modells
- Zusammenfassung
- Ergebnisse der Arbeit
- Grenzen der Arbeit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten von Smart Contracts im Kontext ausgewählter Transaktionen und analysiert das Potenzial dieser Technologie im Vergleich zu traditionellen Verfahren. Im Vordergrund steht dabei die Bewertung der Kosten und des Nutzens von Smart Contracts anhand eines Kosten-Nutzen-Modells.
- Die Funktionsweise und das Anwendungspotenzial von Smart Contracts
- Die technischen und rechtlichen Herausforderungen bei der Implementierung von Smart Contracts
- Die Entwicklung eines Kosten-Nutzen-Modells zur Bewertung der Einsatzmöglichkeiten von Smart Contracts
- Die Anwendung des Kosten-Nutzen-Modells auf konkrete Anwendungsfälle
- Die kritische Analyse der Ergebnisse und die Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas vor. Sie erläutert den aktuellen Forschungsstand und die Methoden, die in der Arbeit verwendet werden.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Blockchain-Technologie und der Smart Contracts. Es werden wichtige Begriffe definiert und die Funktionsweise der Blockchain und der Smart Contracts erklärt.
Kapitel 3 analysiert das Potenzial und die Grenzen von Smart Contracts. Es werden verschiedene Anwendungsfälle von Smart Contracts vorgestellt und deren Vorteile und Nachteile diskutiert. Darüber hinaus werden die technischen und rechtlichen Herausforderungen bei der Implementierung von Smart Contracts beleuchtet.
In Kapitel 4 wird das Kosten-Nutzen-Modell vorgestellt und dessen Anwendung auf die Bewertung von Smart Contracts im Vergleich zu traditionellen Verfahren erläutert. Der Fokus liegt auf der Definition des Problems, der Auswahl von Alternativen und der Erstellung eines Zielsystems.
Die Ergebnisse der Arbeit und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen werden in Kapitel 5 zusammengefasst. Die Arbeit endet mit einer kritischen Würdigung der Ergebnisse und einem Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Smart Contracts, Blockchain-Technologie, Kosten-Nutzen-Modell, Transaktionen, Wertpapierabwicklung, Kreditvergabe, Rechtliche Rahmenbedingungen, Technische Herausforderungen, Anwendungspotenzial.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Kosten-Nutzen-Modell für Smart Contracts?
Es ist ein Modell zur ganzheitlichen Bewertung, ob der Einsatz von Smart Contracts gegenüber traditionellen Verfahren wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.
In welchem Sektor haben Smart Contracts das größte Potenzial?
Die Arbeit konzentriert sich primär auf den Finanzsektor, insbesondere auf die Bereiche Wertpapierabwicklung und Kreditvergabe.
Wer war der Vordenker der Smart Contracts?
Nicholas Szabo entwarf bereits 1994 die Vision computergestützter Transaktionsprotokolle, die Vertragsbedingungen automatisiert ausführen.
Welche technischen Grenzen hat die Blockchain-Technologie?
Zu den Grenzen zählen die Skalierbarkeit, die Anbindung an bestehende IT-Systeme sowie die sichere Integration von Off-Chain-Daten.
Sind Smart Contracts in Deutschland rechtlich voll anerkannt?
Nein, Smart Contracts sind noch nicht vollständig in die deutsche Rechtsordnung integriert, und Fragen zum Vertragsschluss und zur Haftung werden noch diskutiert.
Warum scheitern viele Pilotprojekte mit Smart Contracts?
Häufig werden Kosten und Zeitaufwand unterschätzt oder die gewählten Prozesse erweisen sich als ungeeignet für eine Automatisierung per Blockchain.
- Citation du texte
- Kristina Heizenreder (Auteur), 2020, Kosten-Nutzen-Modell für den Einsatz von Smart Contracts bei ausgewählten Transaktionen. Kann eine Blockchain die beste Alternative sein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167853