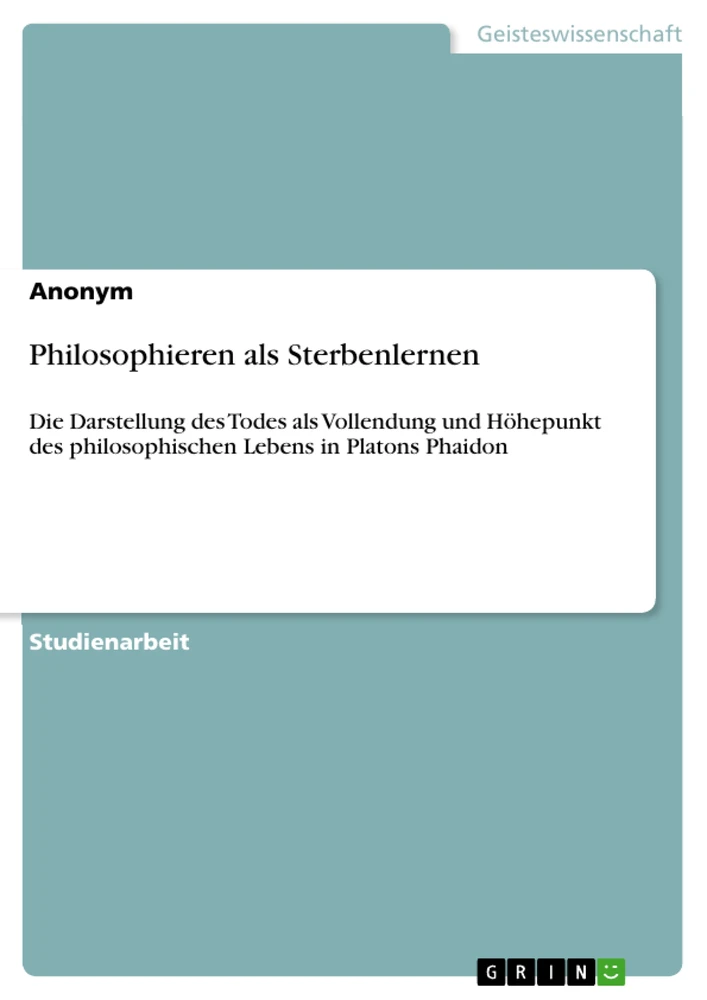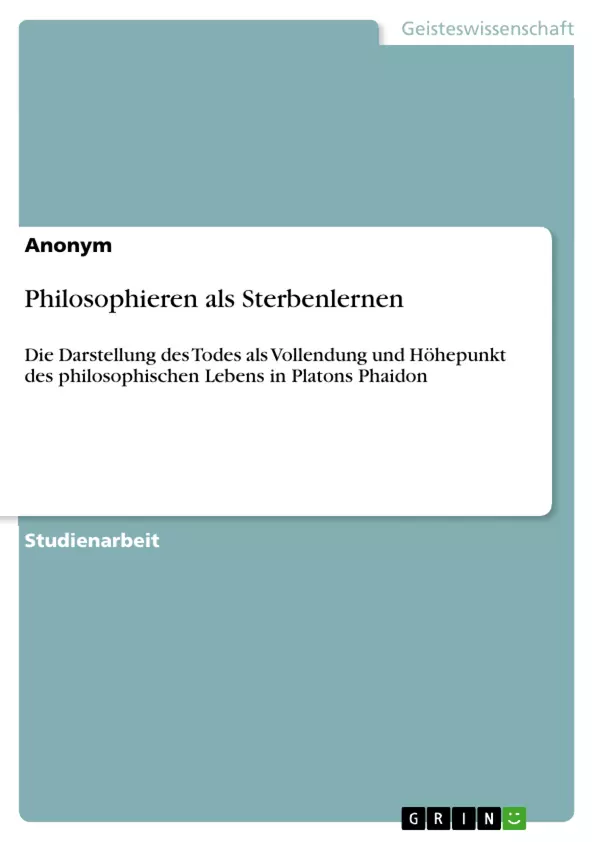Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Philosophieren und dem Sterben, insbesondere der Bedeutung für das ‚Sterbenlernen‘. Bereits in Barbara Zehnpfennigs Einführung ist die Rede davon, dass „[die] Philosophie […] nichts anderes zu sein [scheint] als Sterbenlernen“. Aus dieser These heraus entstand die Fragestellung, die in dieser Arbeit untersucht wird, nämlich: Inwiefern kann man Platons philosophische Sicht-weise auf den Tod als ‚Philosophie des Sterbenlernens‘ auffassen? Hierfür werden zunächst relevante Begriffe definiert und entsprechende Zusammenhänge erläutert. Anschließend wird die These der Philosophie als Sterbenlernen näher beleuchtet. Diesem Kapitel schließen sich Diskussion und Fazit an, innerhalb dessen Argumente zusammenfassend dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffsdefinitionen und Zusammenhänge
- Anthropologischer Dualismus
- Tod und Wiedergeburt
- Die Bedeutung der Philosophie
- Die These vom Philosophieren als „Sterbenlernen“
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons philosophische Sichtweise auf den Tod im Kontext des „Sterbenlernens“, wie es von Barbara Zehnpfennig formuliert wird. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Philosophieren und Sterben und fragt, inwiefern Platons Denken als eine Philosophie des Sterbenlernens verstanden werden kann.
- Platons anthropologischer Dualismus (Körper und Seele)
- Platons Verständnis von Tod und Wiedergeburt
- Die Rolle der Philosophie im Kontext von Leben und Tod
- Die Bedeutung des „Sterbenlernens“ in Platons Philosophie
- Analyse der Argumentation im Phaidon
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit widmet sich Platons Phaidon, einem zentralen Werk der Philosophiegeschichte, und untersucht die These, dass die Philosophie als „Sterbenlernen“ aufgefasst werden kann. Sie fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Philosophieren und Sterben im Werk und fragt nach der Interpretation von Platons Sichtweise auf den Tod. Die Methode beinhaltet die Definition relevanter Begriffe, die Analyse der These des „Sterbenlernens“, eine anschließende Diskussion und ein abschließendes Fazit.
2. Begriffsdefinitionen und Zusammenhänge: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem es Platons Standpunkt zu Seele, Körper, Tod und dem Ziel der Philosophie erläutert und die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen herausarbeitet. Es werden insbesondere der anthropologische Dualismus, der die Unterscheidung von materieller (Körper) und geistiger (Seele) Natur des Menschen betont, und die platonische Vorstellung von Tod als Trennung von Körper und Seele detailliert dargestellt. Der Begriff der Seele (psychê) als „Lebensatem“ wird im Kontext des antiken griechischen Weltbildes erläutert.
Schlüsselwörter
Platon, Phaidon, Sterbenlernen, Anthropologischer Dualismus, Seele, Körper, Tod, Wiedergeburt, Philosophie, Unsterblichkeit, Dialog, Sokrates.
Häufig gestellte Fragen zu: Platon und das "Sterbenlernen"
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Platons philosophische Sichtweise auf den Tod, insbesondere im Kontext der These vom „Sterbenlernen“, wie sie von Barbara Zehnpfennig formuliert wurde. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Philosophieren und Sterben und fragt, inwiefern Platons Denken als eine Philosophie des Sterbenlernens verstanden werden kann. Der Fokus liegt dabei auf Platons Dialog „Phaidon“.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Platons anthropologischen Dualismus (Körper und Seele), sein Verständnis von Tod und Wiedergeburt, die Rolle der Philosophie im Kontext von Leben und Tod, die Bedeutung des „Sterbenlernens“ in Platons Philosophie und eine detaillierte Analyse der Argumentation im Phaidon.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: eine Einführung, ein Kapitel zu Begriffsdefinitionen und Zusammenhängen (inkl. Anthropologischer Dualismus, Tod und Wiedergeburt, Bedeutung der Philosophie), ein Kapitel zur These vom Philosophieren als „Sterbenlernen“, eine Diskussion der Thematik, und abschließend ein Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung stellt das Thema und den Fokus der Arbeit vor: die Untersuchung von Platons Phaidon und die These, dass die Philosophie als „Sterbenlernen“ interpretiert werden kann. Es wird die Methode der Arbeit erläutert, welche die Definition relevanter Begriffe, die Analyse der These des „Sterbenlernens“, eine Diskussion und ein Fazit umfasst.
Was beinhaltet das Kapitel zu den Begriffsdefinitionen und Zusammenhängen?
Dieses Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem es Platons Standpunkt zu Seele, Körper, Tod und dem Ziel der Philosophie erläutert und die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen herausarbeitet. Es werden der anthropologische Dualismus und die platonische Vorstellung von Tod als Trennung von Körper und Seele detailliert dargestellt. Der Begriff der Seele (psychê) als „Lebensatem“ wird im Kontext des antiken griechischen Weltbildes erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Platon, Phaidon, Sterbenlernen, Anthropologischer Dualismus, Seele, Körper, Tod, Wiedergeburt, Philosophie, Unsterblichkeit, Dialog, Sokrates.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Herangehensweise, die die Definition relevanter Begriffe, die Analyse der These des „Sterbenlernens“, eine anschließende Diskussion und ein abschließendes Fazit umfasst. Der Fokus liegt auf der Interpretation und Analyse von Platons Werk „Phaidon“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Philosophieren als Sterbenlernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1164145