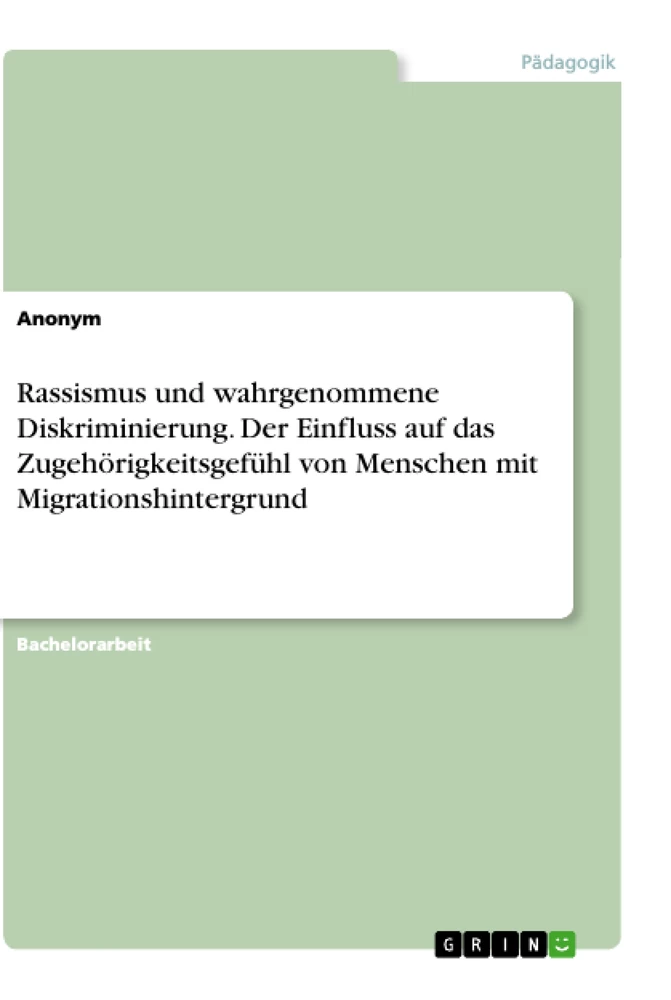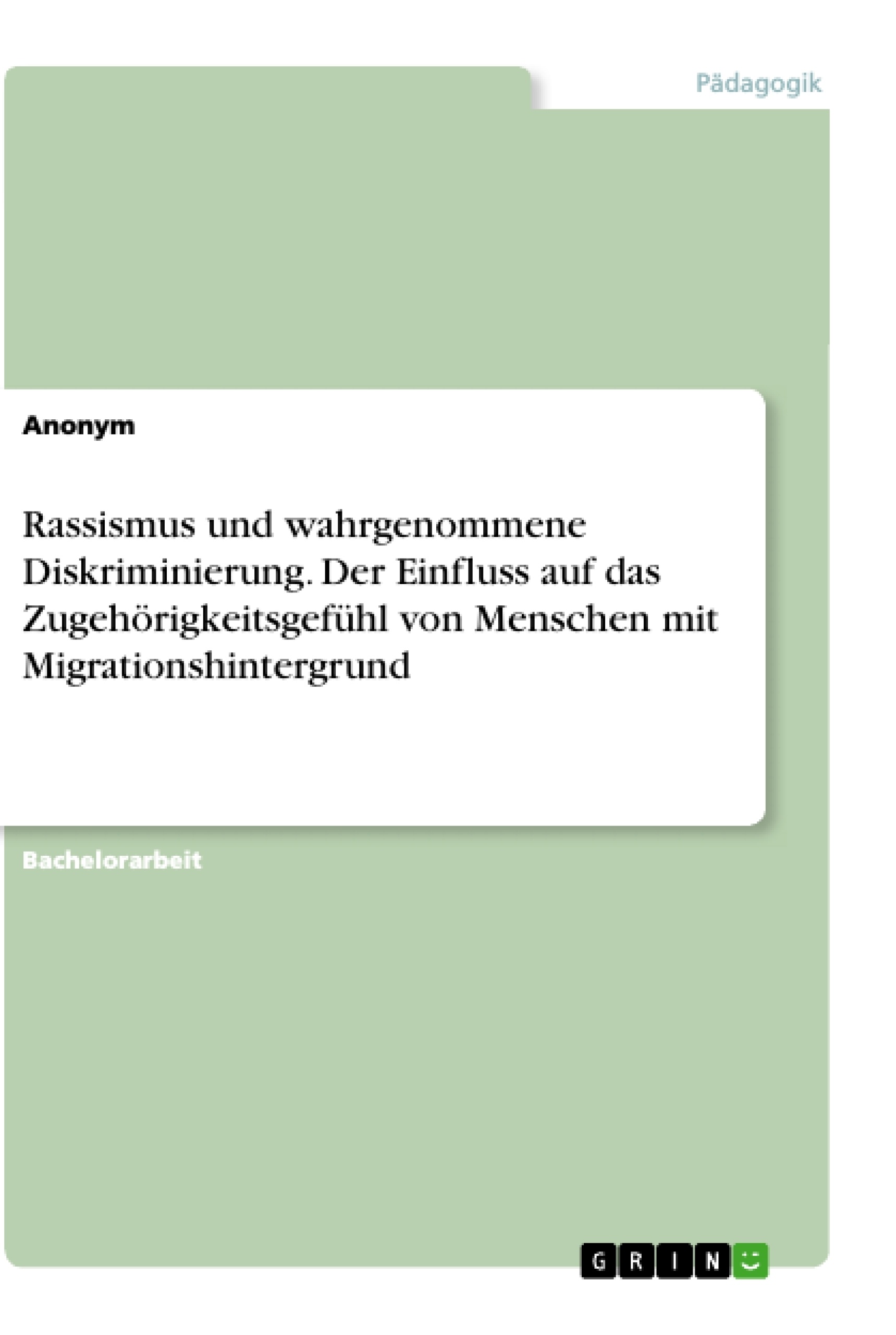Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der wahrgenommenen Diskriminierung und ihren Folgen für die Betroffenen. Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen können ein niedrigeres Zugehörigkeitsgefühl zum Aufnahmeland und negative Folgen auf die psychische Gesundheit sein. Schutzfaktoren, wie die soziale Unterstützung, können den Stress, der durch die Diskriminierungserfahrung entsteht, abpuffern.
Um diese Aussagen bestätigen zu können, wurde eine Online-Befragung durchgeführt. Dafür wurden 112 Teilnehmer mit Hilfe von standardisierten Tests befragt. Darunter wurde die wahrgenommene Diskriminierung, die subjektiv erlebte Belastung, die nationale und ethnische Identität, die subjektive Integration und die soziale Unterstützung erhoben. Für die deskriptive Statistik wurden phänotypische Differenzen ermittelt. Zur Beantwortung der Hypothesen wurde der Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Diskriminierung und der nationalen Identität sowie der subjektiven Integration erforscht. Auch der Einfluss der wahrgenommenen Diskriminierung auf die subjektiv erlebte Belastung und die soziale Unterstützung als Schutzfaktor wurden analysiert. Nebenbei wurde auch der Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Diskriminierung und der ethnischen Identität, sowie die ethnische Identität als Schutzfaktor untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theoretischer Hintergrund zum Thema
- 2.1 Rassismus und wahrgenommene Diskriminierung
- 2.2 Akkulturation, soziale und nationale/ethnische Identität.
- 2.3 Diskriminierung, Stress und Wohlbefinden.......
- 2.4 Soziale Unterstützung als Schutzfaktor.
- 2.5 Integration und Zugehörigkeit ......
- 2.6 Fragestellung
- 3. Methode...
- 3.1 Darstellung des methodischen Vorgehens
- 3.1.1 Wahrgenommene Diskriminierung.
- 3.1.2 Ethische und nationale Identität.
- 3.1.3 Psychische Gesundheit..
- 3.1.4 Soziale Unterstützung
- 3.1.5 Integration
- 3.1.6 Zusätzliche Erhebungen.
- 3.2 Darstellung der Stichprobe .......
- 3.3 Vorgehen bei der Auswertung.
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Spearman-Korrelation ......
- 4.2 Multiple Regressionsanalyse..\n
- 4.3 Korrelationen
- 5. Diskussion der Ergebnisse
- 5.1 Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds und der Fragestellungen. 36
- 5.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
- 5.3 Diskussion der eigenen methodischen Vorgehensweise
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit analysiert die Auswirkungen von wahrgenommener Diskriminierung auf das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Die Studie untersucht den Einfluss von Diskriminierung auf die nationale und ethnische Identität, die subjektive Integration sowie die psychische Gesundheit der Betroffenen.
- Wahrgenommene Diskriminierung und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.
- Der Einfluss von Diskriminierung auf die nationale und ethnische Identität.
- Die Rolle der subjektiven Integration als beeinflussender Faktor.
- Soziale Unterstützung als Schutzfaktor gegen die Auswirkungen von Diskriminierung.
- Die Bedeutung von Schutzfaktoren für die Bewältigung von Diskriminierungserfahrungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Forschungsarbeit vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Diskriminierungserfahrungen und deren Folgen für Menschen mit Migrationshintergrund. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Arbeit und untersucht verschiedene Konzepte wie Rassismus, Diskriminierung, Akkulturation, Identität, Stress, Wohlbefinden und soziale Unterstützung. Kapitel 3 beschreibt die Methode der Studie, die eine Online-Befragung von 112 Teilnehmern mit standardisierten Tests umfasst. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 4 dargestellt. Die Ergebnisse der Spearman-Korrelation, der multiplen Regressionsanalyse und weiterer Korrelationsanalysen werden detailliert beschrieben. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Studie und interpretiert die gewonnenen Erkenntnisse im Kontext des theoretischen Hintergrunds. Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden im Fazit in Kapitel 6 zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Wahrgenommene Diskriminierung, Rassismus, Zugehörigkeitsgefühl, nationale Identität, ethnische Identität, subjektive Integration, psychische Gesundheit, soziale Unterstützung, Schutzfaktoren, Online-Befragung, Korrelationsanalyse, multiple Regressionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Diskriminierung auf Menschen mit Migrationshintergrund aus?
Wahrgenommene Diskriminierung kann zu einem niedrigeren Zugehörigkeitsgefühl zum Aufnahmeland führen und negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben.
Welche Rolle spielt soziale Unterstützung bei Diskriminierungserfahrungen?
Soziale Unterstützung fungiert als wichtiger Schutzfaktor, der den durch Diskriminierung entstehenden Stress abpuffern kann.
Was wurde in der Online-Befragung der Studie untersucht?
Die Befragung von 112 Teilnehmern erhob Daten zu wahrgenommener Diskriminierung, nationaler und ethnischer Identität, subjektiver Integration und psychischer Belastung.
Besteht ein Zusammenhang zwischen Diskriminierung und nationaler Identität?
Ja, die Forschungsarbeit analysiert den negativen Einfluss von Diskriminierungserfahrungen auf die Identifikation mit dem Aufnahmeland.
Was versteht die Arbeit unter „Akkulturation“?
Akkulturation bezeichnet die Anpassungsprozesse an eine neue Kultur und deren Wechselwirkung mit der sozialen und ethnischen Identität.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Rassismus und wahrgenommene Diskriminierung. Der Einfluss auf das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1160740