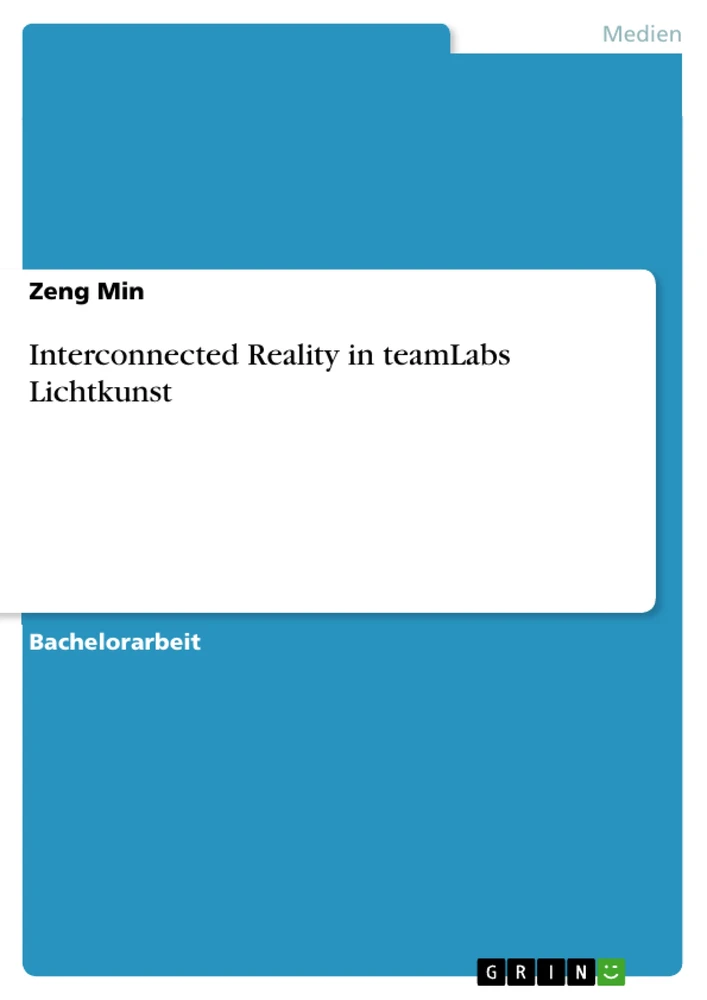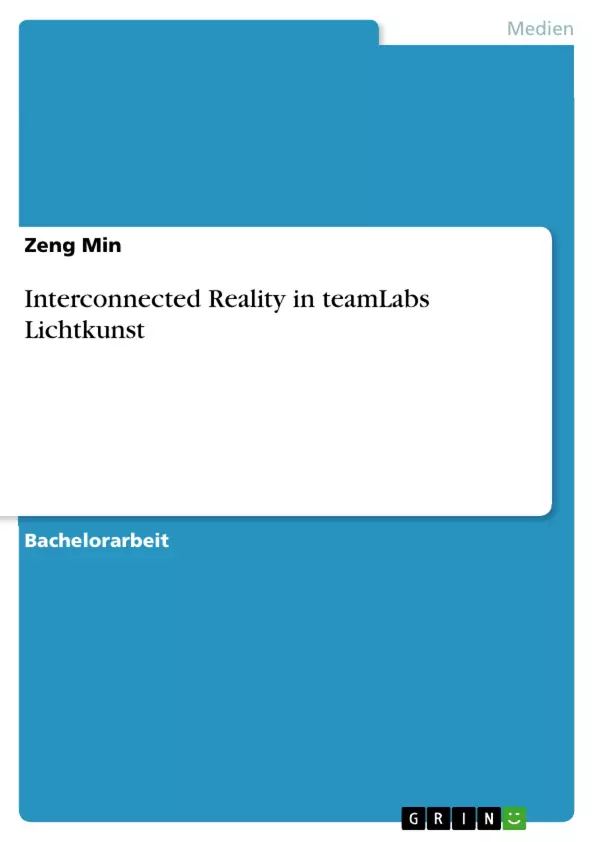Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist ein japanisches Kollektiv, dass in relativ kurzer Zeit mit seinen hochkomplexen, auf digitalen und holographischen Techniken aufbauenden Arbeiten internationale Bekanntheit erlangt hat. Gegründet 2001 von Toshiyuko Inoko hat das Kollektiv teamLab zwischenzeitlich zahlreiche Projekte realisiert und in Tokio ein eigenes Museum eröffnet. Mit teamLab verbinden sich eine Reihe von Begriffen, die zwar in der digitalen Kunst allgemein von Bedeutung sind, aber durch teamLab eine besondere Ausprägung erhalten. An erster Stelle steht hier der Begriff der Interconnected Reality, dessen deutsches Äquivalent von vernetzte Realität dem Anliegen der Künstler nur näherungsweise entspricht. Vielmehr werden mit Interconnected Reality grundsätzlich Wahrnehmungsgepflogenheiten in einer Weise zur Disposition gestellt, die die Frage nach dem Anteil des Betrachters an der Bildwirklichkeit einerseits, die nach dem Trägermedium der Bildwirklichkeit andererseits neu stellt.
Eben diesen Fragen stellt sich Min Zengs Arbeit, um im weiteren danach zu fragen, inwieweit Interconnected Reality überhaupt als eine Kunstform zu betrachten ist, die zwischen Digitalität und Interaktivität changiert. Wie häufig der Fall bei zeitgenössischen Arbeiten sieht sich Min Zeng der Schwierigkeit ausgesetzt, dass über die Arbeiten des Künstlerkollektives von deren eigener Darstellung abgesehen, wenig Material verfügbar ist. So ist sie bei ihrem Vorgehen vornehmlich auf die Webseite des Kollektivs angewiesen, die zwar Konzepte und Werksanalysen enthält, jedoch aus dem Blickwinkel der Mitglieder des Kollektivs erfolgen. Als zweite relevante Quelle dienen Min Zeng Interviews und schließlich eine chinesischsprachige Darstellung, die wiederum auf Äußerungen von Toshiyuki Inoko beruht und so die kritische Distanz zum eigenen Werkschaffen missen lässt. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, in denen Interconnected Reality im Verhältnis zu Interaktion und Bildwirklichkeit, Topographie mit dem Anliegen geografischer Verortung und schließlich Rezeptionsansätze von Interconnected Reality behandelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interconnected Reality (IR)
- Interaktion und Bildlichkeit
- Rezeptive Interaktion
- IR und partizipative Interaktion
- IR und Lichtkunst
- Licht als Künstlerisches Medium
- IR und Computertechnologie
- Topographie
- „Ultrasubjective Space“
- Einordnung in die ostasiatische Kunstgeschichte
- Einordnung in die europäische Kunstgeschichte
- IR und Rezeptionsansätze
- Rezeptionsansätze
- IR und Kunstverständnis
- IR und Erkenntnisinteresse
- IR und Weltverständnis
- IR und Metaversum
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Interconnected Reality (IR), einer von dem Kunstkollektiv teamLab entwickelten Technologie, die die Verschmelzung von digitaler und physischer Realität im Bereich der Lichtkunst untersucht. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von IR für die Gestaltung und Rezeption von Bildern, wobei der Schwerpunkt auf der partizipativen Interaktion und der visuellen Transformationsstrategie „Ultrasubjective Space“ liegt.
- Interaktion und Bildlichkeit in der IR
- Die Rolle von Licht als künstlerisches Medium in der IR
- Die ästhetische Gestaltung und Einordnung von IR in die Kunstgeschichte
- Rezeptionsansätze und das Kunstverständnis im Kontext der IR
- Der Zusammenhang zwischen IR und dem Konzept des Metaversums
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in das Kunstkollektiv teamLab und seine Arbeit mit der Interconnected Reality (IR) ein. Sie beleuchtet die vielschichtigen Aspekte von teamLabs Werken und betont die Bedeutung der IR für die Singularität des Kollektivs.
- Kapitel 2: Interconnected Reality (IR): Dieses Kapitel bietet eine phänomenologische Einführung in das Konzept der IR, mit einer Unterscheidung zwischen uneigentlicher und eigentlicher Interaktion. Es zeigt, wie IR mit Hilfe von Licht und Computertechnologie performative Bilder erschafft.
- Kapitel 3: Topographie: Dieses Kapitel befasst sich mit der räumlichen Gestaltung der IR-Installationen, insbesondere mit dem Konzept des „Ultrasubjective Space". Es ordnet diese in die ostasiatische und europäische Kunstgeschichte ein.
- Kapitel 4: IR und Rezeptionsansätze: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Rezeptionsansätze für IR-Kunst und beleuchtet die Verbindung von IR und Kunstverständnis. Es geht auch auf die Frage ein, wie IR die Beziehung zwischen Mensch und Welt erforscht und wie es zum eigenen Körperempfinden und dem Verständnis der Welt beitragen kann.
Schlüsselwörter
Interconnected Reality, teamLab, Lichtkunst, Interaktion, partizipative Interaktion, „Ultrasubjective Space", ostasiatische Kunstgeschichte, europäische Kunstgeschichte, Kunstverständnis, Rezeption, Metaversum.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht teamLab unter 'Interconnected Reality' (IR)?
IR bezeichnet eine vernetzte Realität, in der digitale Kunstwerke und physische Betrachter so interagieren, dass die Grenze zwischen Bildwirklichkeit und physischer Welt verschwimmt.
Was ist der 'Ultrasubjective Space'?
Es ist eine visuelle Transformationsstrategie, die auf ostasiatischen Raumkonzepten basiert und den Betrachter direkt in das Zentrum des Bildgeschehens einbezieht.
Wie nutzt teamLab Licht als künstlerisches Medium?
Licht wird in Kombination mit Computertechnologie und Sensoren genutzt, um performative Bilder zu schaffen, die sich durch die Anwesenheit und Bewegung der Besucher verändern.
Welche Rolle spielt die Partizipation in teamLabs Kunst?
Die Besucher sind nicht nur Betrachter, sondern Teil des Kunstwerks. Ihre Interaktion beeinflusst die digitale Umgebung und macht jedes Erlebte einzigartig.
Gibt es eine Verbindung zwischen IR und dem Metaversum?
Die Arbeit untersucht Rezeptionsansätze, die IR als eine physisch erlebbare Vorstufe oder Erweiterung digitaler Welten wie des Metaversums betrachten.
- Citar trabajo
- Zeng Min (Autor), 2021, Interconnected Reality in teamLabs Lichtkunst, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1158249