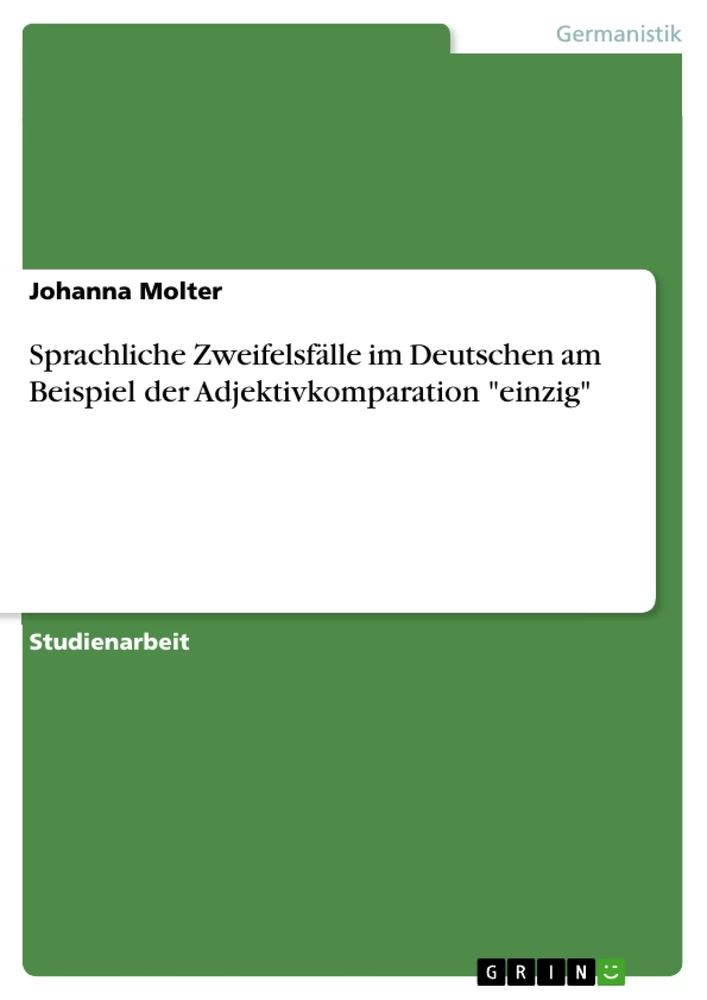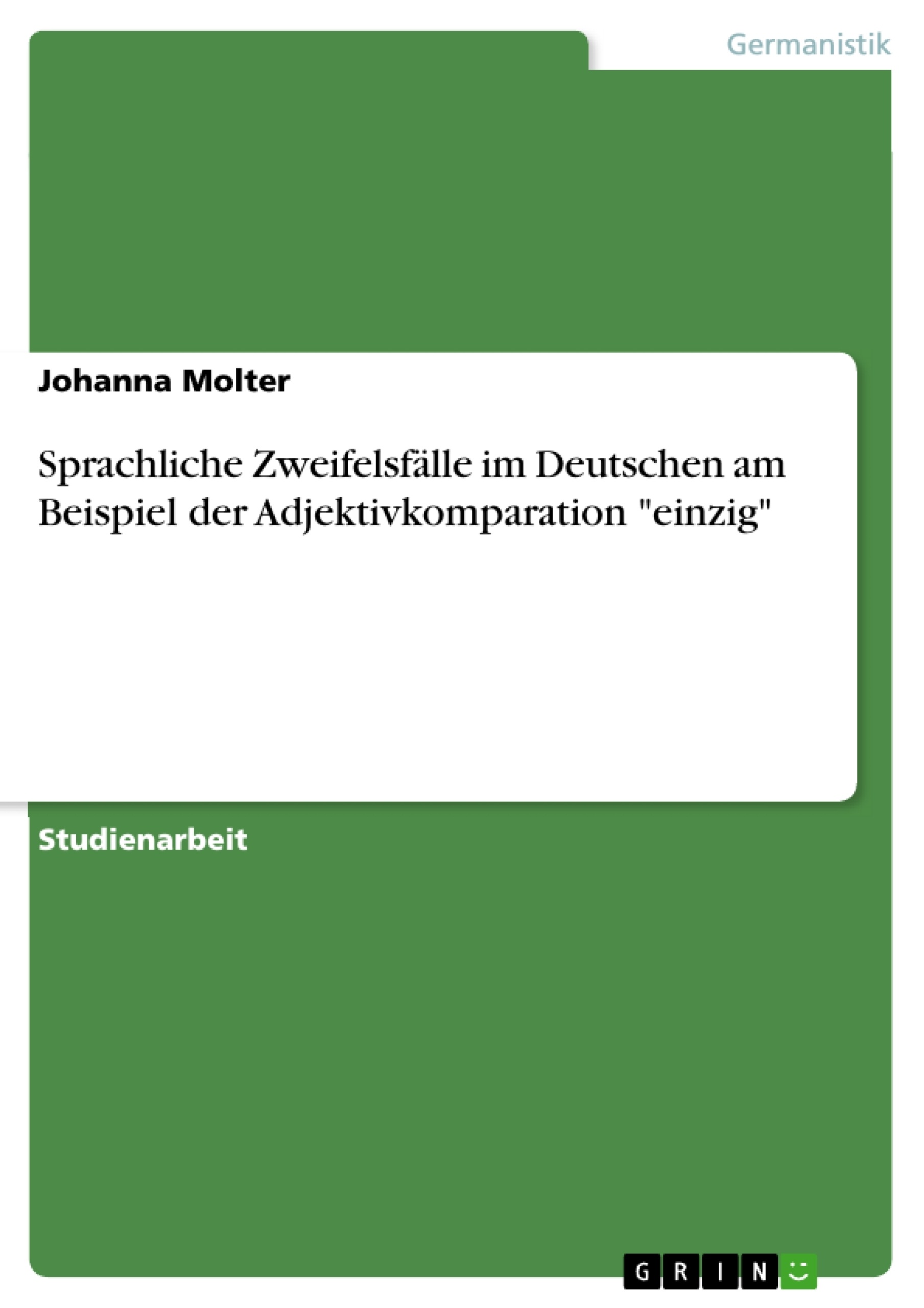Ein Teil der deutschen Sprache ist die Grammatik, die in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle spielt. Ist ein Mensch in der Lage, sich grammatikalisch korrekt auszudrücken, wird dieses Können oftmals als Indikator des Beherrschens einer Sprache verstanden. Ein Ausbleiben normativer Grammatik führt dabei oft zu einer gegenteiligen Annahme sowie zu Missverständnissen und Sanktionen. Aber was passiert mit Fällen, in denen sich kompetente Sprecher uneinig sind? Wie kann ein Sprachwandel vollzogen werden, wenn sich die Gesellschaft ausschließlich an Normen orientiert und Abweichungen der Normen kaum zulässt? Diese Fragen sind ein zentrales Moment von sprachlichen Zweifelsfällen – einer anderen Sichtweise auf Sprache.
Um zu prüfen, ob es sich bei dem Superlativ des Adjektivs "einzig" um einen Zweifelsfall handelt, werden verschiedene Indikatoren untersucht. Begonnen wird mit der Darstellung der Ausgangslage. Dafür werden die Wortgruppe der Adjektive und deren Unterkategorie "absolute Adjektive" beschrieben. Anhand dessen soll geprüft werden, ob eine Steigerung grammatikalisch zulässig ist. Dafür wird das Wort "einzigst" auf syntaktischer, morphologischer, semantischer sowie phonetischer Ebene geprüft.
Im Anschluss wird der explizite Gebrauch des Wortes untersucht und in Kontrast zur Ausgangsform gesetzt. Die
Analyse des Gebrauchs unterteilt sich in zwei verschiedene Dimensionen. Zuerst wird das Vorkommen des Phänomens in der Schriftsprache mithilfe der online abrufbaren Textkorpora des IDS.11 über COSMAS II untersucht. Im zweiten Schritt liegt der Fokus auf der Mündlichkeit. Dafür wird das Online-Portal DGD (Datenbank für gesprochenes Deutsch)
verwendet und es werden diverse Dialoge einbezogen.
Im letzten Schritt der Analyse werden die von Klein herausgestellten Faktoren für einen Zweifelsfall mit dem hier vorgestellten Beispiel verknüpft. Durch ein Abwägen der verschiedenen Indikatoren soll im abschließenden Teil festgestellt werden, ob es sich beim Gebrauch "einzigst" um einen Zweifelsfall oder eine inkorrekte Steigerung des Adjektivs "einzig" handelt. Sollte es sich um einen Zweifelsfall handeln, werden seine Entstehungsursachen herausgearbeitet. Der Schlussteil impliziert einen kurzen Ausblick in weiterführende Forschungen im Bereich
der Zweifelsfälle sowie ein abschließendes Fazit zur gesamten Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachliche Zweifelsfälle
- Untersuchungsgegenstand
- Methodik und Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Rahmen
- Adjektive
- Zweifelsfälle der Wortgruppe Adjektive
- Absolute Adjektive
- Analyse der Nutzung von „Einzigst“
- Cosmas
- Nutzung im Sprachgebrauch
- Temporale Präsenz
- Lokale Präsenz
- DGD
- Faktorenüberprüfung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwendung des Wortes „einzigst“ im Deutschen und analysiert, ob es sich dabei um einen sprachlichen Zweifelsfall oder einen grammatikalischen Fehler handelt. Die Studie prüft die grammatikalische Zulässigkeit der Steigerung des Adjektivs „einzig“ und vergleicht den Gebrauch von „einzigst“ mit der normativen Form „einzig“. Die Methodik beinhaltet die Analyse von Textkorpora (COSMAS II) und der Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD).
- Analyse sprachlicher Zweifelsfälle und deren Definition
- Grammatikalische Untersuchung der Adjektivsteigerung „einzigst“
- Untersuchung des Gebrauchs von „einzigst“ in schriftlichen und gesprochenen Korpora
- Bewertung der Faktoren für einen sprachlichen Zweifelsfall nach Klein
- Abschließende Beurteilung, ob „einzigst“ ein Zweifelsfall oder ein Fehler darstellt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Zweifelsfälle ein und definiert diese anhand der Arbeiten von Peter Klein und dem Duden. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Status von „einzigst“ – Zweifelsfall oder Fehler – und skizziert die Methodik der Arbeit, die die Untersuchung des Wortes „einzigst“ auf verschiedenen Ebenen (syntaktisch, morphologisch, semantisch, phonetisch) sowie die Analyse seines Gebrauchs in schriftlichen und gesprochenen Korpora umfasst. Die Einleitung betont die Bedeutung von Sprachwandel und die Herausforderungen, die sich aus der Auseinandersetzung mit normativen und deskriptiven Ansätzen ergeben.
Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel beschreibt die Wortart der Adjektive und deren Komparation. Es liefert den theoretischen Hintergrund für die Analyse von „einzigst“, indem es die grammatikalischen Regeln der Adjektivsteigerung erläutert und den Begriff der „absoluten Adjektive“ einführt, um den möglichen Status von „einzig“ als solches zu diskutieren. Der theoretische Rahmen dient als Grundlage für die anschließende empirische Untersuchung.
Analyse der Nutzung von „Einzigst“: Dieser Abschnitt analysiert die Verwendung von „einzigst“ in schriftlichen und gesprochenen Korpora (COSMAS II und DGD). Die Analyse untersucht die Häufigkeit des Vorkommens, die kontextuelle Einbettung und die zeitliche sowie räumliche Verteilung des Wortes. Der Vergleich der Ergebnisse aus beiden Korpora ermöglicht Rückschlüsse auf die Verbreitung und Akzeptanz von „einzigst“ in verschiedenen Sprachregistern und Kontexten. Dieser Teil liefert die empirischen Daten für die abschließende Bewertung.
Schlüsselwörter
Sprachliche Zweifelsfälle, Adjektivkomparation, „einzigst“, Grammatik, Norm, Sprachwandel, COSMAS II, DGD, Korpuslinguistik, Deskriptive Linguistik, Normative Grammatik, Absolute Adjektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sprachwissenschaftlichen Arbeit: Analyse der Verwendung von „Einzigst“
Was ist der Gegenstand dieser sprachwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung des Wortes „einzigst“ im Deutschen. Sie analysiert, ob es sich dabei um einen sprachlichen Zweifelsfall oder einen grammatikalischen Fehler handelt. Im Mittelpunkt steht die grammatikalische Zulässigkeit der Steigerung des Adjektivs „einzig“ und ein Vergleich des Gebrauchs von „einzigst“ mit der normativen Form „einzig“.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine korpuslinguistische Methode. Es werden die Textkorpora COSMAS II und die Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD) analysiert. Die Analyse umfasst die Häufigkeit des Vorkommens von "einzigst", die kontextuelle Einbettung und die zeitliche sowie räumliche Verteilung des Wortes. Die Ergebnisse werden verglichen, um Rückschlüsse auf die Verbreitung und Akzeptanz von „einzigst“ in verschiedenen Sprachregistern und Kontexten zu ziehen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Definition sprachlicher Zweifelsfälle nach Peter Klein und dem Duden. Der theoretische Rahmen umfasst die Wortart Adjektive, deren Komparation und den Begriff der „absoluten Adjektive“. Dieser theoretische Hintergrund dient der Analyse der grammatikalischen Regeln der Adjektivsteigerung und der Diskussion des möglichen Status von „einzig“ als absolutes Adjektiv.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, die Analyse der Nutzung von „einzigst“, eine Faktorenüberprüfung und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein, definiert sprachliche Zweifelsfälle und stellt die Forschungsfrage. Der theoretische Rahmen liefert die grammatikalischen Grundlagen. Die Analyse untersucht die Verwendung von „einzigst“ in den Korpora COSMAS II und DGD. Die Faktorenüberprüfung bewertet die Ergebnisse im Hinblick auf die Kriterien eines sprachlichen Zweifelsfalls. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Welche konkreten Fragen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht folgende Fragen: Ist „einzigst“ ein grammatikalisch zulässiger Ausdruck? Wie häufig wird „einzigst“ in schriftlicher und gesprochener Sprache verwendet? Welche Faktoren beeinflussen die Verwendung von „einzigst“? Ist „einzigst“ ein sprachlicher Zweifelsfall oder ein Fehler? Wie lässt sich der Gebrauch von „einzigst“ im Kontext des Sprachwandels bewerten?
Welche Datenquellen werden verwendet?
Die Hauptdatenquellen sind die Textkorpora COSMAS II und die Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD). Diese Korpora liefern empirische Daten zur Häufigkeit und zum Kontext des Gebrauchs von „einzigst“ in schriftlichen und gesprochenen Texten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachliche Zweifelsfälle, Adjektivkomparation, „einzigst“, Grammatik, Norm, Sprachwandel, COSMAS II, DGD, Korpuslinguistik, Deskriptive Linguistik, Normative Grammatik, Absolute Adjektive.
Was ist das Fazit der Arbeit (ohne detaillierte Ergebnisse)?
Das Fazit der Arbeit bewertet den Status von "einzigst" als sprachlicher Ausdruck. Es wird beurteilt, ob es sich um einen akzeptierten Ausdruck, einen Zweifelsfall oder einen Fehler handelt, basierend auf den Ergebnissen der Korpusanalyse und der theoretischen Grundlagen. Die Schlussfolgerung berücksichtigt die Aspekte von Sprachwandel und den Unterschied zwischen deskriptiven und normativen Ansätzen.
- Quote paper
- Johanna Molter (Author), 2021, Sprachliche Zweifelsfälle im Deutschen am Beispiel der Adjektivkomparation "einzig", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156468