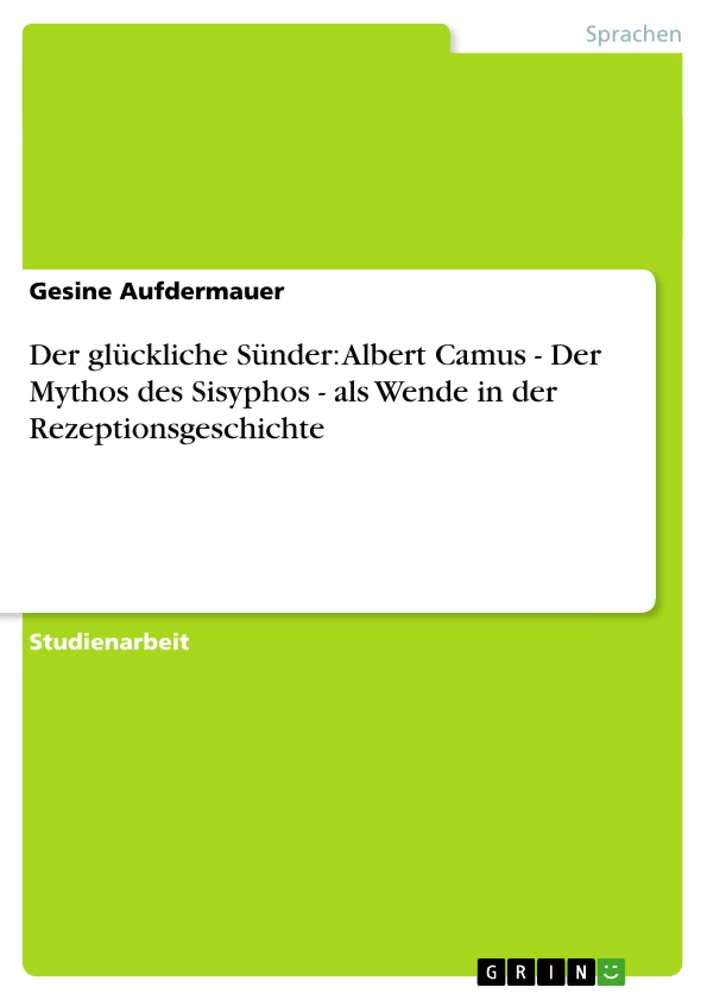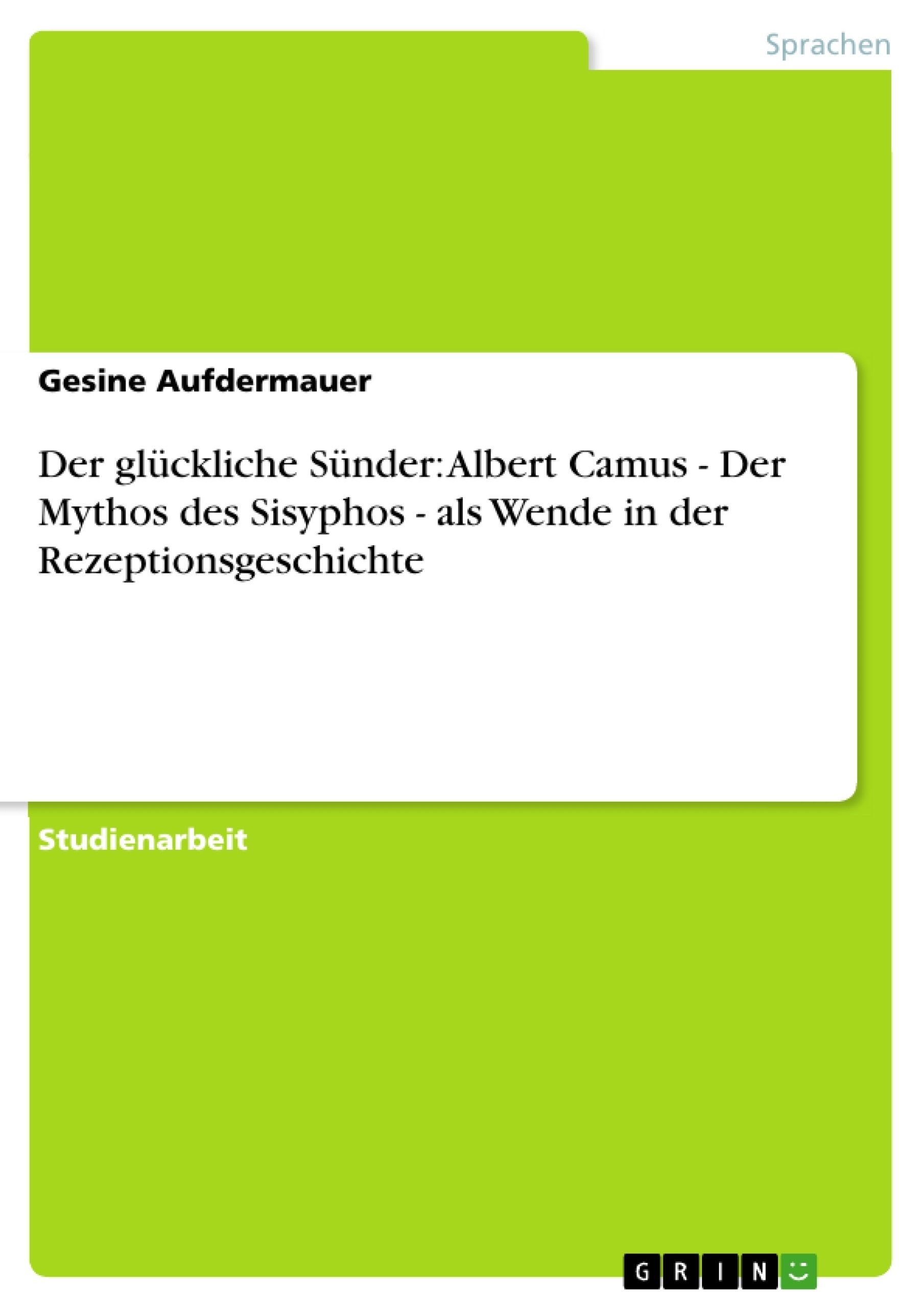„Auch den Sisyphos sah ich, von schrecklicher Müh gefoltert,
Einen schweren Marmor mit großer Gewalt fortheben.
Angestemmt, arbeitet er stark mit Händen und Füßen,
Ihn von der Au aufwälzend zum Berge. Doch glaubt er ihn jetzo
Auf den Gipfel zu drehn, da mit einmal stürzte die Last um;
Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.
Und von vorn arbeitet er, angestemmt, dass der Angstschweiß
Seinen Gliedern entfloss und Staub sein Antlitz umwölkte.“
Sisyphos, der Büßer, der in der Unterwelt seinen Kampf gegen den Stein führt, das ist das Bild, das uns vor Augen steht, wenn sein Name fällt. Wie fast alle mythischen Gestalten erfuhr auch Sisyphos über die Jahrhunderte eine Wandlung in der europäischen Rezeption. Sind auch die Autoren und Philosophen, die sich mit der Geschichte des Königs von Korinth auseinander setzten nicht so zahlreich, wie etwa die Odysseus-Rezeptionen, so finden sich doch in allen Jahrhunderten Beispiele für eine Beschäftigung mit Sisyphos. Sah man im Sisyphos in der Antike überwiegend ein Beispiel für die harten Strafen der Götter, so wandelte sich sein Dasein im Hades später zu einem Sinnbild für das Leben an sich. Doch schließlich behauptet Camus, dass wir uns diesen Menschen glücklich vorzustellen haben.
Ziel soll es sein, ausgehend vom Originalmythos der Antike, den Weg zu Camus zu zeichnen. Anhand einiger Beispiele aus dem Mittelalter und der Neuzeit soll gezeigt werden, wie Sisyphos immer wieder umgewertet wurde, seine Geschichte stets neuen Deutungen unterlag, bis Camus eine völlige Neubewertung des Sisyphos-Mythos vornahm. Seiner Auseinandersetzung mit Sisyphos, eingebettet in die Philosophie des Absurden, gilt hier das Hauptinteresse. Ein kurzer Ausblick in die Sisyphos-Rezeption nach Camus dient noch einmal der Hervorhebung seiner Bedeutung, denn gerade nach Camus machten sich Autoren zunehmend daran, sich mit diesem Mythos auseinandersetzen, die Rezeptionen wurden zahlreicher und vielfältiger. Camus öffnete den Weg für einen freieren, fast spielerischen Umgang mit dem Mythos. Erst nach Camus kam die Frage auf, was geschähe, wenn Sisyphos` Stein eines Tages liegenbliebe...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sisyphos, „der schlaueste unter den Männern“
- Bestrafung der Sünder oder Sinnbild des Lebens? Aspekte des Sisyphos in der Antike
- „Das Leid bin ich, und ich bin Leid,“ Sisyphos im Mittelalter
- Sisyphos vor Camus (18. bis 20. Jhd.)
- Camus - Einordnung des Sisyphos in sein Werk
- Das Absurde - Bindeglied zwischen Mensch und Welt
- Der absurde Mensch
- Sisyphos - der Held des Absurden
- Abschließende Betrachtungen
- Wenn der Stein einmal liegen bleibt...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Rezeptionsgeschichte des Sisyphos-Mythos von der Antike bis zu Albert Camus nachzuzeichnen und die bedeutsame Neubewertung des Mythos durch Camus herauszustellen. Es wird untersucht, wie sich die Interpretation des Sisyphos im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und wie Camus’ Philosophie des Absurden die Figur neu definiert.
- Die verschiedenen Interpretationen des Sisyphos-Mythos in der Antike.
- Die Entwicklung der Sisyphos-Rezeption im Mittelalter und der Neuzeit.
- Camus’ Einordnung des Sisyphos in seine Philosophie des Absurden.
- Die Bedeutung von Camus’ Interpretation für die spätere Rezeption des Mythos.
- Die Frage nach der möglichen Beendigung des ewigen Kampfes des Sisyphos.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Sisyphos-Mythos als Ausgangspunkt der Arbeit. Sie erläutert die Zielsetzung, die auf der Nachzeichnung des Weges vom antiken Mythos bis zu Camus’ Interpretation basiert, und kündigt die Methodologie an, die auf der Analyse verschiedener Rezeptionen beruht. Die Bedeutung von Camus’ werk für die folgende Rezeption des Mythos wird als zentraler Aspekt hervorgehoben.
Sisyphos, „der schlaueste unter den Männern“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Figur des Sisyphos in der Antike. Es präsentiert verschiedene antike Quellen, die Sisyphos’ Lebensgeschichte und seine Bestrafung beschreiben, und analysiert die Motivationsgründe für seine Bestrafung durch die Götter. Die Schlauheit und Lebenslust des Königs von Korinth werden hervorgehoben, ebenso wie die Verbindung zwischen seiner Tat und seiner Strafe. Der Text zeigt auf, wie sich die Bedeutung des Mythos bereits in der Antike zu entwickeln begann, obwohl das Element der Bestrafung im Vordergrund stand.
„Das Leid bin ich, und ich bin Leid,“ Sisyphos im Mittelalter: (Der Text liefert keine Informationen zum Mittelalter. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Sisyphos vor Camus (18. bis 20. Jhd.): (Der Text liefert keine konkreten Informationen zu diesem Zeitraum. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Camus - Einordnung des Sisyphos in sein Werk: Dieses Kapitel analysiert Camus' Interpretation des Sisyphos-Mythos im Kontext seiner Philosophie des Absurden. Es wird erläutert, wie Camus den Mythos neu deutet und Sisyphos als Symbol für den absurden Menschen darstellt, der trotz der sinnlosen Wiederholung seiner Handlung eine gewisse Form von Freiheit und Selbstbestimmung findet. Die Kapitel unterteilen sich in drei Bereiche: Das Absurde als Bindeglied zwischen Mensch und Welt, der absurde Mensch und Sisyphos als Held des Absurden.
Abschließende Betrachtungen: (Der Text enthält keine konkreten Informationen über Abschließende Betrachtungen. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Wenn der Stein einmal liegen bleibt...: (Der Text enthält keine konkreten Informationen zu diesem Kapitel. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann daher nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Sisyphos-Mythos, Rezeptionsgeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit, Albert Camus, Philosophie des Absurden, Absurdität, Sinnlosigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung, Bestrafung, Symbol, Metapher, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Sisyphos: Rezeptionsgeschichte eines Mythos"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte des Sisyphos-Mythos von der Antike bis zu Albert Camus. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Interpretation des Mythos im Laufe der Jahrhunderte und der bedeutenden Neuinterpretation durch Camus im Kontext seiner Philosophie des Absurden.
Welche Aspekte des Sisyphos-Mythos werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Interpretationen des Sisyphos-Mythos in der Antike, die Entwicklung seiner Rezeption im Mittelalter und der Neuzeit, Camus' Einordnung des Mythos in seine Philosophie des Absurden und die Bedeutung von Camus' Interpretation für die spätere Rezeption. Zusätzlich wird die Frage nach der möglichen Beendigung des ewigen Kampfes des Sisyphos thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einem Überblick über die Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitel zur Interpretation des Sisyphos in der Antike, im Mittelalter, in der Neuzeit bis zu Camus, sowie eine Analyse von Camus' Interpretation innerhalb seiner Philosophie des Absurden. Abschließende Betrachtungen und ein Ausblick ("Wenn der Stein einmal liegen bleibt...") bilden den Schluss.
Welche Informationen liefert die Arbeit über den Sisyphos in der Antike?
Das Kapitel zur Antike präsentiert verschiedene antike Quellen, die Sisyphos' Lebensgeschichte und seine Bestrafung beschreiben. Es analysiert die Motivationsgründe für seine Bestrafung und hebt seine Schlauheit und Lebenslust hervor. Die Entwicklung der Bedeutung des Mythos bereits in der Antike, mit dem Fokus auf dem Element der Bestrafung, wird gezeigt.
Welche Informationen werden zum Sisyphos im Mittelalter und der Neuzeit (vor Camus) gegeben?
Der Text bietet leider keine konkreten Informationen zur Rezeption des Sisyphos-Mythos im Mittelalter und in der Zeit vor Camus (18. bis 20. Jahrhundert). Die entsprechenden Kapitel enthalten keine zusammenfassenden Informationen.
Wie wird Camus' Interpretation des Sisyphos-Mythos dargestellt?
Dieses Kapitel analysiert Camus' Interpretation im Kontext seiner Philosophie des Absurden. Es erläutert, wie Camus den Mythos neu deutet und Sisyphos als Symbol für den absurden Menschen darstellt, der trotz sinnloser Wiederholung seiner Handlung eine Form von Freiheit und Selbstbestimmung findet. Das Kapitel unterteilt sich in die Bereiche: Das Absurde als Bindeglied zwischen Mensch und Welt, der absurde Mensch und Sisyphos als Held des Absurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sisyphos-Mythos, Rezeptionsgeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit, Albert Camus, Philosophie des Absurden, Absurdität, Sinnlosigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung, Bestrafung, Symbol, Metapher, Interpretation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Rezeptionsgeschichte des Sisyphos-Mythos von der Antike bis zu Albert Camus nachzuzeichnen und die bedeutende Neubewertung des Mythos durch Camus hervorzuheben. Es wird untersucht, wie sich die Interpretation des Sisyphos im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und wie Camus’ Philosophie des Absurden die Figur neu definiert.
- Citation du texte
- Gesine Aufdermauer (Auteur), 2002, Der glückliche Sünder: Albert Camus - Der Mythos des Sisyphos - als Wende in der Rezeptionsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11549