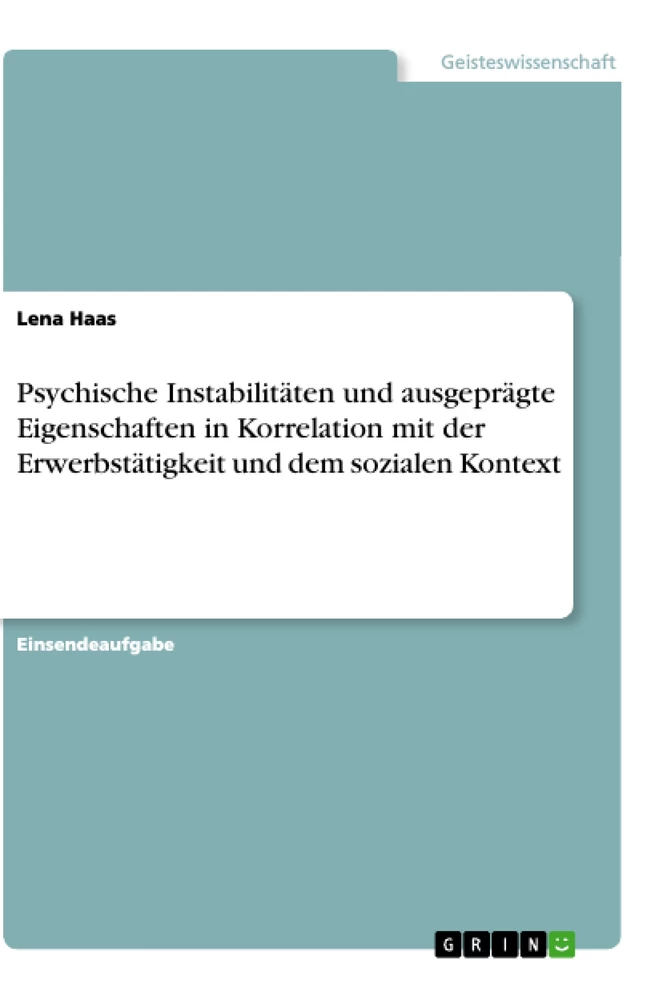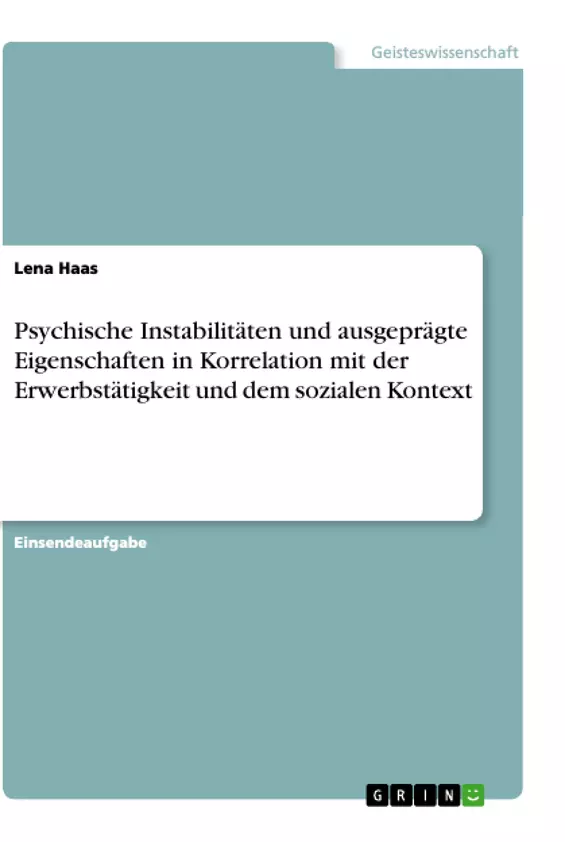Schizophrenie hat eine Lebenszeitprävalenz von 1%, hält sich über die Kulturen hinweg stabil und betrifft Männer wie Frauen in etwa gleich häufig. Männer erkranken laut empirischer Studien in einer früheren Lebensphase (20-25 Jahre) als Frauen (25-30 Jahre). Die Ursachen für eine Schizophrenie werden als ein Zusammenspiel bio-psycho-sozialer Faktoren angesehen. Zu den bekanntesten Symptomen zählen Halluzinationen und Paranoia. Patient(innen) vernehmen hierbei akustische Reize wie das Stimmenhören von unsichtbaren Personen/Wesen, welche u.a. Befehle erteilen und sich über ihren „Wirt“ belustigen. Etwa 20% der Menschen mit einer psychischen Störung werden in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) untergebracht.
Emotionen sind die Symbiose aus einem körperlichen Empfinden (Erregung) und Kognitionen (Emotionsrelevanz und das Erkennen der Körperempfindung als Ursache) welche miteinander attribuiert werden. Die Grundlage stellen hierbei die eigenen (zum Teil biologisch veranlagten) Bedürfnisse, Ziele und Bewältigungsmöglichkeiten dar. Es wurde bewiesen, dass ein physiologischer Erregungszustand in unterschiedlich interpretierten Situationen verschiedene Emotionen auslösen kann.
Stressreaktionen führen zumeist zu einer Anwendung von sogenannten „Copingstrategien“ (Bewältigungsverhalten durch Gefühlsänderung); kurz Copings, welche auf Dauer zu einer Bildung der Stresstoleranz führt. Ausgelöst werden diese Copings durch eine subjektive Bewertung der Situation und korrelieren dabei nicht mit der Häufigkeit oder Intensität der objektiven Belastung.
Inhaltsverzeichnis
- Schizophrenie
- Allgemeine Beschreibung
- Symptomatik und Diagnostik
- Epidemiologie und Ätiologie
- Schizotype und wahnhafte Störung
- Erwerbstätigkeit bei Schizophrenie
- Schizophrene Patienten in Behindertenwerkstätten
- Theoretische Modelle zur Bewertung
- Kognitive Emotionstheorie nach Schachter und Singer
- Transaktionelles Stressmodell nach Richard Lazarus
- Copingstrategien
- Emotionale Intelligenz
- Allgemeine Beschreibung
- Bedeutung von Emotionaler Intelligenz im Teambildungsprozess
- Wirkungsbereiche der Emotionalen Intelligenz
- Kritik am Konzept der Emotionalen Intelligenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Einsendeaufgabe befasst sich mit der Korrelation zwischen psychischen Instabilitäten, insbesondere Schizophrenie, und ausgeprägten Eigenschaften im Kontext von Erwerbstätigkeit und sozialer Einbindung. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die sich für Betroffene im Berufsleben ergeben, und beleuchtet verschiedene theoretische Modelle zur Bewertung von emotionalen Reaktionen auf Stress. Darüber hinaus wird die Bedeutung von emotionaler Intelligenz im Teambildungsprozess analysiert.
- Symptome und Diagnostik von Schizophrenie
- Einfluss von Schizophrenie auf Erwerbstätigkeit
- Theoretische Modelle zur Bewertung emotionaler Reaktionen
- Bedeutung der emotionalen Intelligenz im Arbeitsleben
- Herausforderungen und Chancen für Schizophrene im sozialen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die Symptome und die Diagnostik von Schizophrenie erläutert. Es werden die verschiedenen Erscheinungsformen und die dazugehörigen Merkmale beschrieben, wie zum Beispiel Realitäts- und Kontaktverlust, Gedächtnis- und Wahrnehmungsstörungen sowie Sprachstörungen. Der zweite Abschnitt behandelt verschiedene theoretische Modelle zur Bewertung emotionaler Reaktionen auf Stress, wie die Kognitive Emotionstheorie nach Schachter und Singer und das Transaktionelle Stressmodell nach Richard Lazarus. Das dritte Kapitel widmet sich der emotionalen Intelligenz und ihrer Bedeutung im Teambildungsprozess. Es werden die Wirkungsbereiche und die Kritik am Konzept der emotionalen Intelligenz erläutert.
Schlüsselwörter
Schizophrenie, psychische Instabilitäten, Erwerbstätigkeit, sozialer Kontext, theoretische Modelle, Emotionstheorie, Transaktionales Stressmodell, Copingstrategien, Emotionale Intelligenz, Teambildungsprozess.
- Citar trabajo
- Lena Haas (Autor), 2020, Psychische Instabilitäten und ausgeprägte Eigenschaften in Korrelation mit der Erwerbstätigkeit und dem sozialen Kontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154721