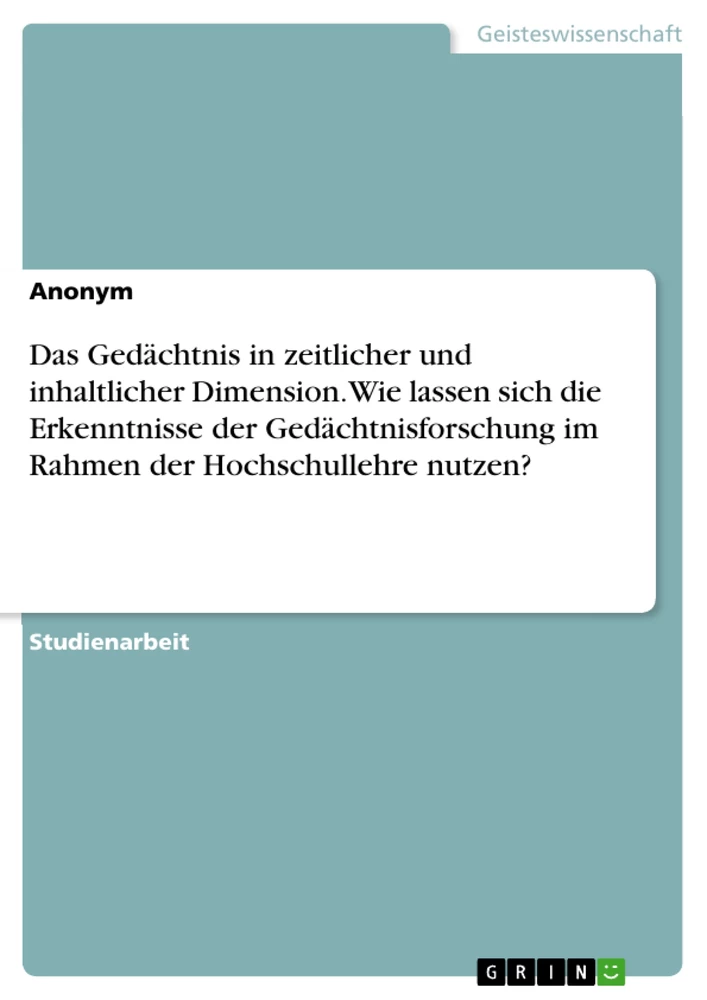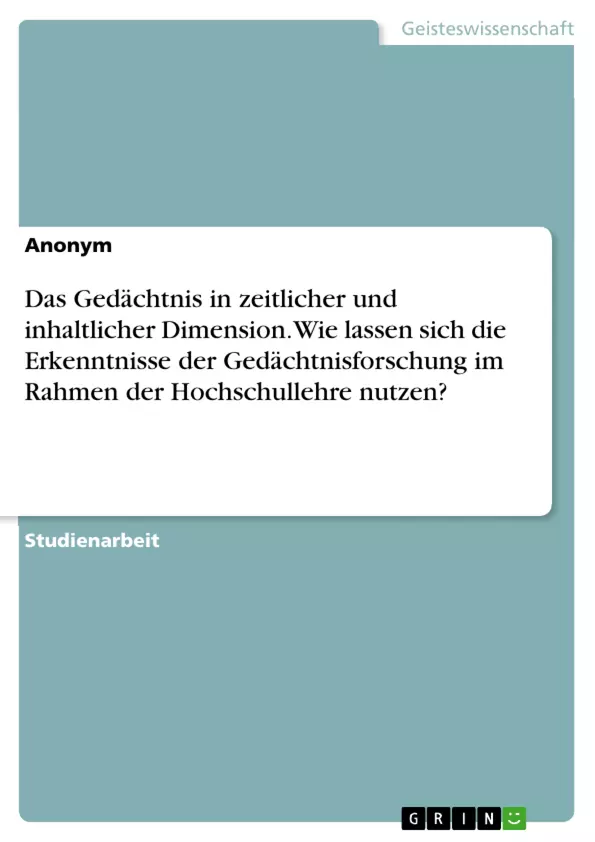Die Arbeit gibt einen Überblick über das Gedächtnis in seiner zeitlichen und seiner inhaltlichen Dimension. Wie werden Informationen aus dem Gedächtnis abgerufen, und wie funktioniert das Phänomen des Vergessens? Zudem werden Möglichkeiten und Beispiele aufgezeigt, wie sich die Erkenntnisse der Gedächtnisforschung im Rahmen der Hochschullehre nutzen lassen, und wie nachhaltiges Lernen in diesem Zusammenhang gefördert werden kann.
Neben einer oftmals verlängerten Schulzeit, hat in den letzten Jahren auch die Zahl der Studierenden enorm zugenommen. So hat sich diese in Deutschland in den letzten 17 Jahren um etwa ein Drittel erhöht. Darüber hinaus werden von Arbeitnehmern zu-nehmend mehr Qualifikationen gefordert, so dass viele Beschäftigte sich durch Fort- und Weiterbildungen an veränderte Arbeitsplatzanforderungen anpassen müssen. Dies verlangt für immer komplexer werdende gesellschaftliche und technologische Prozesse ein zum Verständnis weiterführendes Wissen, welches dafür erlernt werden muss. Lernen spielt in diesem Kontext somit eine außerordentlich wichtige Rolle. Vor allem ist es essenziell, zu wissen, wie neue Inhalte erlernt werden können. Das veranschaulicht auch folgendes Zitat des renommierten Gedächtnisforschers Robert A. Bjork: „In a rapidly changing and ever more complex world, the ultimate survival tool for individuals and organizations is knowing how to learn“. Das Gedächtnis bildet die Voraussetzung für Lernprozesse, indem es Erfahrungen und Wissen speichert. Lernen und Gedächtnis gehören somit zusammen. Heutzutage gibt es so viele Gedächtnisstützen, dass eine Gedächtnisspeicherung nur manchmal nötig ist. Und trotzdem finden sich immer noch ausreichend Lernereignisse, welche eine Informationsspeicherung im Gedächtnis erforderlich machen, wie eben beispielsweise Prüfungen im Kontext der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Das Gedächtnis in seiner zeitlichen Dimension
- 2.1 Sensorisches Gedächtnis
- 2.2 Kurzzeitgedächtnis (KZG) und Arbeitsgedächtnis (AG)
- 2.3 Langzeitgedächtnis
- 3 Das Gedächtnis in seiner inhaltlichen Dimension
- 3.1 Deklaratives Gedächtnis
- 3.2 Non-deklaratives Gedächtnis
- 3.3 Abruf von Inhalten aus dem Gedächtnis
- 3.4 Vergessen
- 4 Möglichkeiten zur Förderung nachhaltigen Lernens am Beispiel neuer Konzepte der Hochschullehre
- 4.1 Inverted Classroom
- 4.2 Hohenheimer Lernorte
- 4.3 Lernen mit Dr. House
- 5 Kritische Diskussion
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zeitliche und inhaltliche Dimension des Gedächtnisses und erörtert, wie Erkenntnisse der Gedächtnisforschung in der Hochschullehre nutzbar gemacht werden können. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Gedächtnisses für Lernprozesse zu verdeutlichen und praktische Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Die verschiedenen Gedächtnissysteme (sensorisches, Kurzzeit-, Langzeitgedächtnis).
- Die Unterscheidung zwischen deklarativem und non-deklarativem Gedächtnis.
- Prozesse des Abrufs und Vergessens von Informationen.
- Methoden zur Förderung nachhaltigen Lernens.
- Anwendung neuer Lehrkonzepte in der Hochschullehre.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, dass angesichts steigender Studierendenzahlen und erhöhter Anforderungen an Arbeitnehmern effektive Lernmethoden essentiell sind. Sie betont die Bedeutung des Gedächtnisses für Lernprozesse und zitiert Robert A. Bjork, der die Fähigkeit zu lernen als überlebenswichtig in einer sich schnell verändernden Welt bezeichnet. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit, die Erkenntnisse der Gedächtnisforschung für die Gestaltung geeigneter Lernszenarien zu nutzen, um nachhaltiges Lernen zu fördern.
2 Das Gedächtnis in seiner zeitlichen Dimension: Dieses Kapitel beschreibt die zeitliche Dimension des Gedächtnisses, beginnend mit dem sensorischen Gedächtnis, welches flüchtige sensorische Informationen kurzzeitig speichert. Es geht dann weiter zum Kurzzeitgedächtnis (KZG) und Arbeitsgedächtnis (AG), die Informationen für eine begrenzte Zeit aktiv verarbeiten. Schließlich wird das Langzeitgedächtnis behandelt, das langfristige Speicherung von Informationen ermöglicht. Das Kapitel verdeutlicht die unterschiedlichen Speicherkapazitäten und -dauern der einzelnen Gedächtnissysteme und deren Interaktion bei Lernprozessen.
3 Das Gedächtnis in seiner inhaltlichen Dimension: Dieses Kapitel analysiert die inhaltliche Struktur des Gedächtnisses, indem es zwischen deklarativem (explizitem) und non-deklarativem (implizitem) Gedächtnis unterscheidet. Deklaratives Gedächtnis umfasst Faktenwissen und episodisches Gedächtnis (Erinnerungen an Ereignisse), während das non-deklarative Gedächtnis prozedurales Wissen (z.B. Fahrradfahren) und Priming-Effekte beinhaltet. Das Kapitel beleuchtet auch den Prozess des Abrufs von Informationen aus dem Gedächtnis und die verschiedenen Ursachen für Vergessen, wie z.B. Zerfall von Gedächtnisspuren oder Interferenz.
4 Möglichkeiten zur Förderung nachhaltigen Lernens am Beispiel neuer Konzepte der Hochschullehre: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Verbesserung des Lernens, indem es neue Konzepte der Hochschullehre wie den Inverted Classroom, Hohenheimer Lernorte und "Lernen mit Dr. House" vorstellt. Diese Konzepte zielen darauf ab, aktives und selbstgesteuertes Lernen zu fördern und die Anwendung des Wissens durch Praxisorientierung zu stärken. Der Fokus liegt auf der Integration von Erkenntnissen der Gedächtnisforschung in die Gestaltung der Lernumgebung.
Schlüsselwörter
Gedächtnis, Lernprozesse, Gedächtnisforschung, Hochschullehre, nachhaltiges Lernen, sensorisches Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis, deklaratives Gedächtnis, non-deklaratives Gedächtnis, Abruf, Vergessen, Inverted Classroom, Hohenheimer Lernorte, Lernen mit Dr. House.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Gedächtnis und nachhaltiges Lernen in der Hochschullehre
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die zeitliche und inhaltliche Dimension des Gedächtnisses und erörtert, wie Erkenntnisse der Gedächtnisforschung in der Hochschullehre nutzbar gemacht werden können, um nachhaltiges Lernen zu fördern.
Welche Aspekte des Gedächtnisses werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Gedächtnissysteme (sensorisches, Kurzzeit-, Langzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis), die Unterscheidung zwischen deklarativem und non-deklarativem Gedächtnis, Prozesse des Abrufs und Vergessens von Informationen.
Welche Lehrkonzepte werden im Kontext der Gedächtnisforschung vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und analysiert neue Konzepte der Hochschullehre wie den Inverted Classroom, Hohenheimer Lernorte und "Lernen mit Dr. House" im Hinblick auf ihre Eignung zur Förderung nachhaltigen Lernens.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Gedächtnisses für Lernprozesse zu verdeutlichen und praktische Anwendungsmöglichkeiten von Erkenntnissen der Gedächtnisforschung in der Hochschullehre aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel über die zeitliche und inhaltliche Dimension des Gedächtnisses, ein Kapitel zu Methoden der Förderung nachhaltigen Lernens anhand neuer Hochschulkonzepte, eine kritische Diskussion, und ein Fazit.
Wie wird das Gedächtnis in seiner zeitlichen Dimension beschrieben?
Das Kapitel zur zeitlichen Dimension beschreibt die verschiedenen Stadien der Gedächtnisverarbeitung: sensorisches Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis (KZG) und Arbeitsgedächtnis (AG), sowie das Langzeitgedächtnis. Es beleuchtet die unterschiedlichen Speicherkapazitäten und -dauern.
Wie wird das Gedächtnis in seiner inhaltlichen Dimension beschrieben?
Die inhaltliche Dimension des Gedächtnisses wird durch die Unterscheidung zwischen deklarativem (explizitem) und non-deklarativem (implizitem) Gedächtnis analysiert. Deklaratives Gedächtnis umfasst Faktenwissen und episodisches Gedächtnis, während non-deklaratives Gedächtnis prozedurales Wissen und Priming-Effekte beinhaltet. Der Abruf von Informationen und Ursachen des Vergessens werden ebenfalls behandelt.
Welche konkreten Beispiele für neue Lehrkonzepte werden genannt?
Als Beispiele für neue Lehrkonzepte werden der Inverted Classroom, Hohenheimer Lernorte und "Lernen mit Dr. House" vorgestellt und im Hinblick auf ihre Anwendung der Gedächtnisforschung analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gedächtnis, Lernprozesse, Gedächtnisforschung, Hochschullehre, nachhaltiges Lernen, sensorisches Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis, deklaratives Gedächtnis, non-deklaratives Gedächtnis, Abruf, Vergessen, Inverted Classroom, Hohenheimer Lernorte, Lernen mit Dr. House.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Dozenten, Lehrende, Studierende und alle, die sich für effektive Lernmethoden und die Anwendung der Gedächtnisforschung in der Bildung interessieren.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Das Gedächtnis in zeitlicher und inhaltlicher Dimension. Wie lassen sich die Erkenntnisse der Gedächtnisforschung im Rahmen der Hochschullehre nutzen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154446