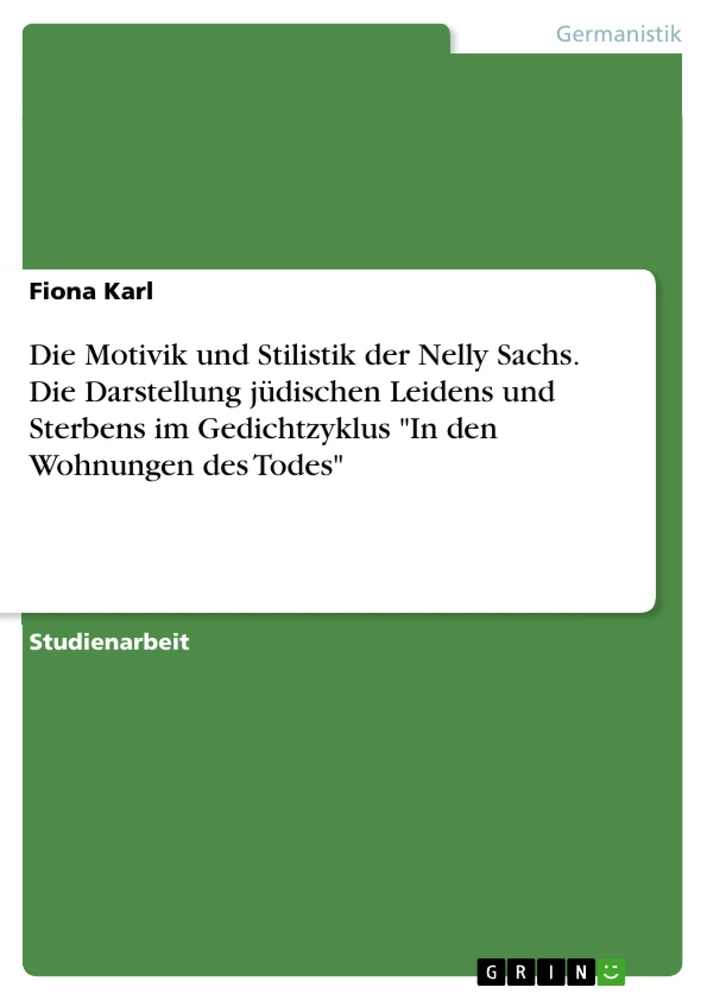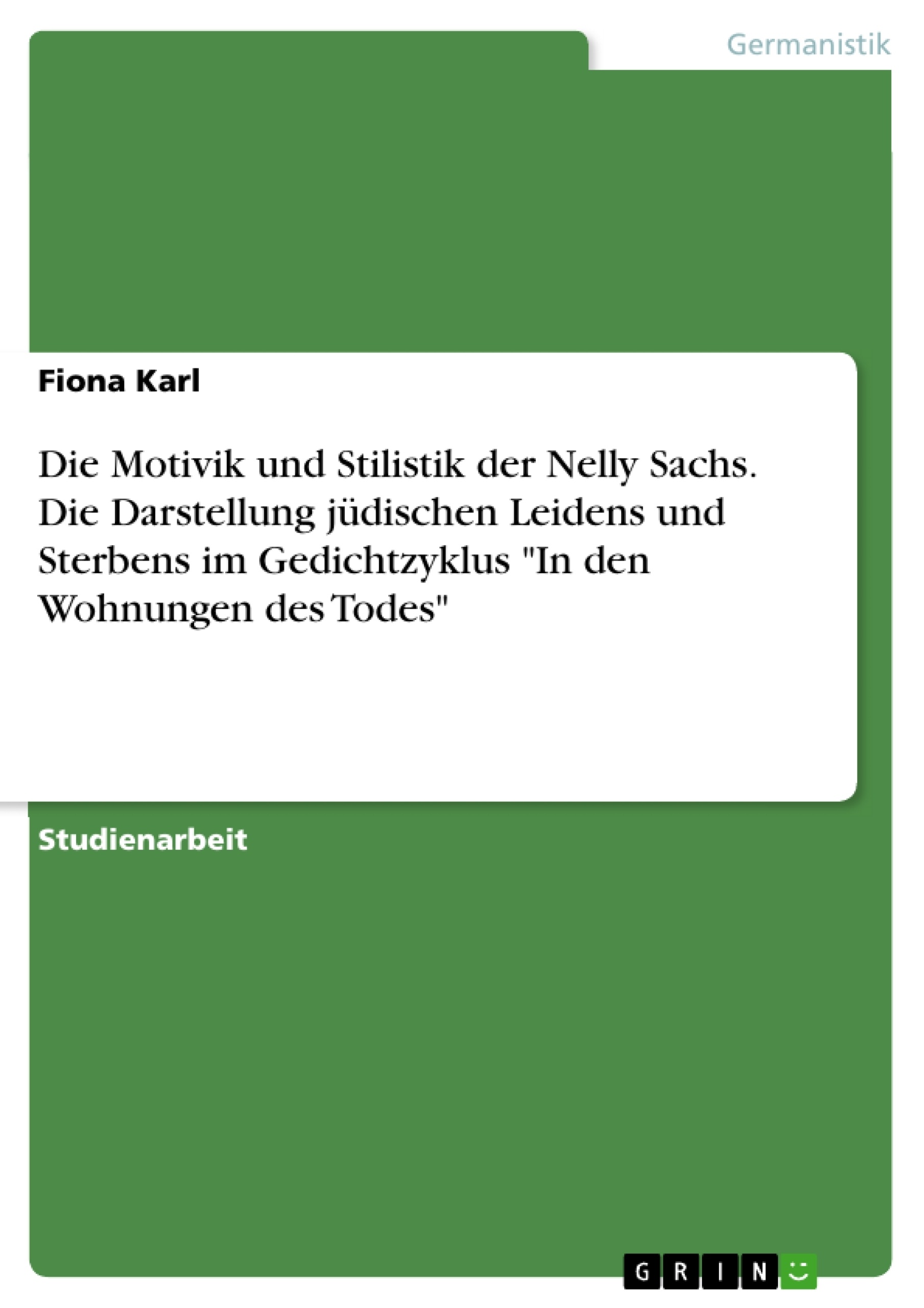Im Folgenden soll ein kurzer Blick auf das sogenannte "Adorno-Diktum" geworfen werden, welches seit der unmittelbaren Nachkriegszeit die Diskussion darüber, ob und wie Gedichte über die Verbrechen der Nationalsozialist:innen in der Shoah verfasst werden können, mit getragen hat.
Darauf aufbauend ist die Frage danach zu beantworten, wie die Dichterin Nelly Sachs mittels ihrer Lyrik versucht hat, der korrekten Darstellung der Shoah so gerecht wie möglich zu werden. Hier soll vor allem untersucht werden, welcher Motivik und Stilistik sie sich bediente, um ihre Gedichte noch eindrucksvoller und kräftiger zu gestalten. Zu diesem Zweck sollen zwei Gedichte analysiert werden, zu denen bislang keine Einzelinterpretationen in der Forschung vorliegen. Diese beiden Gedichte entstammen dem Gedichtband In den Wohnungen des Todes von 1947 und tragen die Titel Auch der Greise und Ihr Zuschauenden. Auch dem Gedichtband In den Wohnungen des Todes ist ein Kapitel gewidmet, welches diesen Gedicht-Raum näher spezifizieren soll.
Da diese beiden Gedichte sich nicht ausschließlich mit der Darstellung der Shoah befassen, sondern mittels der verwendeten Motivik auch aufzeigen, welche Vorstellungen vom Tod und von Gott Nelly Sachs‘ innewohnten, und wie es ihre größte Sehnsucht gewesen zu sein schien, die Opfer der Shoah in den Händen Gottes zu wissen, muss auch dieser Aspekt in der Arbeit beleuchtet werden. Aus diesem Grund trägt die Arbeit den Titel: Die Darstellung des jüdischen Leidens und Sterbens, da Nelly Sachs dies in ihren Gedichten stets miteinander verknüpfte und ihre Auffassungen davon über den Tod hinaus führten. All dies lässt sich anhand der beiden Gedichte untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Unbeschreibliche beschreiben, das Unsagbare sagen
- Sensible Sprache
- Der Diskurs: Was muss ein Gedicht nach Auschwitz leisten?
- Nelly Sachs: In den Wohnungen des Todes
- Auch der Greise
- Ihr Zuschauenden
- Schlussbetrachtung
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gedicht-Motivik von Nelly Sachs anhand ihrer Darstellung des jüdischen Leidens und Sterbens im Gedichtzyklus „In den Wohnungen des Todes“. Sie befasst sich mit der Herausforderung, die Shoah in der unmittelbaren Nachkriegszeit literarisch darzustellen, und beleuchtet die Sensibilität sprachlicher Mittel in diesem Kontext. Die Arbeit untersucht die Frage, wie Nelly Sachs in ihrer Lyrik der Darstellung der Shoah gerecht werden konnte, und analysiert zwei Gedichte aus dem Gedichtband „In den Wohnungen des Todes“ - „Auch der Greise“ und „Ihr Zuschauenden“ - mit Blick auf ihre spezifischen Motivik und Stilistik.
- Die Darstellung des jüdischen Leidens und Sterbens in der Nachkriegslyrik
- Die Herausforderung, die Shoah literarisch darzustellen
- Sensible Sprache in der Holocaustliteratur
- Nelly Sachs' Motivik und Stilistik in „In den Wohnungen des Todes“
- Die Bedeutung des Gedichtbandes „In den Wohnungen des Todes“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel stellt die Problematik der Darstellung der Shoah in der Nachkriegslyrik dar und führt die verwendeten Begriffe wie „Shoah“ und „Holocaust“ sowie die Bedeutung sensibler Sprache im Umgang mit diesem Thema ein. Es wird ein kurzer Blick auf das „Adorno-Diktum“ geworfen, welches die Diskussion über die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Shoah-Dichtung prägte. Anschließend wird die Frage nach Nelly Sachs' lyrischer Annäherung an die Shoah und ihrer Motivik und Stilistik aufgeworfen.
Das Unbeschreibliche beschreiben, das Unsagbare sagen
Sensible Sprache
Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung sensibler Sprache im Kontext der Shoah-Dichtung. Es werden die Begriffe „Shoah“ und „Holocaust“ im Hinblick auf ihre konnotativen Bedeutungen und ihren Gebrauch in der wissenschaftlichen Literatur untersucht. Das Kapitel beleuchtet auch die Verwendung des Begriffs „(nach) Auschwitz“ und seine Bedeutung als pars pro toto für das Leid der Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus. Es wird diskutiert, ob die sprachlichen Mittel überhaupt ausreichen, um die Dimensionen der Shoah angemessen darzustellen.
Der Diskurs: Was muss ein Gedicht nach Auschwitz leisten?
Das Kapitel befasst sich mit der Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Shoah-Dichtung im Kontext des „Adorno-Diktums“. Es wird analysiert, wie Schriftsteller:innen mit dem Paradoxon umgehen, das Leid der Shoah sowohl in ihrer Kunst darzustellen als auch gleichzeitig dem Risiko der Verfälschung oder Banalisierung zu begegnen. Das Kapitel fragt nach der Fähigkeit der Literatur, die Ereignisse des Genozids mit traditionellen Ausdrucksmitteln zu erfassen und zu beschreiben.
Nelly Sachs: In den Wohnungen des Todes
Auch der Greise
Das Kapitel analysiert das Gedicht „Auch der Greise“ von Nelly Sachs im Hinblick auf seine Motivik und Stilistik. Es untersucht, wie Sachs in diesem Gedicht das Leid und den Tod in der Shoah darstellt und welche Vorstellungen von Gott und Menschlichkeit in den Vordergrund gestellt werden.
Ihr Zuschauenden
Das Kapitel analysiert das Gedicht „Ihr Zuschauenden“ von Nelly Sachs im Hinblick auf seine Motivik und Stilistik. Es untersucht, wie Sachs in diesem Gedicht die Rolle der Zuschauer:innen in der Shoah beleuchtet und welche Kritik an der Passivität und dem Schweigen der Gesellschaft geäußert wird.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Lyrik von Nelly Sachs, insbesondere auf ihre Darstellung des jüdischen Leidens und Sterbens in der Shoah. Zu den Schlüsselbegriffen gehören „Shoah“, „Holocaust“, „Sensible Sprache“, „Motivik“, „Stilistik“, „In den Wohnungen des Todes“, „Auch der Greise“, „Ihr Zuschauenden“, „Adorno-Diktum“ und „Holocaustliteratur“.
- Quote paper
- Fiona Karl (Author), 2021, Die Motivik und Stilistik der Nelly Sachs. Die Darstellung jüdischen Leidens und Sterbens im Gedichtzyklus "In den Wohnungen des Todes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154011