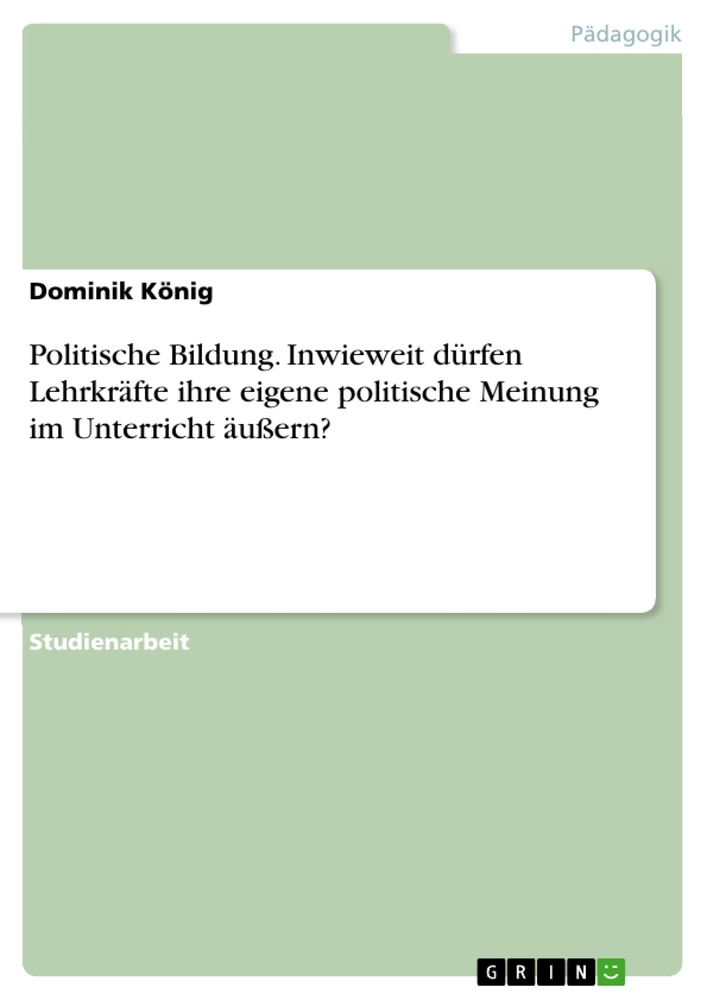Inwieweit dürfen Lehrkräfte ihre eigene politische Meinung im Unterricht äußern? Oder gibt es gar Situationen, in denen Lehrpersonen dazu angehalten sind, eine bestimmte politische Haltung vorzuleben und klar zu äußern? Die Hausarbeit soll dieser Leitfrage nachgehen.
Zuerst wird mit dem Beutelsbacher Konsens ein Grundsatz beschrieben, auf dem seit 45 Jahren Politikunterricht beruht und an dem sich auch die Bundeszentrale für politische Bildung bei ihrer Arbeit orientiert. Anschließend daran wird auf die Frankfurter Erklärung eingegangen, bei der sich renommierte Personen aus Fachdidaktik und Fachwissenschaft für eine zeitgemäße Entwicklung der politischen Bildung aussprechen. Danach wird der vom Land Baden-Württemberg eingeführte Leitfaden Demokratiebildung erläutert. Im fünften Kapitel werden kurz die rechtlichen Grundlagen, welche Lehrkräfte an deutschen Schulen unterstehen, umrissen. Auf den vorangegangenen Abschnitten aufbauend und zusammenführend, findet in Kapitel sechs die Beantwortung der Leitfrage, inwieweit Lehrkräfte ihre eigen politische Meinung im Unterricht äußern dürfen, statt. Das folgende Kapitel geht genauer auf besondere Situationen und Äußerungen ein, bei denen Lehrerinnen und Lehrer angehalten sind, eine gewisse politische Haltung zu zeigen. Im darauffolgenden Kapitel werden die gewonnen Erkenntnisse mit den Themen der Soziologievorlesung in Bezug gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beutelsbacher Konsens
- Frankfurter Erklärung
- Leitfaden Demokratiebildung
- Rechtliche Grundlagen
- Politische Meinungen von Lehrkräften
- Umgang mit rechtsextremistischen Parteien in der Schule
- Bezug zur Vorlesung Gesellschaftliche Bedingungen und Formen von Bildungsprozessen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, inwieweit Lehrkräfte ihre eigene politische Meinung im Unterricht äußern dürfen. Dazu werden verschiedene Leitlinien und Prinzipien der politischen Bildung beleuchtet, wie der Beutelsbacher Konsens und die Frankfurter Erklärung.
- Der Beutelsbacher Konsens als grundlegendes Prinzip der politischen Bildung in Deutschland
- Die Frankfurter Erklärung als Forderung nach einer zeitgemäßen Entwicklung der politischen Bildung
- Der Leitfaden Demokratiebildung als praktische Umsetzung der Prinzipien der politischen Bildung
- Die rechtlichen Grundlagen, die Lehrkräfte in Deutschland beachten müssen
- Die Bedeutung der politischen Bildung für die Herausbildung demokratischer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 erläutert den Beutelsbacher Konsens, der 1976 als Minimalkonsens zwischen verschiedenen Lagern der Politikdidaktik erarbeitet wurde. Dieser Konsens stellt bis heute einen Referenzrahmen für die politische Bildung in Deutschland dar und umfasst drei Protokollpunkte: Überwältigungsverbot, Kontroversität von Wissenschaft und Politik im Unterricht und die Vermittlung von Handlungskompetenz bei den Schülern.
- Kapitel 3 befasst sich mit der Frankfurter Erklärung, die von renommierten Personen aus Fachdidaktik und Fachwissenschaft verfasst wurde. Die Erklärung fordert eine zeitgemäße Weiterentwicklung der politischen Bildung, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.
- Kapitel 4 stellt den Leitfaden Demokratiebildung des Landes Baden-Württemberg vor, der sich auf die Prinzipien des Beutelsbacher Konsens stützt. Der Leitfaden bietet Lehrkräften eine konkrete Hilfestellung für die Umsetzung der politischen Bildung im Unterricht.
- Kapitel 5 gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, denen Lehrkräfte in Deutschland unterstehen. Dieser Rahmen umfasst Gesetze und Verordnungen, die das Berufsbild der Lehrkraft sowie die Ausübung des Schulbetriebs regeln.
- Kapitel 6 setzt sich mit der Leitfrage der Hausarbeit auseinander, inwieweit Lehrkräfte ihre eigene politische Meinung im Unterricht äußern dürfen. Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Kapitel wird die Argumentation entwickelt, dass Lehrkräfte ihre eigene Meinung zwar nicht aktiv vertreten dürfen, aber dennoch ihre politische Haltung zum Ausdruck bringen können.
- Kapitel 7 geht auf besondere Situationen ein, in denen Lehrkräfte angehalten sind, eine bestimmte politische Haltung zu zeigen, beispielsweise im Umgang mit rechtsextremistischen Parteien.
- Kapitel 8 setzt die Erkenntnisse der Hausarbeit in Bezug zu den Themen der Vorlesung "Gesellschaftliche Bedingungen und Formen von Bildungsprozessen".
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Begriffe und Themen der Hausarbeit sind: politische Bildung, Beutelsbacher Konsens, Frankfurter Erklärung, Leitfaden Demokratiebildung, rechtliche Grundlagen, Lehrkräfte, politische Meinung, Demokratie, Partizipation, Bildungsprozesse, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Ein Grundsatz der politischen Bildung in Deutschland, der ein Überwältigungsverbot, das Gebot der Kontroversität und die Förderung der Schüler-Handlungskompetenz vorschreibt.
Dürfen Lehrkräfte ihre eigene politische Meinung im Unterricht äußern?
Lehrkräfte dürfen ihre Meinung nicht aktiv als "die richtige" vertreten (Indoktrinationsverbot), können sie aber als eine von vielen Positionen im Rahmen der Kontroversität einbringen.
Was versteht man unter dem Überwältigungsverbot?
Es untersagt Lehrern, Schüler im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und sie an der eigenständigen Urteilsbildung zu hindern.
In welchen Situationen müssen Lehrkräfte eine klare Haltung zeigen?
Bei verfassungsfeindlichen Äußerungen oder rechtsextremistischen Tendenzen sind Lehrkräfte angehalten, die demokratischen Grundwerte aktiv zu verteidigen.
Was ist das Ziel der Demokratiebildung an Schulen?
Ziel ist die Herausbildung demokratischer Kompetenzen, die Förderung von Partizipation und die Befähigung zur Teilhabe an politischen Prozessen.
- Citation du texte
- Dominik König (Auteur), 2021, Politische Bildung. Inwieweit dürfen Lehrkräfte ihre eigene politische Meinung im Unterricht äußern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152982