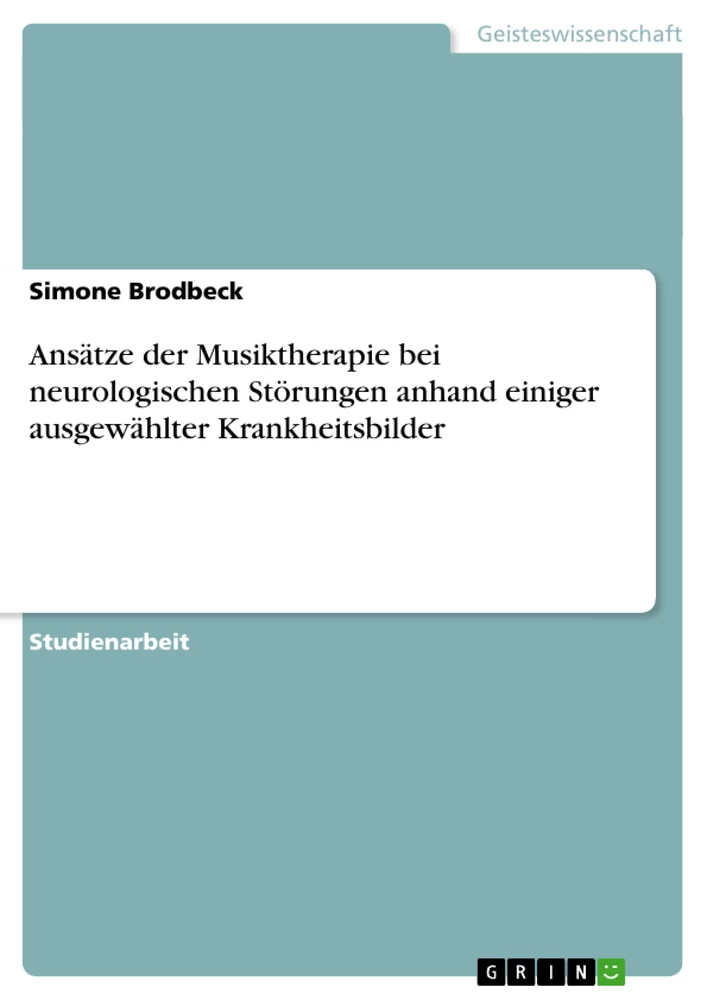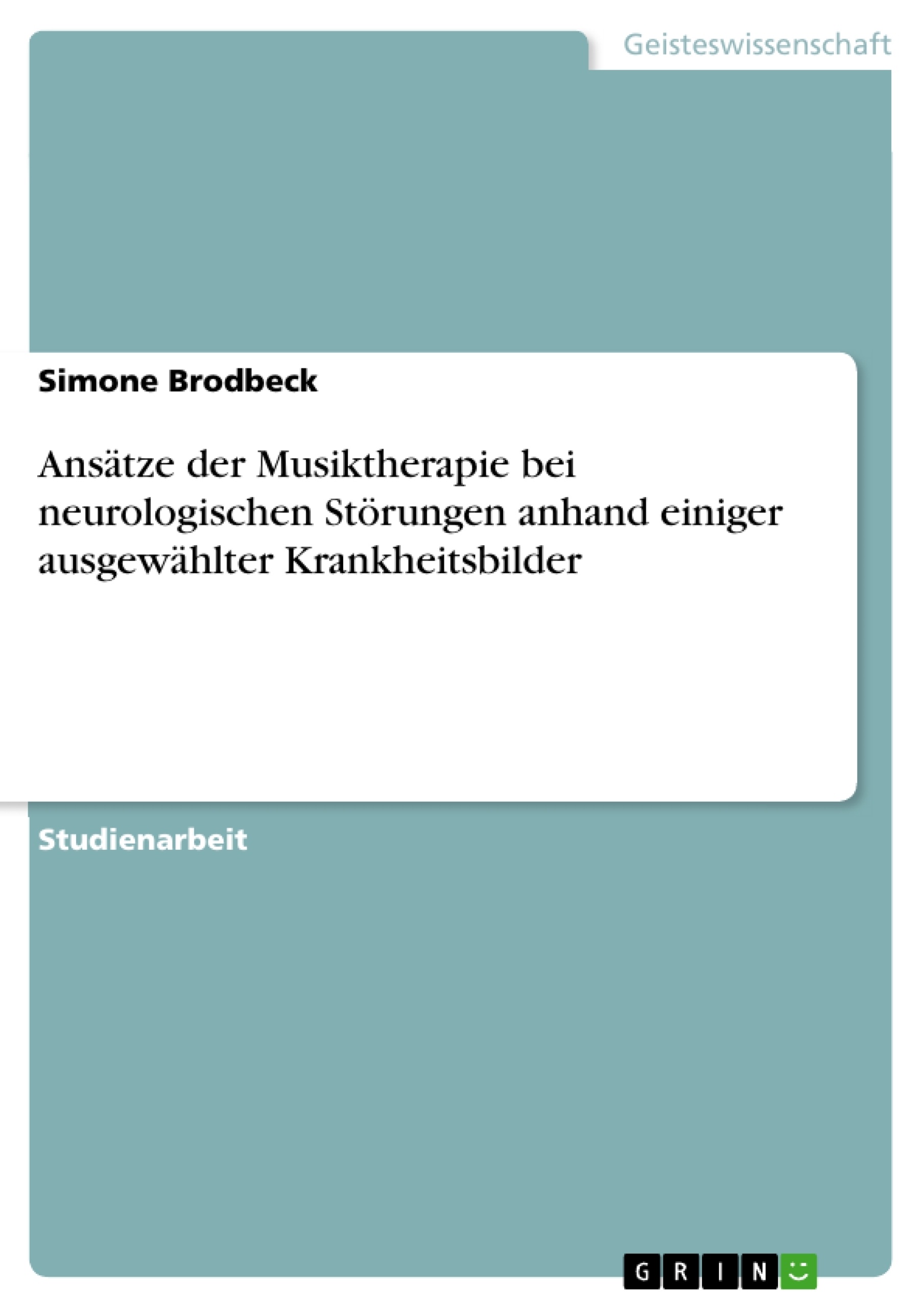Wer kennt sie nicht – die Hymnen der Musik über die Musik?
John Miles beschreibt in „Music“ (1976) seine Liebe zur Musik mit den Worten „music was my first love and it’ll be my last“. In den 70er Jahren verzauberte die schwedische Popgruppe ABBA mit „Thank you for the music” (1978) tausende Menschen. Eine Hymne an die Musik, die durch Singen und Melodien das Leben lebenswert machen, die in den 90er Jahren durch das Musical „Mamma Mia“ wieder aktuell wurde.
Musik begleitet uns mittlerweile fast rund um die Uhr. Das altbewährte Klingeln des Weckers wurde durch Radiomusik ersetzt. Eine Autofahrt ohne Musik – für viele undenkbar. Einkaufszentren versuchen ihre Kunden durch Hintergrundmusik zu manipulieren und zum Kauf zu animieren. In der S-Bahn kann man sich vor verschiedenen Musikrichtungen kaum retten und sogar beim Joggen begleitet uns die Musik. Sie ist allgegenwärtig.
„Liebling, sie spielen unser Lied“ – wohl einer der meist gesprochenen Sätze weltweit. Wir verbinden Musik mit Emotionen, erinnern uns bei bestimmten Liedern an Gefühle, z.B. der erste Kuss, der erste Tanz usw. Wenn wir traurig sind, hilft uns Musik dieses Gefühl zu ertragen. Musik, eine geheimnisvolle Macht.
Oliver Sacks beschreibt in seinem Buch „Der einarmige Pianist“ (Sacks 2008, S.239) einen Aphasiker, der mit Hilfe der Musik wieder zu seiner Sprache gefunden hat. Ein ähnliches Beispiel, das wir in Neuropsychologie gehört haben, hat mich derart begeistert, dass ich wissen wollte, wie Musik – speziell die Musiktherapie bei anderen neurologischen Störungen eingesetzt wird und wirken kann.
Im Rahmen dieser Hausarbeit wird zuerst der Begriff Musiktherapie definiert, um anschließend anhand einiger ausgewählter Störungsbilder zu zeigen, wie die Musik auf Patienten wirken kann. Im Anschluss daran versuche ich eine Verbindung zur Sozialen Arbeit herzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Musiktherapie?
- 2.1 Definition
- 2.2 Aktive Musiktherapie
- 2.3 Rezeptive Musiktherapie
- 2.4 Anwendungsbereiche
- 3. Musiktherapie in der Neurologie
- 3.1 Aphasie
- 3.1.1 Symptome
- 3.1.2 Möglichkeiten durch die Musiktherapie
- 3.2 Apallisches Syndrom
- 3.2.1 Symptome
- 3.2.2 Wirkungsweise der Musiktherapie
- 3.3 Amnesie
- 3.3.1 Symptome
- 3.3.2 Behandlungsmöglichkeiten mit Musiktherapie
- 4. Musiktherapie und Soziale Arbeit
- 4.1 Geschichte der Musiktherapie
- 4.2 Ansatzpunkte Musiktherapie und Sozialen Arbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einsatz von Musiktherapie bei neurologischen Störungen. Ziel ist es, die Definition und verschiedenen Ansätze der Musiktherapie zu erläutern und deren Wirksamkeit anhand ausgewählter Krankheitsbilder zu beleuchten. Zusätzlich wird der Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt.
- Definition und verschiedene Methoden der Musiktherapie (aktiv und rezeptiv)
- Anwendung der Musiktherapie bei spezifischen neurologischen Störungen (Aphasie, apallisches Syndrom, Amnesie)
- Wirkungsweise der Musiktherapie auf kognitiver und emotionaler Ebene
- Der Zusammenhang zwischen Musiktherapie und Sozialer Arbeit
- Potenzial der Musiktherapie zur Verbesserung der Kommunikation und sozialen Interaktion bei neurologischen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit eindrucksvollen Beispielen die allgegenwärtige Rolle von Musik im menschlichen Leben ein und betont deren emotionale Bedeutung. Der Fokus wird auf die Anwendung der Musiktherapie bei neurologischen Störungen gelenkt, wobei ein persönliches Beispiel die Motivation der Arbeit unterstreicht. Es wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben, der die Definition der Musiktherapie, deren Anwendung bei ausgewählten Krankheitsbildern und den Bezug zur Sozialen Arbeit umfasst.
2. Was ist Musiktherapie?: Dieses Kapitel definiert Musiktherapie als den gezielten therapeutischen Einsatz von Musik zur Förderung der seelischen, körperlichen und geistigen Gesundheit. Es wird ein historischer Abriss gegeben, der die uralte Erkenntnis der heilenden Wirkung von Musik beleuchtet, von der Antike bis zu heutigen Anwendungen bei Naturvölkern. Die Unterscheidung zwischen aktiver und rezeptiver Musiktherapie wird erklärt, wobei die aktive Therapie die aktive Beteiligung des Patienten am Musizieren beinhaltet, während die rezeptive Therapie die passive Wahrnehmung von Musik umfasst. Schließlich werden die vielseitigen Anwendungsbereiche der Musiktherapie im Sozial- und Gesundheitswesen, insbesondere in klinischen Bereichen, aufgezeigt, mit einem Fokus auf die Verarbeitung psychischer und sozialer Folgen von Krankheiten.
Schlüsselwörter
Musiktherapie, Neurologische Störungen, Aphasie, Apallisches Syndrom, Amnesie, Aktive Musiktherapie, Rezeptive Musiktherapie, Soziale Arbeit, Kommunikation, Emotion, Rehabilitation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Musiktherapie bei neurologischen Störungen
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit dem Einsatz von Musiktherapie bei neurologischen Störungen. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition der Musiktherapie mit ihren verschiedenen Ansätzen (aktiv und rezeptiv), eine detaillierte Untersuchung der Anwendung der Musiktherapie bei Aphasie, apallischem Syndrom und Amnesie, sowie eine Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Musiktherapie und Sozialer Arbeit. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was wird unter Musiktherapie verstanden?
Die Hausarbeit definiert Musiktherapie als den gezielten therapeutischen Einsatz von Musik zur Förderung der seelischen, körperlichen und geistigen Gesundheit. Es wird zwischen aktiver Musiktherapie (aktive Beteiligung des Patienten am Musizieren) und rezeptiver Musiktherapie (passive Wahrnehmung von Musik) unterschieden. Die Arbeit beleuchtet auch die historische Entwicklung und die vielseitigen Anwendungsbereiche der Musiktherapie.
Welche neurologischen Störungen werden behandelt?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Anwendung der Musiktherapie bei drei spezifischen neurologischen Störungen: Aphasie, apallischem Syndrom und Amnesie. Für jede Störung werden Symptome beschrieben und die Möglichkeiten der Behandlung mit Musiktherapie erläutert. Die Wirkungsweise der Musiktherapie auf kognitiver und emotionaler Ebene wird ebenfalls thematisiert.
Wie wirkt die Musiktherapie bei den genannten Störungen?
Die Hausarbeit beschreibt die Wirkungsweise der Musiktherapie bei Aphasie, apallischem Syndrom und Amnesie, wobei die jeweiligen Möglichkeiten und die Auswirkungen auf kognitiver und emotionaler Ebene detailliert dargestellt werden. Es wird beispielsweise erläutert, wie Musiktherapie die Kommunikation und soziale Interaktion verbessern kann.
Welchen Bezug hat die Musiktherapie zur Sozialen Arbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Musiktherapie und Sozialer Arbeit, inklusive eines historischen Abrisses und der Darstellung gemeinsamer Ansatzpunkte. Der Fokus liegt auf dem Potenzial der Musiktherapie zur Verbesserung der Kommunikation und sozialen Interaktion bei neurologischen Erkrankungen im Kontext der Sozialen Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit hat zum Ziel, den Einsatz von Musiktherapie bei neurologischen Störungen zu untersuchen, die Definition und verschiedenen Ansätze der Musiktherapie zu erläutern und deren Wirksamkeit anhand ausgewählter Krankheitsbilder zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bezug zur Sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Musiktherapie, Neurologische Störungen, Aphasie, Apallisches Syndrom, Amnesie, Aktive Musiktherapie, Rezeptive Musiktherapie, Soziale Arbeit, Kommunikation, Emotion, Rehabilitation.
- Citar trabajo
- Simone Brodbeck (Autor), 2008, Ansätze der Musiktherapie bei neurologischen Störungen anhand einiger ausgewählter Krankheitsbilder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115027