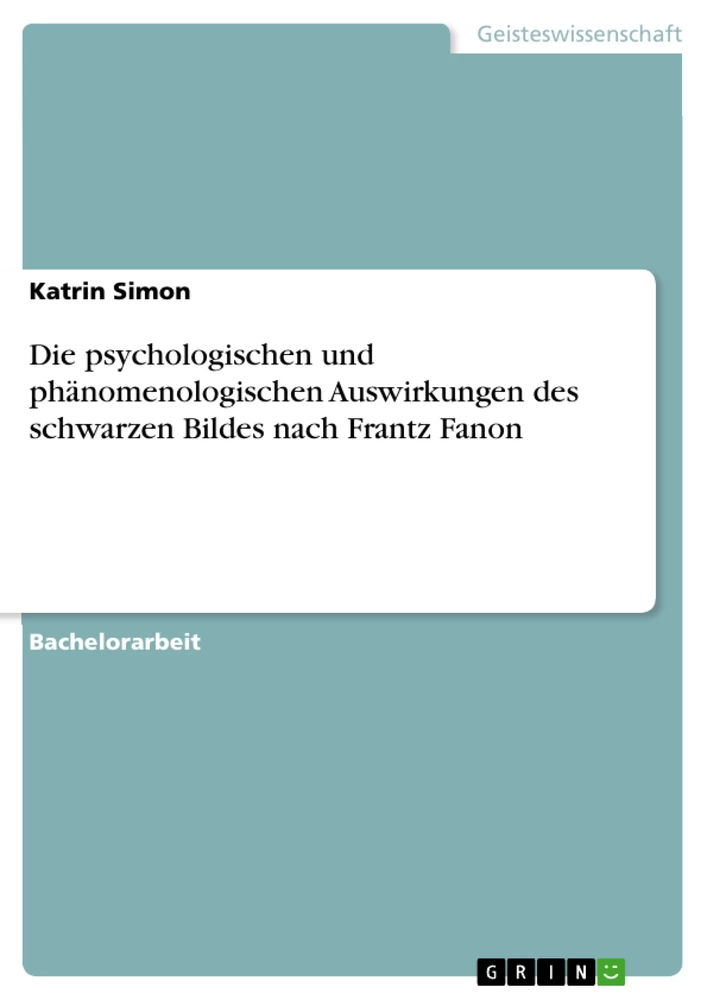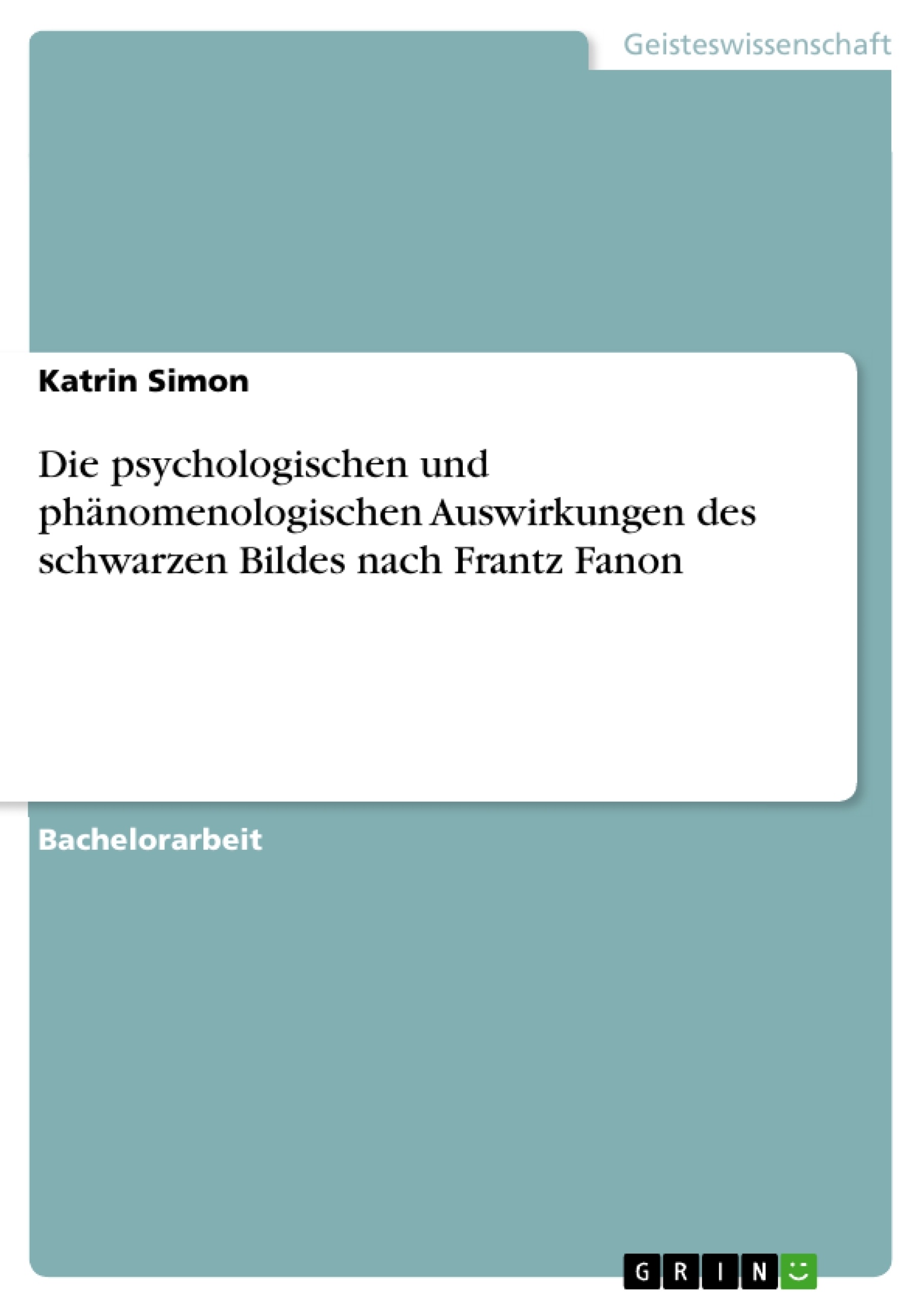Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Aspekt des schwarzen Problems, wie Fanon es benennt. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass Fanon darüber hinaus angibt, dass das schwarze Problem sich nicht in den Problemen der Schwarzen erschöpft, die in einer weißen Gesellschaft leben, sondern es auch jene betrifft, die unter der Unterdrückung und Ausbeutung durch die weiße Welt leiden. Diese Arbeit konzentriert sich jedoch größtenteils auf die Probleme der Schwarzen, mit denen sie sich in der weißen Welt konfrontiert sehen.
Es gilt in dieser Arbeit herauszuarbeiten, mit welchen Schwierigkeiten sich der Schwarze, der in einer weißen Welt lebt, konfrontiert sieht. Hierbei geht es mir sowohl um die psychologischen Auswirkungen auf das Individuum als auch um die phänomenologischen Folgen für die schwarze Gesellschaft als Ganzes.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die Entstehung des schwarzen Bildes
- Der europäische Blick auf den Kolonisierten
- Die manichäische Struktur der zweigeteilten Welt
- Die Konstituierung des schwarzen Bildes
- Die manichäische Struktur von „,schwarz-weiß“
- Das stereotypisierende Bild des Weißen
- Das stereotypisierende Bild des Schwarzen
- Über die psychologischen und phänomenologischen Auswirkungen des schwarzen Bildes
- Die ,,Psychopathologie“ des Schwarzen nach Fanon
- Das Selbstbild des Schwarzen
- Anpassung an die weiße Welt und Internalisierung der weißen Werte
- Entfremdung
- Der Schwarze in der weißen Welt
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den psychologischen und phänomenologischen Auswirkungen des „schwarzen Bildes“ nach Frantz Fanon. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Prozesse der Normalisierung und Internalisierung europäischer Sichtweisen und Wertmaßstäbe in der kolonialen Situation. Die Arbeit untersucht, wie das „schwarze Bild“ im Kontext des europäischen Blicks entsteht und welche Folgen dies für die Selbstwahrnehmung und die soziale Situation des Schwarzen in der weißen Welt hat.
- Die Entstehung des „schwarzen Bildes“ durch den europäischen Blick auf den Kolonisierten
- Die manichäische Struktur der Welt, die das „schwarze Bild“ prägt
- Die psychologischen Auswirkungen des „schwarzen Bildes“ auf die Selbstwahrnehmung des Schwarzen
- Die soziale und politische Situation des Schwarzen in der weißen Welt
- Die Bedeutung von Fanons Werk für die postkoloniale Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Entstehung des „schwarzen Bildes“ im Kontext des Kolonialismus. Fanon beschreibt, wie der europäische Blick den Kolonisierten als „Anderen“ definiert und ihn durch die Konstruktion eines stereotypen Bildes entmenschlicht. Das zweite Kapitel widmet sich der manichäischen Struktur der Welt, die durch die Dichotomie „schwarz-weiß“ geprägt ist. Fanon argumentiert, dass diese Struktur sowohl das „schwarze Bild“ als auch das „weiße Bild“ prägt und zu einer hierarchischen Ordnung führt, in der der Weiße als überlegen und der Schwarze als unterlegen betrachtet wird. Das dritte Kapitel untersucht die psychologischen und phänomenologischen Folgen des „schwarzen Bildes“ für den Schwarzen. Fanon beschreibt die Auswirkungen der Internalisierung des „weißen Blicks“ auf das Selbstbild des Schwarzen, die zu Selbstzweifeln, Entfremdung und Anpassungsdruck führen. Der Schwarze in der weißen Welt ist somit einem ständigen Kampf mit dem „schwarzen Bild“ ausgesetzt, das von der weißen Gesellschaft projiziert wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind „schwarzes Bild“, Kolonialismus, Europäischer Blick, manichäische Struktur, Selbstbild, Entfremdung, Internalisierung, Psychopathologie, postkoloniale Kritik und Frantz Fanon. Diese Begriffe stehen im Mittelpunkt der Analyse der psychologischen und phänomenologischen Auswirkungen des „schwarzen Bildes“ auf den Schwarzen in der weißen Welt.
- Quote paper
- Katrin Simon (Author), 2020, Die psychologischen und phänomenologischen Auswirkungen des schwarzen Bildes nach Frantz Fanon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149270