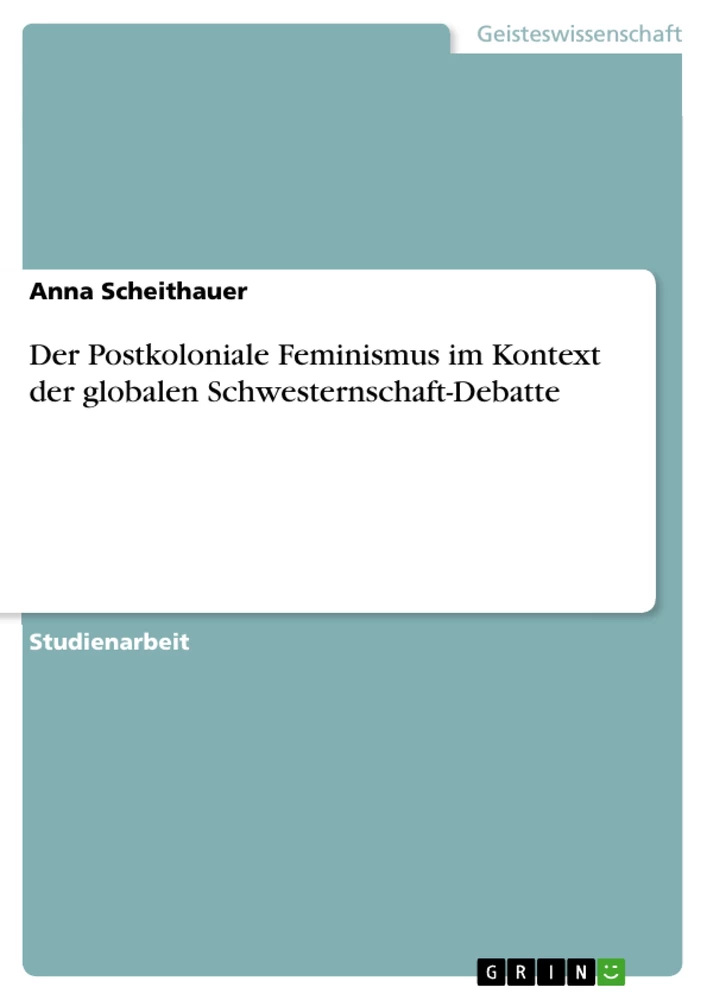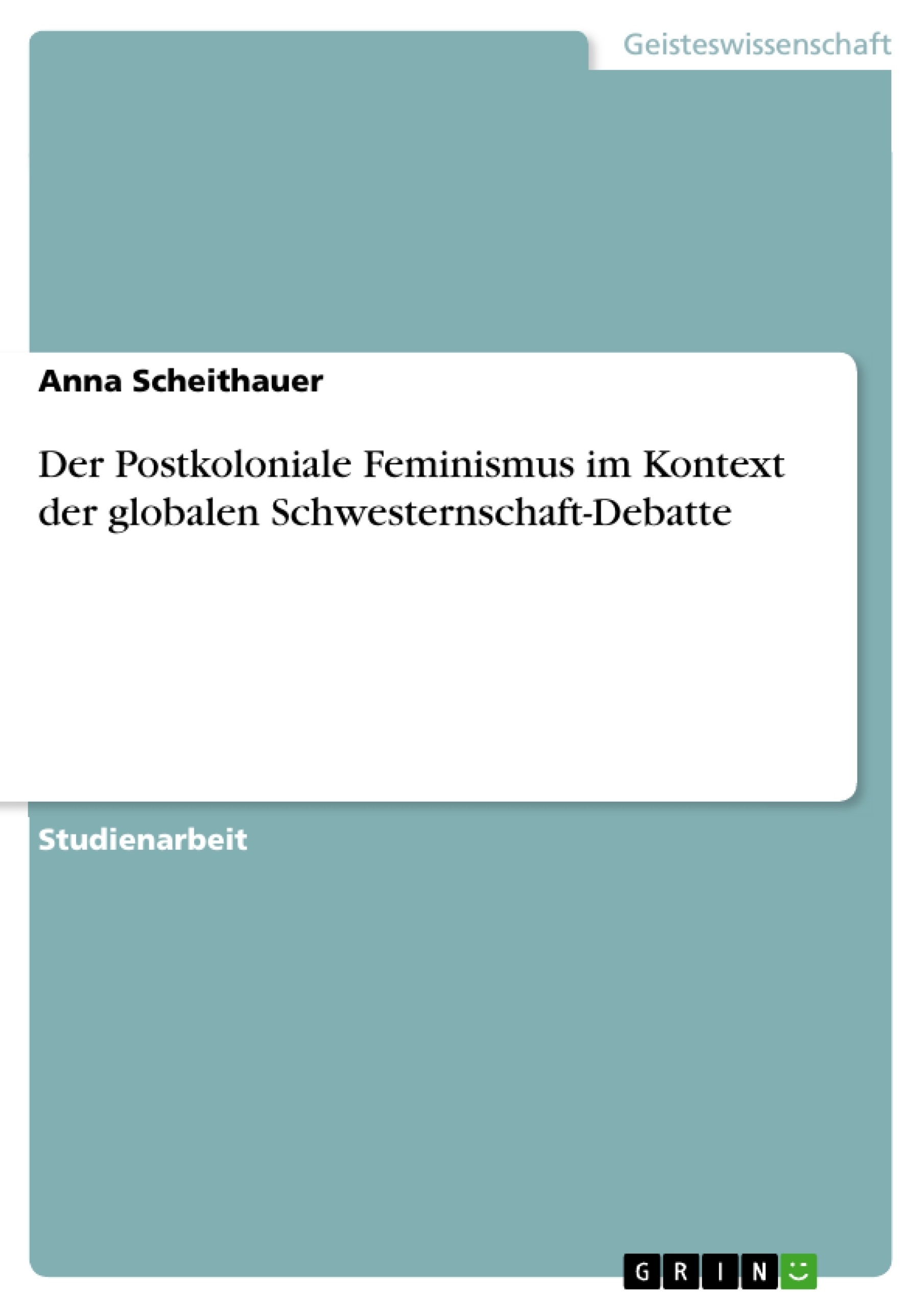In meiner Arbeit möchte ich die vorherrschende diskursive Dichotomisierung der IS Frauen, die entweder als Opfer oder als Täterinnen vor allem in Bezug zur gegenwärtigen Staatsbürgerschaftsdebatte dargestellt werden, aufbrechen. Dabei möchte ich vorrangig dem Spannungsverhältnis der globalen Schwesternschaft-Debatte zwischen dem liberalen und dem postkolonialen Feminismus im Kontext der globalen Rekrutierung von Frauen zum Islamischen Staat nachgehen. Meine Forschungsfrage formuliere ich daher, wie folgt: Kann das Konzept von Schwesternschaft der Terrorgruppe des Islamischen Staates im Sinne von Mohanty‘s postkolonial-feministischem Vorschlag einer antikapitalistischen "noncolonizing feminist solidarity across borders" in Abgrenzung zum liberal feministischen Konzept einer globalen Schwesternschaft verstanden werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation und Forschungsfrage
- 1.2 Methodologie
- 1.3 Stand der Forschung
- 2. Imperialismus
- 2.1 Westlicher Femonationalismus
- 2.2 IS Genderappartheid
- 3. Diskursive Kolonisierung
- 3.1 Konstruktion von Differenzen
- 3.2 IS Genderpropaganda
- 4. Essentialismus
- 4.1 Schwesternschaft
- 4.2 Hierarchisierung von Identitäten
- 5. Repräsentation und Subalternität
- 5.1 Repräsentation der IS Subalternen
- 6. Konklusion
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Frauen im Islamischen Staat (IS) im Spannungsfeld zwischen liberalem und postkolonialem Feminismus, insbesondere im Kontext der "globalen Schwesternschaft"-Debatte. Sie hinterfragt die gängige Dichotomisierung der IS-Frauen als Opfer oder Täterinnen und analysiert die Rekrutierung von Frauen in den IS aus einer kritisch-postkolonialen Perspektive.
- Der Einfluss des westlichen Imperialismus auf die Konstruktion von Genderrollen im IS.
- Die Rolle der diskursiven Kolonisierung in der Darstellung und Wahrnehmung der IS-Frauen.
- Die Problematik des Essentialismus und die Hierarchisierung von Identitäten im Kontext des IS.
- Die Repräsentation von Subalternität und die Perspektiven der betroffenen Frauen.
- Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der "globalen Schwesternschaft" im postkolonialen feministischen Diskurs.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der weiblichen IS-Rekrutinnen ein, betont deren zahlenmäßige Bedeutung, insbesondere aus westlichen Ländern, und hebt die Besonderheiten der IS-Frauenpolitik hervor. Die Autorin erläutert ihre Motivation und Forschungsfrage, die sich auf das Spannungsverhältnis zwischen liberalem und postkolonialem Feminismus im Kontext der globalen Schwesternschaft-Debatte konzentriert. Die methodologische Herangehensweise, die auf postkolonial-feministischen Theorien und Primärquellen wie dem "Manifesto for Women in the Islamic State" basiert, wird ebenfalls dargelegt. Die Arbeit zielt darauf ab, die vereinfachende Opfer-Täter-Dichotomie zu überwinden und die Erfahrungen der Frauen intersektional zu analysieren.
2. Imperialismus: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss des westlichen Imperialismus auf die Konstruktion von Genderrollen innerhalb des IS und im Kontext der globalen Schwesternschaft-Debatte. Es untersucht, wie westliche Machtstrukturen und koloniale Denkweisen die Situation von Frauen im IS beeinflussen und die Möglichkeiten einer solidarischen, antikolonialen Perspektive einschränken. Der Fokus liegt auf den Mechanismen, durch die westlicher Femonationalismus die Perspektiven und Erfahrungen von Frauen im IS prägt. Der Abschnitt über die IS-Genderappartheid beleuchtet die spezifischen Unterdrückungsmechanismen und die Rolle des Geschlechts im System des IS.
3. Diskursive Kolonisierung: Hier wird die Konstruktion von Differenzen und die Rolle der IS-Genderpropaganda analysiert. Der Fokus liegt darauf, wie diskursive Strategien des IS und des Westens die Wahrnehmung der IS-Frauen beeinflussen und sie in vorgegebene Rollenbilder pressen. Das Kapitel untersucht, wie der IS seine Ideologie verbreitet und Frauen in seine Strukturen integriert, und wie diese Strategien im Kontext der Kolonialgeschichte und der anhaltenden Machtstrukturen zu verstehen sind. Die Analyse beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der Wirkungsweise von Propaganda und deren Beitrag zur Konstruktion von Feindbildern.
4. Essentialismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Problematik des Essentialismus, insbesondere in Bezug auf die "Schwesternschaft" und die Hierarchisierung von Identitäten. Es analysiert kritisch, wie essentiellistische Vorstellungen von weiblicher Identität und religiöser Zugehörigkeit die Vielfalt der Erfahrungen der IS-Frauen übersehen und vereinfachen. Es wird untersucht, wie der IS solche Konzepte instrumentalisiert und wie sie im Kontext der postkolonialen feministischen Kritik zu beurteilen sind. Die Hierarchisierung von Identitäten wird beleuchtet, um die Komplexität der Intersektionalität aufzuzeigen.
5. Repräsentation und Subalternität: Das Kapitel konzentriert sich auf die Repräsentation der IS-Frauen als "Subalterne" und analysiert, wie ihre Stimmen und Perspektiven in öffentlichen Diskursen dargestellt werden. Es untersucht kritisch, wie Medien, Politik und akademische Debatten die Erfahrungen der Frauen verzerren oder ausblenden. Der Fokus liegt auf der Frage, wie eine authentische Repräsentation der Subalternen erreicht werden kann und welche Herausforderungen dies im Kontext des IS mit sich bringt. Es wird kritisch hinterfragt, wie die jeweiligen Machtverhältnisse die Darstellung der Frauen beeinflussen.
Schlüsselwörter
Postkolonialer Feminismus, Islamischer Staat (IS), Globale Schwesternschaft, Gender, Religion, Herkunft, Imperialismus, Diskursive Kolonisierung, Essentialismus, Repräsentation, Subalternität, Intersektionalität, Femonationalismus, Genderappartheid, Propaganda.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Frauen im Islamischen Staat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Frauen im Islamischen Staat (IS) im Spannungsfeld zwischen liberalem und postkolonialem Feminismus, insbesondere im Kontext der "globalen Schwesternschaft"-Debatte. Sie untersucht die Rekrutierung von Frauen in den IS aus einer kritisch-postkolonialen Perspektive und hinterfragt die gängige Dichotomisierung der IS-Frauen als Opfer oder Täterinnen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des westlichen Imperialismus auf die Konstruktion von Genderrollen im IS, die Rolle der diskursiven Kolonisierung in der Darstellung und Wahrnehmung der IS-Frauen, die Problematik des Essentialismus und die Hierarchisierung von Identitäten im Kontext des IS, die Repräsentation von Subalternität und die Perspektiven der betroffenen Frauen sowie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der "globalen Schwesternschaft" im postkolonialen feministischen Diskurs.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf postkolonial-feministischen Theorien und Primärquellen wie dem "Manifesto for Women in the Islamic State". Sie zielt darauf ab, die vereinfachende Opfer-Täter-Dichotomie zu überwinden und die Erfahrungen der Frauen intersektional zu analysieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt: Einleitung (Motivation, Forschungsfrage, Methodologie, Stand der Forschung), Imperialismus (Westlicher Femonationalismus, IS Genderappartheid), Diskursive Kolonisierung (Konstruktion von Differenzen, IS Genderpropaganda), Essentialismus (Schwesternschaft, Hierarchisierung von Identitäten), Repräsentation und Subalternität (Repräsentation der IS Subalternen) und Konklusion. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Postkolonialer Feminismus, Islamischer Staat (IS), Globale Schwesternschaft, Gender, Religion, Herkunft, Imperialismus, Diskursive Kolonisierung, Essentialismus, Repräsentation, Subalternität, Intersektionalität, Femonationalismus, Genderappartheid und Propaganda.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detaillierte Einblicke in die jeweilige Thematik jedes Kapitels. Sie beschreibt den Fokus und die Argumentationslinie jedes Abschnitts und verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den einzelnen Kapiteln.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit will ein umfassendes Verständnis der komplexen Situation von Frauen im IS ermöglichen, indem sie verschiedene Perspektiven und Theorien einbezieht und die vereinfachenden Narrative hinterfragt. Sie strebt nach einer differenzierten Analyse, die die Intersektionalität der Erfahrungen der Frauen berücksichtigt.
- Citation du texte
- Anna Scheithauer (Auteur), 2021, Der Postkoloniale Feminismus im Kontext der globalen Schwesternschaft-Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1148316