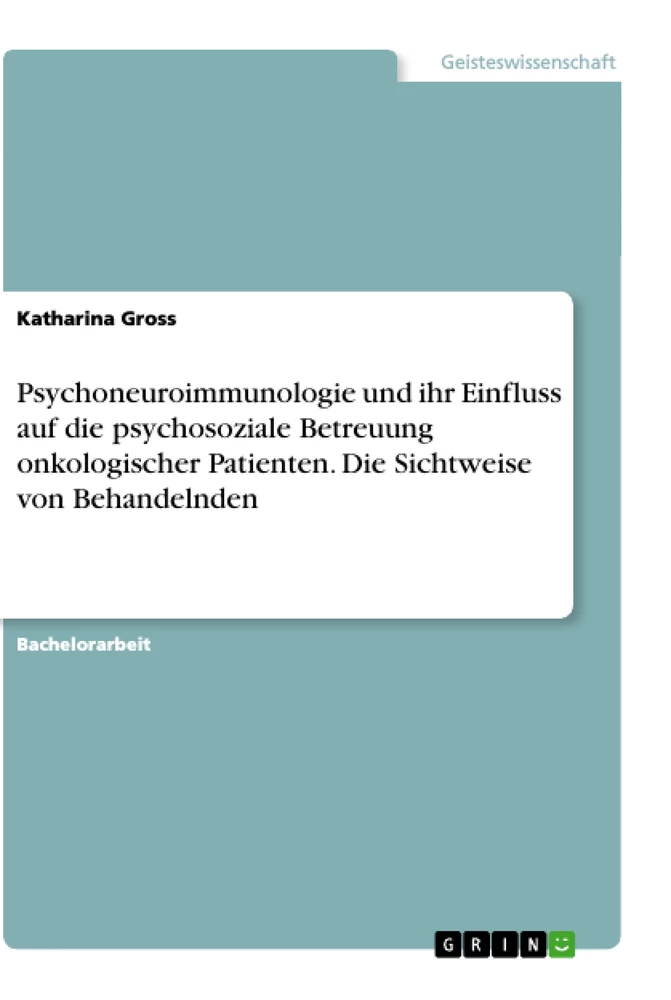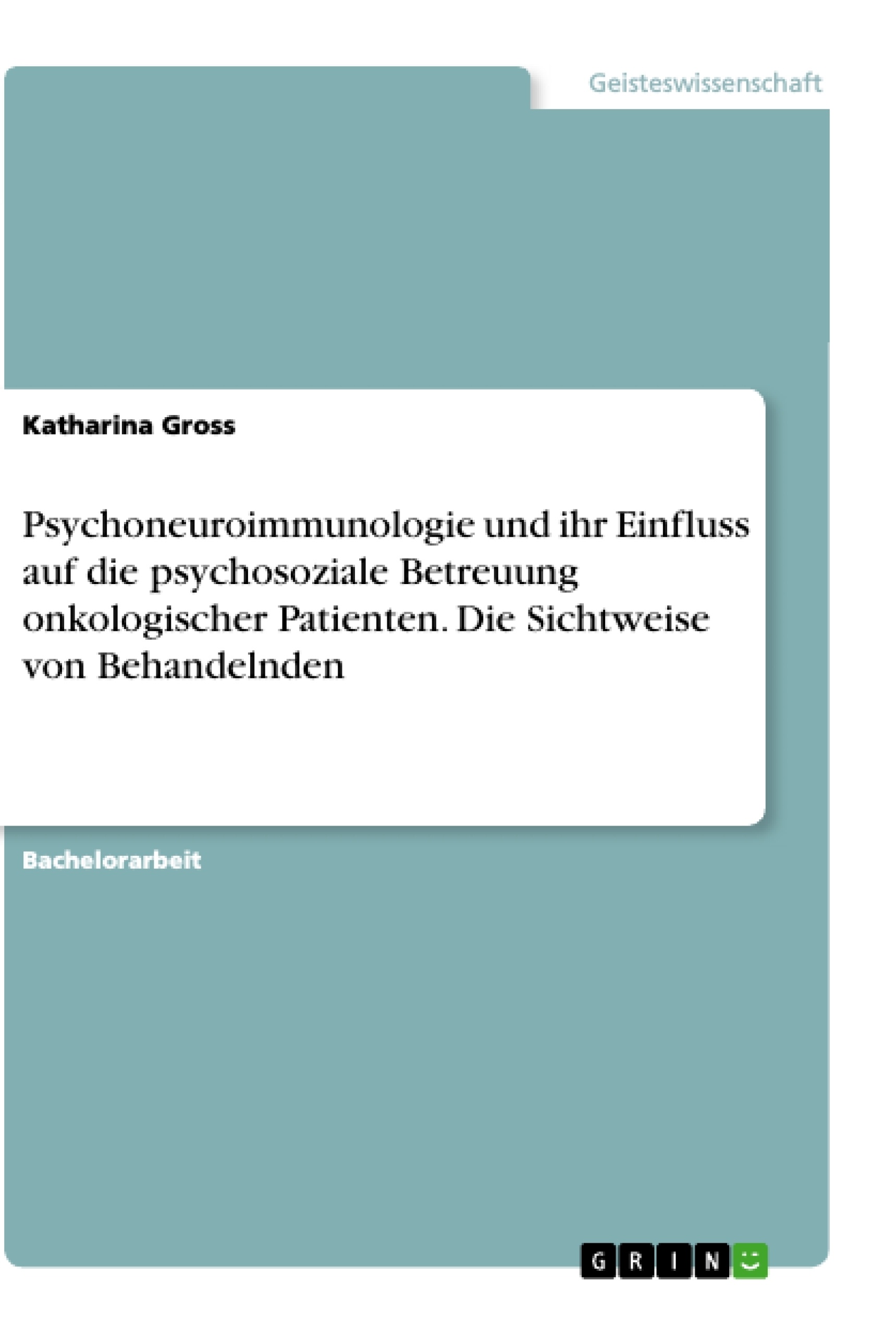Das Ziel der Arbeit besteht darin, mittels einer qualitativen Expertenbefragung herauszustellen, welche Aspekte der Psychoneuroimmunologie (PNI) bereits jetzt in der psychosozialen Betreuung von onkologischen Patienten Berücksichtigung finden. Die PNI untersucht unter anderem, welchen Einfluss psychosoziale Stressoren auf die Entwicklung von Tumoren haben. Hierzu hat sich die Studienlage längst dahingehend verdichtet, dass psychische Belastungen die Tumor- und Rezidivbildung begünstigen können. Umso interessierter ist die Wissenschaft daran, herauszufinden, insbesondere welche psychologischen Faktoren dieser negativen Dynamik entgegenwirken können. Auch hierzu existieren inzwischen zahlreiche Studien, die bemerkenswerte Ergebnisse eruieren konnten. Die Einbindung dieses Wissens ist bereits gegenwärtig sinnvoll, wenngleich die junge Disziplin der PNI noch beträchtliches Potential birgt.
Weltweit geht etwa jeder zweite Todesfall auf eine entzündungsbedingte Erkrankung zurück, wie eine Metaanalyse von Shields, Spahr und Slavich zeigt. Das Interesse daran, zu begreifen, wie solche Entzündungsprozesse entstehen, aufrechterhalten und reduziert werden können, ist folglich ein wichtiges Forschungsunterfangen. Einen maßgeblichen Beitrag leistet hierzu der vergleichsweise junge Forschungszweig der Psychoneuroimmunologie (PNI). Sie beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Psyche, Nerven-, Immun- und Hormonsystem, d. h., sie geht der Frage nach, wie sich psychosoziale und psychische Faktoren auf diese Funktionsbereiche auswirken und welche Informationen daraus sowohl für somatische, psychische und psychosomatische Krankheitsbilder, aber auch für die Erhaltung der Gesundheit genutzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychoneuroimmunologie
- Beschaffenheit und Grundfunktionen des Immunsystems
- Stress
- Biologisch-physiologische Erklärung von Stress
- Psychologische Erklärung von Stress
- Stress und Psychoneuroimmunologie
- TH1-TH2-Shift
- Silent inflammation
- Sickness behavior
- Zusammenfassung
- Psychologische Komponenten vor dem Hintergrund der Psychoneuroimmunologie
- Positivfaktoren für das Immunsystem
- Stressmanagement
- Achtsamkeit
- Musiktherapie
- Expressives Schreiben
- Psychotherapie
- Psychoneuroimmunologie und Krebserkrankungen
- Zusammenhang von Psychoneuroimmunologie und Krebs
- Leitlinienprogramm der Psychoonkologie für Erwachsene
- Psychoonkologische Interventionen der S3-Leitlinie Psychoonkologie
- Methodik
- Wahl der qualitativen Forschungsmethode - Expertenbefragung
- Vom Leifaden-Interview zur „schriftlichen Expertenbefragung“
- Auswahl der Experten
- Auswertungsmethode - Qualitative Inhaltsanalyse
- Kategorienbildung und -definition
- Leitfaden bzw. Fragenkonzeption
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Darstellung und Analyse der Expertenbefragung
- Zusammenfassung und Empfehlungen
- Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Integration von Forschungsergebnissen der Psychoneuroimmunologie (PNI) in die psychosoziale Betreuung onkologischer Patienten aus der Sicht von Behandelnden. Die Arbeit analysiert, inwiefern die Erkenntnisse der PNI über die Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nervensystem und Immunsystem in der Praxis Anwendung finden und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben.
- Die Bedeutung der PNI für die Behandlung von Krebserkrankungen
- Der Einfluss von Stress und anderen psychosozialen Faktoren auf das Immunsystem und den Krankheitsverlauf
- Die Rolle von psychologischen Positivfaktoren und Interventionen in der onkologischen Betreuung
- Die Herausforderungen und Chancen der PNI-Integration in die Praxis
- Die Perspektive von Behandelnden hinsichtlich der Anwendung von PNI-Erkenntnissen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Psychoneuroimmunologie (PNI), die die komplexen Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nervensystem und Immunsystem beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf dem Einfluss von Stress und anderen psychosozialen Faktoren auf das Immunsystem und die Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Behandlung von Krebserkrankungen. Es werden zudem wichtige psychologische Komponenten wie Positivfaktoren, Stressmanagement und Achtsamkeit im Kontext der PNI vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet anschließend die Methodik der Expertenbefragung und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse.
Die Ergebnisse der Expertenbefragung zeigen, dass grundlegende PNI-Kenntnisse teilweise Eingang in die Kommunikation von Behandelnden und onkologischen Patienten gefunden haben. Allerdings wird das edukative Potenzial und das Angebot an Interventionsmöglichkeiten, die aus den PNI-Forschungsergebnissen hervorgehen, noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Die Arbeit diskutiert die Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsschwerpunkte.
Schlüsselwörter
Psychoneuroimmunologie, Psychoonkologie, Immunsystem, Stress, Entzündung, Krebs, psychosoziale Betreuung, Expertenbefragung, qualitative Inhaltsanalyse, Interventionen, Positivfaktoren, edukatives Potenzial.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Psychoneuroimmunologie (PNI)?
Die PNI erforscht die Wechselwirkungen zwischen der Psyche, dem Nervensystem, dem Hormonsystem und dem Immunsystem.
Wie beeinflusst Stress Krebserkrankungen?
Psychosozialer Stress kann Entzündungsprozesse fördern und das Immunsystem schwächen, was die Tumorbildung oder Rückfälle begünstigen kann.
Welche psychologischen Faktoren wirken positiv auf das Immunsystem?
Dazu zählen Achtsamkeit, Stressmanagement, Musiktherapie, expressives Schreiben und eine unterstützende Psychotherapie.
Was ist der TH1-TH2-Shift?
Es beschreibt eine Verschiebung der Immunantwort unter Stress, die die zelluläre Abwehr schwächt und die Anfälligkeit für chronische Krankheiten erhöht.
Wird PNI bereits in der Psychoonkologie angewendet?
Grundkenntnisse fließen teilweise ein, jedoch wird das volle edukative und therapeutische Potenzial laut Expertenbefragungen noch nicht ausgeschöpft.
- Quote paper
- Katharina Gross (Author), 2021, Psychoneuroimmunologie und ihr Einfluss auf die psychosoziale Betreuung onkologischer Patienten. Die Sichtweise von Behandelnden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1148107