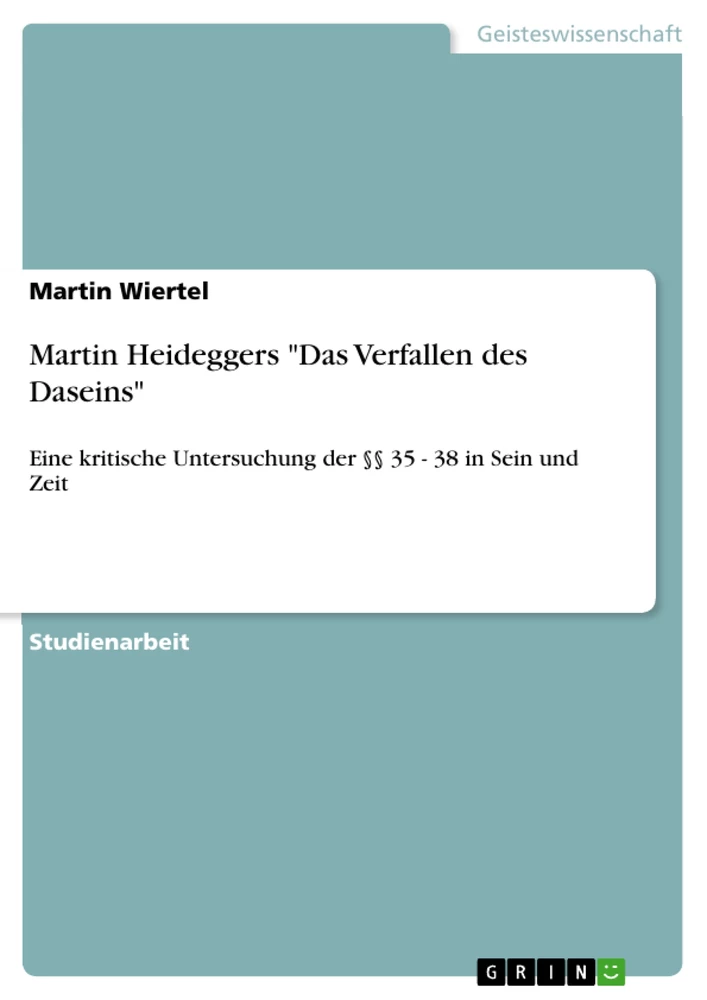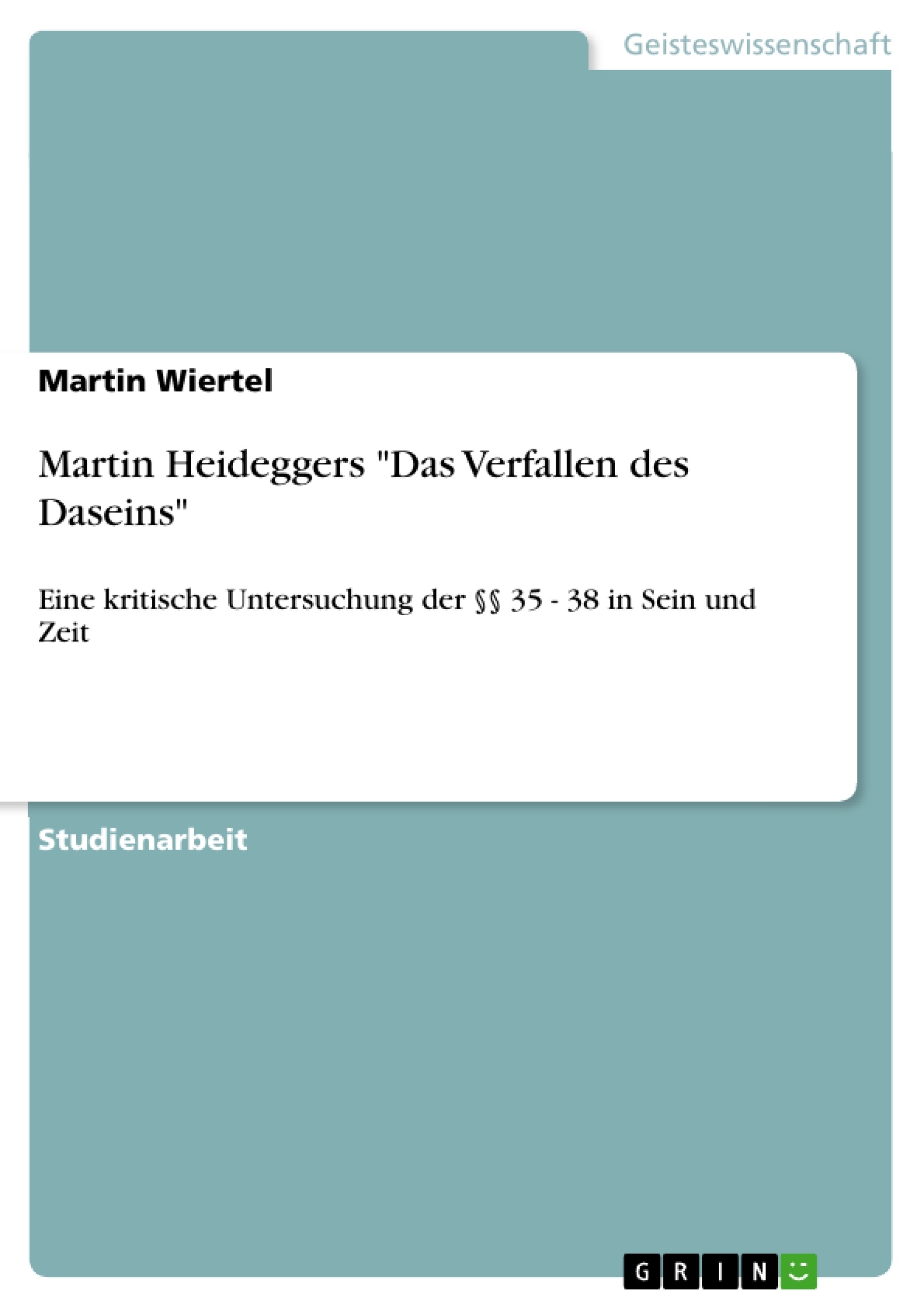Diese Arbeit untersucht „Das In-Sein als solches“ und im Besonderen „Das alltägliche Sein des Da und das Verfallen des Daseins“, einen Aspekt des ersten Abschnitts im fünften Kapitel von Sein und Zeit. Um die thematisierten Modi der Uneigentlichkeit zu verstehen, werden die Paragrafen 35 „Das Gerede“, 36 „Die Neugier“ und 37 „Die Zweideutigkeit“ dargestellt und analysiert.
Der Fokus liegt somit auf der Verfallenheit des Daseins und der Bestimmung der Existenzialien Rede, Verstehen und Befindlichkeit vom Man her, um die Alltäglichkeit des Daseins in den Blick zu bekommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Sein und Zeit §§ 35 - 37: Das Verfallen des Daseins ans Man
- 1. Das Gerede
- 2. Die Neugier
- 3. Die Zweideutigkeit
- II. Das Verfallen und die Geworfenheit
- III. Konsequenzen des Verfallens im Kontext einer Mathematisierung des Daseins im 21. Jahrhundert
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Heideggers Konzept des „Verfallens des Daseins“ in Sein und Zeit (§§ 35-38), insbesondere im Kontext der Alltäglichkeit und des „Man“. Die Arbeit analysiert die beschriebenen Modi der Uneigentlichkeit (Gerede, Neugier, Zweideutigkeit) und deren Auswirkungen auf die Existenzialien Befindlichkeit, Verstehen und Rede. Die Verbindung zu modernen Tendenzen einer Mathematisierung des Daseins wird ebenfalls diskutiert.
- Heideggers Konzept des „Man“ und seine Bedeutung für das alltägliche Dasein
- Analyse der Existenzialien Befindlichkeit, Verstehen und Rede im Kontext des Verfallens
- Die Modi der Uneigentlichkeit: Gerede, Neugier und Zweideutigkeit
- Das Verhältnis von Verfallenheit und Geworfenheit
- Die Relevanz von Heideggers Philosophie für das 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext von Heideggers Sein und Zeit, seine Bedeutung in der Philosophie und die zentralen Fragen, die die Arbeit behandelt. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Untersuchung der §§ 35-38 und die Verbindung zu modernen philosophischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Bedeutung der Alltäglichkeit des Daseins als Ausgangspunkt für Heideggers Analyse wird hervorgehoben.
I. Sein und Zeit §§ 35 - 37: Das Verfallen des Daseins ans Man: Dieses Kapitel analysiert Heideggers Beschreibung des „Verfallens“ des Daseins an das „Man“ in den Paragraphen 35-37 von Sein und Zeit. Es erläutert die drei Modi der Uneigentlichkeit – Gerede, Neugier und Zweideutigkeit – und deren Einfluss auf die Existenzialien Befindlichkeit, Verstehen und Rede. Die Analyse zeigt, wie diese Modi die Authentizität des Daseins behindern und es in ein unreflektiertes, alltägliches Sein führen. Die Bedeutung der Erschlossenheit und die formal-anzeigende Methode Heideggers werden im Kontext dieser Analyse diskutiert, um die Bedeutung des Verfallens für das Verständnis des Daseins zu beleuchten. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, sich von der Anonymität des „Man“ zu lösen, um ein authentisches Sein zu erreichen. Die Zusammenhänge zwischen den drei Modi der Uneigentlichkeit und ihre gegenseitige Beeinflussung werden herausgearbeitet und veranschaulicht.
II. Das Verfallen und die Geworfenheit: Dieses Kapitel setzt sich mit dem Paragraphen 38 auseinander, der das Verfallen des Daseins und die Geworfenheit thematisiert. Es untersucht die enge Verbindung zwischen der Uneigentlichkeit des „Man“ und der grundlegenden Geworfenheit des Daseins. Die Analyse beleuchtet, wie die Geworfenheit in die Strukturen des „Man“ eingebunden ist und wie diese Struktur das Verständnis des eigenen Seins beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Geworfenheit die Möglichkeiten des Daseins einschränkt und gleichzeitig prägt. Das Kapitel veranschaulicht, wie der Mensch in seinem alltäglichen Sein von vorgegebenen Strukturen geprägt und gelenkt wird, ohne diese unbedingt zu reflektieren.
Schlüsselwörter
Martin Heidegger, Sein und Zeit, Dasein, Verfallen, Man, Uneigentlichkeit, Existenzialien, Befindlichkeit, Verstehen, Rede, Geworfenheit, Alltäglichkeit, Authentizität, Mathematisierung des Daseins.
Häufig gestellte Fragen zu: Seminararbeit über Heideggers "Verfallen des Daseins"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Heideggers Konzept des „Verfallens des Daseins“ in Sein und Zeit (§§ 35-38), insbesondere im Kontext der Alltäglichkeit und des „Man“. Sie analysiert die Modi der Uneigentlichkeit (Gerede, Neugier, Zweideutigkeit) und deren Auswirkungen auf die Existenzialien Befindlichkeit, Verstehen und Rede. Ein weiterer Fokus liegt auf der Verbindung zu modernen Tendenzen einer Mathematisierung des Daseins.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel I analysiert §§ 35-37 von Sein und Zeit und das Verfallen an das „Man“, einschließlich der Modi der Uneigentlichkeit. Kapitel II behandelt das Verhältnis von Verfallenheit und Geworfenheit. Kapitel III diskutiert die Konsequenzen des Verfallens im Kontext der Mathematisierung des Daseins im 21. Jahrhundert. Die Einleitung führt in das Thema ein, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind Heideggers Konzept des „Man“ und seine Bedeutung für das alltägliche Dasein; die Analyse der Existenzialien Befindlichkeit, Verstehen und Rede im Kontext des Verfallens; die Modi der Uneigentlichkeit (Gerede, Neugier, Zweideutigkeit); das Verhältnis von Verfallenheit und Geworfenheit; und die Relevanz von Heideggers Philosophie für das 21. Jahrhundert.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext von Heideggers Sein und Zeit. Kapitel I analysiert das „Verfallen“ an das „Man“ und die drei Modi der Uneigentlichkeit, die die Authentizität des Daseins behindern. Kapitel II untersucht die enge Verbindung zwischen Verfallenheit und Geworfenheit. Die Arbeit betont die Bedeutung der Alltäglichkeit des Daseins und die Notwendigkeit, sich von der Anonymität des „Man“ zu lösen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Martin Heidegger, Sein und Zeit, Dasein, Verfallen, Man, Uneigentlichkeit, Existenzialien, Befindlichkeit, Verstehen, Rede, Geworfenheit, Alltäglichkeit, Authentizität und Mathematisierung des Daseins.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine interpretative und analytische Methode, die sich auf die detaillierte Auslegung von Heideggers Text in Sein und Zeit (§§ 35-38) konzentriert. Dabei wird die formal-anzeigende Methode Heideggers berücksichtigt, um die Bedeutung des Verfallens für das Verständnis des Daseins zu beleuchten.
Welche Bedeutung hat diese Arbeit für das 21. Jahrhundert?
Die Arbeit untersucht die Relevanz von Heideggers Philosophie für das 21. Jahrhundert, indem sie die Verbindung zwischen dem Verfallen des Daseins und modernen Tendenzen, insbesondere der Mathematisierung des Daseins, diskutiert. Sie beleuchtet, wie die im Text dargestellten Konzepte auch heute noch für das Verständnis des menschlichen Daseins relevant sind.
- Quote paper
- Martin Wiertel (Author), 2019, Martin Heideggers "Das Verfallen des Daseins", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146664